21.11.2025 - 23.11.2025
Tagung »Stadt und Kolonialismus« 64. Arbeitstagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung
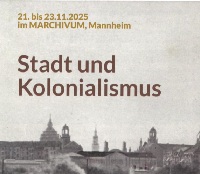
Vom 21.11. bis 23.11. findet mit »Stadt und Kolonialismus« die 64. Arbeitstagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung (SWAK) statt. Veranstaltungsort ist das MARCHIVUM in Mannheim. Geleitet wird sie von Professor Dr. Philip Hahn von der Universität des Saarlandes; Professor Dr. Johannes Paulmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) in Mainz; Dr. Harald Stockert, Direktor des MARCHIVUM in Mannheim; sowie Dr. Christian Groh vom MARCHIVUM in Mannheim.
Anlässlich der Eröffnung am Freitagabend, 18:00 Uhr, geben Professorin Dr. Gabriele B. Clemens, Universität des Saarlandes, Philip Hahn und Johannes Paulmann eine Einführung. Den Abendvortrag hält Dr. Bernhard Gißibl, wissenschaftlicher Mitarbeiter des IEG, zum Thema »Stadt, Land, Fluss, Welt: Historische Verortungen des Kolonialen«.
Die Tagung bringt aktuelle Forschungen zur Beteiligung südwestdeutscher Stadtgesellschaften am Kolonialismus sowie zu kolonialen Prägungen von Städten im deutschen Südwesten zusammen. Zeitlich schlägt sie einen Bogen vom »Kolonialismus ohne Kolonien« des 17. Jahrhunderts über das Kaiserreich bis zur Dekolonisierung im 20. Jahrhundert und Fragen nach dem Umgang mit kolonialem Erbe heute.
Die Tagung findet in Präsenz im MARCHIVUM, Mannheim, statt. Die Vorträge werden gestreamt und im Anschluss im YouTube-Kanal des MARCHIVUM zur Verfügung gestellt: https://www.youtube.com/@marchivummannheim5512
Um Anmeldung wird gebeten bei: christian.groh@mannheim.de
Über die Tagung schreibt Philipp Hahn auf HSozKult: „Der europäische Kolonialismus der Neuzeit hat sich als Fremdherrschaft über andere Länder und Weltregionen nicht nur auf die unterworfenen, abhängig gemachten und ausgebeuteten Gesellschaften und die internationale Politik ausgewirkt. Er wirkte mit seinen Strukturen und seiner Rechtfertigung aus angeblich „zivilisatorischer“ und „rassischer“ Überlegenheit auch auf Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft in Europa selbst zurück.
Damit hat der Kolonialismus auch die Städte im deutschen Südwesten in vielfältiger Weise geprägt. Bereits seit der Frühen Neuzeit und somit lange vor der Etablierung deutscher Kolonien entstanden koloniale Handels- und Arbeitsbeziehungen zu anderen Kontinenten, die mit steigendem Umfang im 19. Jahrhundert eine immer größere Wirkungsmacht auf die lokale und regionale Wirtschaft erlangten und hier teilweise strukturbestimmend wurden. Dies reichte von der kleinen Kolonialwarenhandlung über große Handelshäuser bis hin zu industriellen Großunternehmen, die Rohstoffe aus Übersee verarbeiteten. Auch die global agierenden westeuropäischen Handelskompanien übten als Arbeitgeber eine große Anziehung auf zehntausende Menschen aus dem deutschen Südwesten aus. Auf diese Weise kam eine wachsende Bandbreite der städtischen Gesellschaft direkt oder indirekt mit dem Kolonialismus in Berührung.
Die Stadtgesellschaften selbst eigneten sich das Koloniale in ihrem Innern an und entwickelten entsprechende Selbstbilder und auch Strukturen – angefangen von Missionsvereinen bis hin zu Kolonialgesellschaften. Ihren öffentlichen Ausdruck fand diese Haltung im Kulturbetrieb, etwa in Museen und ihren Sammlungen, Völkerschauen, Abenteuerliteratur, die ihrerseits kolonial geprägte Sprach- und Mentalitätsformen vermittelten. Nicht zuletzt wurden auch Akteure, die direkt in den Kolonien als Verwaltungsangehörige, Militärs, Handelsleute, Missionare oder Abenteurer agierten und nicht selten in Gewalthandlungen involviert waren, zu Helden und Identifikationsfiguren vor Ort inszeniert. Umgekehrt gelangten auch Menschen aus den Kolonien unfreiwillig oder freiwillig in die deutschen Städte. Der Blick auf das fremde „Exotische“ diente dabei auch immer der Bestätigung der eigenen kulturellen, „zivilisatorischen“ Überlegenheit auf der Grundlage eines rassistischen Weltbilds. Aus der kolonialen Verflechtung der Städte resultieren zahlreiche materielle „Überreste“ im öffentlichen Raum wie Straßen oder Denkmäler, die heute in der Diskussion sind. Zivilgesellschaftliche Gruppen, aber auch schon erste Kommunalverwaltungen haben begonnen, sich mit dem Kolonialismus und seinen Ausprägungen in ihren Städten auseinanderzusetzen.
Die Tagung soll zum einen zu einer wissenschaftlich begründeten Aufarbeitung und Debatte beitragen, zum anderen verschiedene Strategien der Aufarbeitung zusammenfassen und diskutieren."
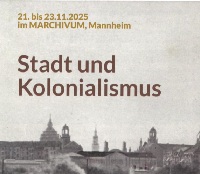 Vom 21.11. bis 23.11. findet mit »Stadt und Kolonialismus« die 64. Arbeitstagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung (SWAK) statt. Veranstaltungsort ist das MARCHIVUM in Mannheim. Geleitet wird sie von Professor Dr. Philip Hahn von der Universität des Saarlandes; Professor Dr. Johannes Paulmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) in Mainz; Dr. Harald Stockert, Direktor des MARCHIVUM in Mannheim; sowie Dr. Christian Groh vom MARCHIVUM in Mannheim.
Anlässlich der Eröffnung am Freitagabend, 18:00 Uhr, geben Professorin Dr. Gabriele B. Clemens, Universität des Saarlandes, Philip Hahn und Johannes Paulmann eine Einführung. Den Abendvortrag hält Dr. Bernhard Gißibl, wissenschaftlicher Mitarbeiter des IEG, zum Thema »Stadt, Land, Fluss, Welt: Historische Verortungen des Kolonialen«.
Die Tagung bringt aktuelle Forschungen zur Beteiligung südwestdeutscher Stadtgesellschaften am Kolonialismus sowie zu kolonialen Prägungen von Städten im deutschen Südwesten zusammen. Zeitlich schlägt sie einen Bogen vom »Kolonialismus ohne Kolonien« des 17. Jahrhunderts über das Kaiserreich bis zur Dekolonisierung im 20. Jahrhundert und Fragen nach dem Umgang mit kolonialem Erbe heute.
Die Tagung findet in Präsenz im MARCHIVUM, Mannheim, statt. Die Vorträge werden gestreamt und im Anschluss im YouTube-Kanal des MARCHIVUM zur Verfügung gestellt: https://www.youtube.com/@marchivummannheim5512
Um Anmeldung wird gebeten bei: christian.groh@mannheim.de
Über die Tagung schreibt Philipp Hahn auf HSozKult: „Der europäische Kolonialismus der Neuzeit hat sich als Fremdherrschaft über andere Länder und Weltregionen nicht nur auf die unterworfenen, abhängig gemachten und ausgebeuteten Gesellschaften und die internationale Politik ausgewirkt. Er wirkte mit seinen Strukturen und seiner Rechtfertigung aus angeblich „zivilisatorischer“ und „rassischer“ Überlegenheit auch auf Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft in Europa selbst zurück.
Damit hat der Kolonialismus auch die Städte im deutschen Südwesten in vielfältiger Weise geprägt. Bereits seit der Frühen Neuzeit und somit lange vor der Etablierung deutscher Kolonien entstanden koloniale Handels- und Arbeitsbeziehungen zu anderen Kontinenten, die mit steigendem Umfang im 19. Jahrhundert eine immer größere Wirkungsmacht auf die lokale und regionale Wirtschaft erlangten und hier teilweise strukturbestimmend wurden. Dies reichte von der kleinen Kolonialwarenhandlung über große Handelshäuser bis hin zu industriellen Großunternehmen, die Rohstoffe aus Übersee verarbeiteten. Auch die global agierenden westeuropäischen Handelskompanien übten als Arbeitgeber eine große Anziehung auf zehntausende Menschen aus dem deutschen Südwesten aus. Auf diese Weise kam eine wachsende Bandbreite der städtischen Gesellschaft direkt oder indirekt mit dem Kolonialismus in Berührung.
Die Stadtgesellschaften selbst eigneten sich das Koloniale in ihrem Innern an und entwickelten entsprechende Selbstbilder und auch Strukturen – angefangen von Missionsvereinen bis hin zu Kolonialgesellschaften. Ihren öffentlichen Ausdruck fand diese Haltung im Kulturbetrieb, etwa in Museen und ihren Sammlungen, Völkerschauen, Abenteuerliteratur, die ihrerseits kolonial geprägte Sprach- und Mentalitätsformen vermittelten. Nicht zuletzt wurden auch Akteure, die direkt in den Kolonien als Verwaltungsangehörige, Militärs, Handelsleute, Missionare oder Abenteurer agierten und nicht selten in Gewalthandlungen involviert waren, zu Helden und Identifikationsfiguren vor Ort inszeniert. Umgekehrt gelangten auch Menschen aus den Kolonien unfreiwillig oder freiwillig in die deutschen Städte. Der Blick auf das fremde „Exotische“ diente dabei auch immer der Bestätigung der eigenen kulturellen, „zivilisatorischen“ Überlegenheit auf der Grundlage eines rassistischen Weltbilds. Aus der kolonialen Verflechtung der Städte resultieren zahlreiche materielle „Überreste“ im öffentlichen Raum wie Straßen oder Denkmäler, die heute in der Diskussion sind. Zivilgesellschaftliche Gruppen, aber auch schon erste Kommunalverwaltungen haben begonnen, sich mit dem Kolonialismus und seinen Ausprägungen in ihren Städten auseinanderzusetzen.
Die Tagung soll zum einen zu einer wissenschaftlich begründeten Aufarbeitung und Debatte beitragen, zum anderen verschiedene Strategien der Aufarbeitung zusammenfassen und diskutieren."
Vom 21.11. bis 23.11. findet mit »Stadt und Kolonialismus« die 64. Arbeitstagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung (SWAK) statt. Veranstaltungsort ist das MARCHIVUM in Mannheim. Geleitet wird sie von Professor Dr. Philip Hahn von der Universität des Saarlandes; Professor Dr. Johannes Paulmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) in Mainz; Dr. Harald Stockert, Direktor des MARCHIVUM in Mannheim; sowie Dr. Christian Groh vom MARCHIVUM in Mannheim.
Anlässlich der Eröffnung am Freitagabend, 18:00 Uhr, geben Professorin Dr. Gabriele B. Clemens, Universität des Saarlandes, Philip Hahn und Johannes Paulmann eine Einführung. Den Abendvortrag hält Dr. Bernhard Gißibl, wissenschaftlicher Mitarbeiter des IEG, zum Thema »Stadt, Land, Fluss, Welt: Historische Verortungen des Kolonialen«.
Die Tagung bringt aktuelle Forschungen zur Beteiligung südwestdeutscher Stadtgesellschaften am Kolonialismus sowie zu kolonialen Prägungen von Städten im deutschen Südwesten zusammen. Zeitlich schlägt sie einen Bogen vom »Kolonialismus ohne Kolonien« des 17. Jahrhunderts über das Kaiserreich bis zur Dekolonisierung im 20. Jahrhundert und Fragen nach dem Umgang mit kolonialem Erbe heute.
Die Tagung findet in Präsenz im MARCHIVUM, Mannheim, statt. Die Vorträge werden gestreamt und im Anschluss im YouTube-Kanal des MARCHIVUM zur Verfügung gestellt: https://www.youtube.com/@marchivummannheim5512
Um Anmeldung wird gebeten bei: christian.groh@mannheim.de
Über die Tagung schreibt Philipp Hahn auf HSozKult: „Der europäische Kolonialismus der Neuzeit hat sich als Fremdherrschaft über andere Länder und Weltregionen nicht nur auf die unterworfenen, abhängig gemachten und ausgebeuteten Gesellschaften und die internationale Politik ausgewirkt. Er wirkte mit seinen Strukturen und seiner Rechtfertigung aus angeblich „zivilisatorischer“ und „rassischer“ Überlegenheit auch auf Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft in Europa selbst zurück.
Damit hat der Kolonialismus auch die Städte im deutschen Südwesten in vielfältiger Weise geprägt. Bereits seit der Frühen Neuzeit und somit lange vor der Etablierung deutscher Kolonien entstanden koloniale Handels- und Arbeitsbeziehungen zu anderen Kontinenten, die mit steigendem Umfang im 19. Jahrhundert eine immer größere Wirkungsmacht auf die lokale und regionale Wirtschaft erlangten und hier teilweise strukturbestimmend wurden. Dies reichte von der kleinen Kolonialwarenhandlung über große Handelshäuser bis hin zu industriellen Großunternehmen, die Rohstoffe aus Übersee verarbeiteten. Auch die global agierenden westeuropäischen Handelskompanien übten als Arbeitgeber eine große Anziehung auf zehntausende Menschen aus dem deutschen Südwesten aus. Auf diese Weise kam eine wachsende Bandbreite der städtischen Gesellschaft direkt oder indirekt mit dem Kolonialismus in Berührung.
Die Stadtgesellschaften selbst eigneten sich das Koloniale in ihrem Innern an und entwickelten entsprechende Selbstbilder und auch Strukturen – angefangen von Missionsvereinen bis hin zu Kolonialgesellschaften. Ihren öffentlichen Ausdruck fand diese Haltung im Kulturbetrieb, etwa in Museen und ihren Sammlungen, Völkerschauen, Abenteuerliteratur, die ihrerseits kolonial geprägte Sprach- und Mentalitätsformen vermittelten. Nicht zuletzt wurden auch Akteure, die direkt in den Kolonien als Verwaltungsangehörige, Militärs, Handelsleute, Missionare oder Abenteurer agierten und nicht selten in Gewalthandlungen involviert waren, zu Helden und Identifikationsfiguren vor Ort inszeniert. Umgekehrt gelangten auch Menschen aus den Kolonien unfreiwillig oder freiwillig in die deutschen Städte. Der Blick auf das fremde „Exotische“ diente dabei auch immer der Bestätigung der eigenen kulturellen, „zivilisatorischen“ Überlegenheit auf der Grundlage eines rassistischen Weltbilds. Aus der kolonialen Verflechtung der Städte resultieren zahlreiche materielle „Überreste“ im öffentlichen Raum wie Straßen oder Denkmäler, die heute in der Diskussion sind. Zivilgesellschaftliche Gruppen, aber auch schon erste Kommunalverwaltungen haben begonnen, sich mit dem Kolonialismus und seinen Ausprägungen in ihren Städten auseinanderzusetzen.
Die Tagung soll zum einen zu einer wissenschaftlich begründeten Aufarbeitung und Debatte beitragen, zum anderen verschiedene Strategien der Aufarbeitung zusammenfassen und diskutieren."

