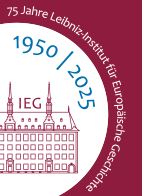Foresta, Patrizio
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016
ISBN: 978-3-525-10100-1
DOI: 10.13109/9783666101007
"Wie ein Apostel Deutschlands"
Apostolat, Obrigkeit und jesuitisches Selbstverständnis am Beispiel des Petrus Canisius (1543-1570)
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, 239: Abt. Abendländische ReligionsgeschichteGöttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016
ISBN: 978-3-525-10100-1
DOI: 10.13109/9783666101007
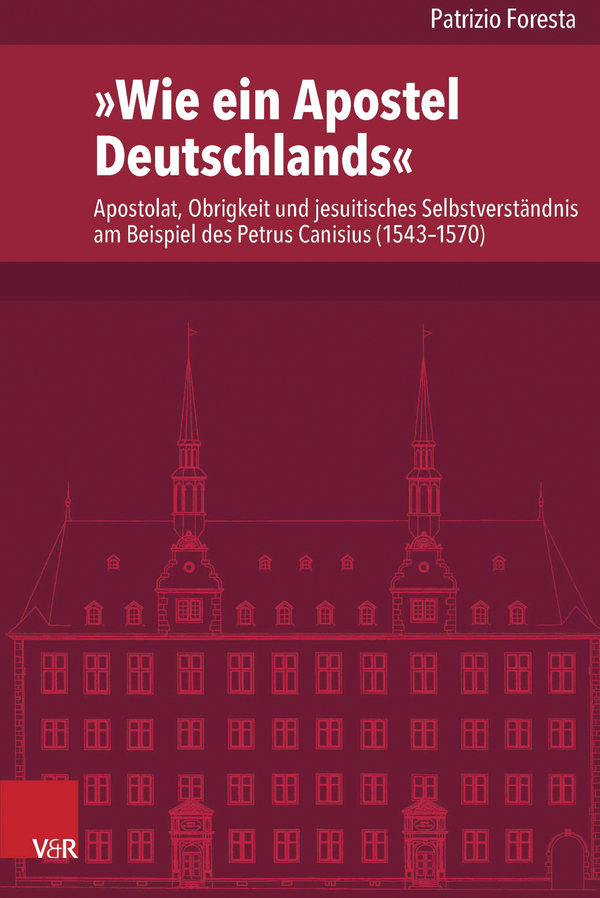
Aus: Witt, Christian Volkmar: Rezension zu: »Wie ein Apostel Deutschlands«. Apostolat, Obrigkeit und jesuitisches Selbstverständnis am Beispiel des Petrus Canisius (1543–1570), in: Theologische Literaturzeitung (04/2017).
»Die umfangreiche Studie bringt neben der ausführlichen Biographie einen nützlichen Quellenanhang ausgewählter Dokumente zu Canisius und ist insgesamt ein wichtiger Beitrag zu einem Themengebiet früher jesuitischer Konzepte, und zu Canisius, zu dem sicher noch weitere Forschungen ein vielschichtigeres Bild ergeben können.«
Aus: Obermeier, Franz: Rezension von: Patrizio Foresta: »Wie ein Apostel Deutschlands«. Apostolat, Obrigkeit und jesuitisches Selbstverständnis am Beispiel des Petrus Canisius (1543-1570), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2016, in: sehepunkte 16 (2016), Nr. 1 [15.01.2016], URL: http://www.sehepunkte.de/2016/01/20032.html.
«Die Untersuchung von Patrizio Foresta ist eine quellengesättigte und mit internationaler Forschungsliteratur vernetzte Studie, die mit dem Apostolatsbegriff einen innovativen, aber sicher noch weiter zu diskutierenden Zugang zur historisch-theologischen Einordnung der Jesuiten ins konfessionelle Zeitalter bietet.«
Aus: Holzbrecher, Sebastian: Rezension zu: Foresta, Patrizio: »Wie ein Apostel Deutschlands«. Apostolat, Obrigkeit und jesuitisches Selbstverständnis am Beispiel des Petrus Canisius (1543-1570), Göttingen 2016 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 239), in: Brodkorb, Clemens u. Fiedler, Norbert [Hgg.]: Jahrbuch für mitteldeutsche Kirchen- und Ordensgeschichte, 13. Heiligenstadt 2017.
Zum Inhalt: Nach dem Auftreten der Reformation und besonders nach der Verhärtung der konfessionellen Fronten im Anschluss an den Augsburger Reichstag 1555 wurden die Territorien des Alten Reichs in den Augen vieler Zeitgenossen das Haupteinsatzfeld der so genannten katholischen Reform und Gegenreformation bzw. des frühneuzeitlichen Katholizismus. Dies galt auch für diejenigen Jesuiten, die bereits ab 1540-1541 in Deutschland eingesetzt worden waren. Ihnen trat eine Situation entgegen, die wegen der extremen Vielfalt der religiösen, politischen und sozialen Gegebenheiten sehr schwer zu bewältigen war und worauf sie anfangs unvorbereitet waren. Das war der Hauptgrund, weswegen sie ein möglichst breites Spektrum an Strategien entwickeln mussten, welche die vor ihnen stehenden religionspolitischen Fragen hätten lösen können. Die Jesuiten erkannten in der Erfüllung ihrer Aufgaben den apostolischen, i. e. den heilsgeschichtlichen und zugleich seelsorglichen Charakter ihrer Societas Jesu. Er wurde in der Natur und Berufung des Ordens in dem Maße gesehen, wie sich die Patres selbst als »Apostel« wahrnahmen. In diesem Zusammenhang wird das Selbst- und Apostolatsverständnis des Jesuiten Petrus Canisius (1521-1597) und derjenigen Patres (unter anderen Jerónimo Claude Jay, Pierre Favre, Alfonso Salmerón, Nicolas Bobadilla, Paul Hoffaeus), die als erste nach Deutschland gesandt wurden, dort tätig waren und die Anfangsjahre der deutschen Ordensprovinzen prägten, unter besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zur Obrigkeit untersucht.
The first Jesuits who from 1540–1541 on were sent to Germany developed a very broad spectrum of strategies in order to solve the many religious and political issues they had to face. While fulfilling their duties they became aware of what in their eyes was the innermost apostolic nature of the Society of Jesus. The volume investigates the apostolic self-concept and works of Petrus Canisius (1521–1597) and of his fellow Jesuits (and among them especially those of Jerónimo Claude Jay, Pierre Favre, Alfonso Salmerón, Nicolas Bobadilla, Paul Hoffaeus) in the German Empire, with a particular regard to their relation to political and ecclesiastical authority.