
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Beiheft online 3
Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.)
Instrumente des Friedens
Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa
Mainz: Institut für Europäische Geschichte 2008
ISSN: 1863-897X
Empfohlene Zitierweise:
Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.): Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3).
URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html
URN: urn:nbn:de:0159-2008062408
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieser Publikation hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Inhaltsverzeichnis
Heinz Duchhardt
»Europa« als Begründungsformel in den Friedensverträgen des 18. Jahrhunderts: von der »tranquillité« zur »liberté«
Martin Peters
Heiraten für den Frieden. Europäische Heiratsverträge als dynastische Friedensinstrumente der Vormoderne
Hildo van Engen
Der Frieden von Ath (1357): Ein Schiedsspruch zwischen Dichtung und Wahrheit
Andrea Weindl
Europäische Handelsverträge – Friedensinstrument zwischen Kommerz und Politik
Andrea Schmidt-Rösler
Prälimarfriedensverträge als Friedensinstrumente der Frühen Neuzeit
Peter Seelmann
Aufhebungen und Einschränkungen des Jus albinagii – ein Instrument des Friedens?
Heinz Duchhardt und Martin Peters *
Vorwort
Gliederung:
Text:
Welche Instrumente der Friedenssicherung und welche rechtlichen Optionen der Friedensherstellung gab es in der Vormoderne? Welchem Bedeutungswandel waren diese Instrumente im Laufe der Zeit unterworfen? Mehrere Spielarten von Friedensvertrags- und -artikeltypen – Schiedssprüche, Heiratsverträge, Handelsverträge, Präliminarverträge, Aufhebungsverträge des Droit d’Aubaine, Gefangenenaustauschartikel – werden in dem vorliegenden online-Sammelband vorgestellt. Allen diesen Instrumenten eigen sind ihr Bezug auf Christenheit, »tranquillitas« beziehungsweise »Europa« als Referenzpunkte und Begründungsmetaphern (Duchhardt). Nicht jede dieser vormodernen Friedensvertragsformen wies in die Zukunft. Heiratsverträge wurden mit zunehmendem Zurücktreten der Dynastien im Zuge der »Verstaatlichung« der internationalen Beziehungen aus dem Inventar friedensstiftender Instrumente verdrängt (Peters), während Präliminarverträge im 19. Jahrhundert in Übung kamen (Schmidt-Rösler). Schiedssprüche mit dem Ziel der Schlichtung sind auch heute noch – bei allen Differenzen im Detail – als kreative Optionen der Konfliktvermeidung gebräuchlich (van Engen). Die Beiträge über die Aufhebung des Droit d’Aubaine (Seelmann) und über Modalitäten des Gefangenenaustauchs (Schäfer) lassen das transferhistorische Potential und die Ansätze der Vernetzung der Länder und Staaten sowie ihrer Einwohner aufleuchten. Dass auch Handelsverträgen in der Vormoderne eine hohe dynastische sowie politische Bedeutung der frühneuzeitlichen Friedenspolitik zukommt (Weindl), ist nur ein Ergebnis von vielen Forschungsresultaten, das durch die Auswertung und Analyse der 1.500 Friedensverträge umfassenden Mainzer Bilddatenbank (www.ieg-mainz.de/friedensvertraege) erzielt werden konnte.Mit der vorliegenden online-Publikation erscheint der zweite Sammelband, der im Rahmen des DFG-geförderten Mainzer Projekts »Europäische Friedensverträge der Vormoderne« entstand. Im Jahre 2006 konnte die Dokumentation eines Wolfenbütteler Arbeitsgesprächs »Kalkül – Transfer – Symbol: Europäische Friedensverträge der Vormoderne« abgeschlossen und präsentiert werden, an dem Frühneuzeithistoriker und Völkerrechtler teilgenommen hatten. Dieses Mal wurde der Sammelband ausschließlich von MitarbeiterInnen des oben genannten Projekts getragen. Dieser neue online-Band kann zugleich als Ausgangspunkt für die nächste Phase des Projekts gewertet werden, die im Januar 2008 eingesetzt hat und eine Laufzeit von 24 Monaten haben wird. Auch dieses Fortsetzungsprojekt dient der Erforschung vormoderner Friedensverträge als ein kulturelles Erbe, das es zu sichern gilt, und als eine exzeptionelle kulturhistorische Quelle, die jetzt nach und nach umfassend und systematisch erschlossen wird.
Für Unterstützung bei der redaktionellen Betreuung ist Dr. Bengt Büttner und für die Erstellung der Formatvorlage Frau Natalia Schreiner zu danken.
Mainz, im April 2008
Heinz Duchhardt
Martin Peters
4
[*] Heinz Duchhardt, Prof. Dr., Institut für Europäische Geschichte Mainz, Direktor der Abteilung für Universalgeschichte und Leiter des DFG-Projekts »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
Martin Peters, Dr., Institut für Europäische Geschichte Mainz, Koordinator und Sprecher des DFG-Projekts »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
Heinz Duchhardt und Martin Peters, Vorwort, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 4–4.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008062408>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 5 oder 4–7.
Heinz Duchhardt *
»Europa« als Begründungsformel in den Friedensverträgen des 18. Jahrhunderts: von der »tranquillité« zur »liberté«
Gliederung:
Text:
Begründungen eines Friedensvertrags sind, wie die profunde Studie von Jörg Fisch über Krieg und Frieden im Friedensvertrag gelehrt hat,[1] so alt wie das Vertragswesen selbst. Fisch hat verschiedene Klassifizierungen vorgenommen, u.a. eine Unterteilung in Vertragsbegründungen und Einzelbegründungen, von denen letztere das europäische Mittelalter dominieren, wohingegen in der Neuzeit die Vertragsbegründungen im eigentlichen Sinn die Oberhand gewinnen. Vertragsbegründungen sind dabei, so Fisch, im Vergleich »grundsätzlicher, berufen sich eher auf die allgemeinen Prinzipien des Vertragsschlusses«.[2] Dazu konnte in Einzelfällen die Vorgeschichte des zu beendenden Konflikts mit all ihren ideologischen Konnotationen als explizite Begründung des Friedensvertrags dienen, verstärkt aber auch der Rückgriff auf »Instanzen […], die in der jeweiligen Zeit als besonders wichtig gelten«.[3] Diesen »Instanzen«, die man heute wohl eher als Begründungsfiguren bezeichnen würde, gilt unser Interesse.
Es zählt zu den schon häufiger beobachteten Tatsachen, dass sich die zentrale Formel, mit der die vertragschließenden Parteien die Notwendigkeit oder doch Sinnhaftigkeit des geschlossenen Friedens begründeten, in den Jahrzehnten nach dem Westfälischen Frieden veränderte.[4] So ist in einem Beitrag zum Gedenkjahr 1998 der Völkerrechtler Heinhard Steiger dem sich wandelnden Sprachgebrauch und den entsprechenden Begrifflichkeiten nachgegangen:[5] Meistens am Beginn des sog. Kontextes des Urkundenformulars hoben die Vertragschließenden in aller Regel in verschiedenen Varianten auf die Christianitas ab, deren Ruhe wiederhergestellt werden müsse, die danach verlange, dass das Blutvergießen in den Reihen der christlichen Staaten zu einem Ende komme usw. Steiger hat den Weg von der respublica christiana zur Christianitas/Chrétienté nachgezeichnet, aber auch auf alternative Formeln aufmerksam gemacht, die sich auf Dauer nicht durchsetzten (orbis christianum). Auch wenn sich in diesen unterschiedlichen Begriffen politische Entwicklungen spiegeln mögen – von der Einheit und Gemeinsamkeit, die durch die Christlichkeit konstituiert wird, hin zu einem Denken, das »nicht mehr eine politisch einheitliche Struktur« widerspiegelt –, bleibt als Quintessenz, dass an der christlichen Grundlage der europäischen Mächteeinheit festgehalten wird; es soll, so Steiger, »auf diese Weise begrifflich Kontinuität gewahrt bleiben, auch wenn der Begriff inhaltlich und strukturell eine andere Wirklichkeit erfasst«.[6] Diese stereotype Begrifflichkeit, also der Rekurs auf die Christianitas und ihre verschiedenen Varianten, veränderte sich seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts in signifikanter Weise.
5
Dieser Prozess hängt selbstredend damit zusammen, dass im Verlauf des 17. Jahrhunderts die Idee und vor allem die praktisch-politische Seite der Christianitas vollends obsolet geworden waren, wenn dieser Vorgang nicht bereits deutlich früher eingesetzt hatte. Die Idee der Christianitas setzte nicht nur zwei (autoritative und durchsetzungsfähige) Spitzen voraus, eine geistliche und eine weltliche, Papsttum und Kaisertum, sondern – politisch – auch die Bereitschaft der (christlichen) Staatenwelt, sich einer (nicht nur virtuell zu verstehenden) Ordnung zu fügen. Mit beidem sah es spätestens Mitte des 17. Jahrhunderts nicht mehr gut aus: Die Reformation hatte die Autorität der römischen Kurie radikal eingegrenzt. Das Kaisertum konnte nach Karl V. nicht mehr mit dem Anspruch auftreten, eine irgendwie geartete politische Superioritätsstellung einzunehmen oder den Rang eines Arbiter Orbis Christiani zu behaupten, der vielmehr nun immer deutlicher von anderen Mächten beansprucht wurde;[7] und an Ordnungsgedanken, die sich etwa an den päpstlichen Rangtabellen des 15. Jahrhunderts orientierten, verschwendete in Europa ohnehin niemand mehr einen Gedanken: An die Stelle dieser archaischen Abstufungsversuche war längst das Zeremoniell getreten, das zum Schlüssel aller Hierarchisierungen in den internationalen Beziehungen geworden war und sich in frei auszuhandelnden (und damit auch von politischen Konjunkturen abhängigen) Präzedenzien und Titulaturen bemaß, die man dem Gegenüber gab oder aber verweigerte.[8]
Trotz dieses deutlichen Zurücktretens der Christianitas-Vorstellung hätte man sich – das Vertragswesen kennt viele Beispiele dafür – vorstellen können, dass man bei der traditionellen Begründungsfigur geblieben wäre, obwohl der Sache nach eine homogene Christianitas und ein Zusammenwirken ihrer beiden (nominellen) Spitzen nicht mehr existierte und die (schon immer) fiktive harmonische Einheit eines geschichtlichen und politischen Raums der »Christenheit« längst durch Konkurrenz, Gegeneinander und Konfliktualität abgelöst worden war. Der Vorgang, um den es im Folgenden geht, hat etwas mit der beginnenden Frühaufklärung zu tun, mit dem Infragestellen mancher kirchlich determinierten Weltbilder und Wertvorstellungen, und ist somit eine Art Spiegel einer sich rasant beschleunigenden Säkularisierung des politischen Denkens. So wie in den Reichstheorien des 18. Jahrhunderts der Bezug auf die vier Universalmonarchien der Danielschen Weissagung immer mehr zurücktrat,[9] also eine christlich determinierte Sicht der Geschichte obsolet wurde, konnte letztlich auch internationale Politik nicht mehr auf die Grundlage einer vergangenen Ordnungsvorstellung gebaut werden.
6
An anderer Stelle konnte jüngst gezeigt werden,[10] wie der Rekurs auf »Europa« sich ziemlich plötzlich in den frühen 1690er Jahren im Vertragsvölkerrecht zu etablieren beginnt. Ohne die Belege hier im Einzelnen erneut auszubreiten, soll wenigstens auf eine entscheidende Wegmarke verwiesen werden. Wenn in dem umfangreichen Material nichts übersehen wurde, findet sich ein erster Beleg in der Verlängerung der zehnjährigen Defensivallianz zwischen Dänemark und Kurbrandenburg, die am 21. Juni 1692 in Kopenhagen abgeschlossen wurde. Im Protokoll dieses Vertrags wird zunächst das »in der christenheit entbrandte krieges-feuer« ins Feld geführt – seit 1689 stand Europa vor der Herausforderung des Neunjährigen Krieges (um diese Begrifflichkeit für einen in den verschiedenen europäischen Geschichtskulturen ganz unterschiedlich bezeichneten Konflikt zu wählen[11]) –, um die Notwendigkeit einer Fortsetzung der Allianz der beiden nordischen Partner zu begründen, um dann – konkreter – sich darüber zu verständigen, die Regionen, die bisher noch kriegsfrei seien, vor dem Krieg zu bewahren und sich gemeinsam zu bemühen, einen »redlichen, beständigen und sicheren« Frieden zu Stande zu bringen, »wodurch die allgemeine Tranquillität in Europa befestiget werde« (Artikel 4).[12]
Dass man im Hinblick auf unsere Fragestellung in den frühen 1690er Jahren tatsächlich an einem Wendepunkt steht, illustriert auf seine Weise der Vorgängervertrag aus dem Jahr 1682,[13] der genug Gelegenheit geboten hätte, über die Beklagung der gegenwärtigen »Conjuncturen« hinaus die Ruhe und die Sicherheit Europas anzusprechen, die von den beiden Vertragschließenden befördert werden solle. Nichts dergleichen geschah: die Formel hatte in den beginnenden 1680er Jahren in das politische Denken noch keinen Eingang gefunden.
Seit 1692 wurde aber »Europa« zu einer Art Standardformel, um völkerrechtliche Verträge zu begründen und ihnen den Anstrich zu verleihen, die Vertragsparteien handelten völlig selbstlos, nur das Wohl der europäischen Staatenfamilie im Auge habend. Eine ganze Reihe von Belegen findet sich in dem oben genannten Aufsatz in der Burkhardt-Festschrift, auf die verwiesen wird.
Dort war freilich auch festzuhalten, dass keine allgemeine Regel ohne Ausnahme ist. Es war das Frankreich des Roi-Soleil, das in seinen Verträgen mit den bisherigen Kriegsgegnern 1697 den Europa-Bezug geradezu auffällig umging. Ob es der französisch-niederländische Friede vom 20. September jenes Jahres[14] oder der britisch-französische Friedensschluss vom gleichen Tag war: Die Diplomaten vermieden den Rekurs auf die Ruhe Europas und bemühten als Begründungsfigur stattdessen das Vergießen so viel christlichen Blutes (»l’effusion de tant de sang chrêtien«), das nicht mehr fortgesetzt werden dürfe.[15] Der Friedensvertrag mit Spanien, also einem katholischen Staat, bestätigt, dass die französische Diplomatie das Bild vom christlichen Blutvergießen im gegebenen Augenblick offenbar für unverzichtbar hielt und allem Anschein nach – bei der gleichzeitigen Verwendung der »tranquillité publique« hätte sich eigentlich das Europa-Motiv angeboten! – die Europa-Formel bewusst vermied.[16]
7
Über die Gründe sind nur Spekulationen möglich. Die Europa-Formel hätte zu der Assoziation führen können, dass der ganze Kontinent gegen die französische Aggression zusammenstehe und sich organisiere, und dieser Eindruck durfte in einem völkerrechtlichen Dokument der Krone Frankreich nicht entstehen – obwohl natürlich jedermann in Europa wusste, wie der Krieg seinen Anfang genommen hatte. Die französische Diplomatie hatte kein Interesse daran, als Außenseiter innerhalb Europas dazustehen. So wird auch im Vertrag mit Schweden über eine Defensivallianz vom Juli 1698[17] das Europa-Motiv geradezu sorgfältig umgangen: »ut Orbis Christianus solida et firma pace gaudeat« (Artikel 2), »pacis et tranquillitatis publicae conservatio et assertio« (Artikel 2), »ad Orbis Christiani Tranquillitatem tuendam« (Artikel 3) usw.
Erst ab dem Augenblick, als die Krone Frankreich höherer und größerer Ziele wegen auf die europäischen Mächte zuzugehen gezwungen war – also wegen der Sicherung der spanischen Krone für die Dynastie –, wird ein Abrücken von der bisherigen Resistenz gegenüber der Europa-Formel erkennbar. Auch hier mag es mit dem Verweis auf den ersten Beleg sein Bewenden haben: Im 1. Partagetraktat mit den beiden Seemächten aus dem Herbst 1698 brachten die drei Vertragschließenden ihr gemeinsames Ziel zum Ausdruck »de maintenir la tranquillité generale de l’Europe«, und wenn sich jemand gegen den Vertragsinhalt wende, werde man um »le repos de l’Europe« willen Sanktionsmaßnahmen ergreifen.[18] Es drängt sich somit der bestimmte Eindruck auf, dass Frankreich durch den Zwang, mit den Seemächten in der Frage des spanischen Erbes zusammenzuarbeiten, seine anfangs zögerliche, wenn nicht ablehnende Haltung, die Europa-Formel in den Kanon seiner Begründungs- und Legitimationsfiguren aufzunehmen, aufgeben musste und aufgegeben hat. Bei den Friedensverträgen, die der Sonnenkönig nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekriegs einzugehen gezwungen war, fanden dann allem Anschein nach keine Versuche mehr statt, der Europa-Formel zu entgehen. Man wird sagen können, dass »Europa« allerspätestens mit den Utrechter Verträgen, wenn nicht bereits seit dem wegweisenden Allianzvertrag der Frankreichgegner, der Haager Allianz vom September 1701,[19] zum unbestrittenen Zentrum der Legitimationsfiguren wurde.[20]
Befinden wir uns insofern also auf gesichertem Boden, gilt das Interesse dieser kleinen Studie einer Beobachtung, die überhaupt noch niemals thematisiert worden ist. Das »Europa« dieser Phase der völkerrechtlichen Vertragsentwicklung wurde im Allgemeinen mit Substantiven verbunden, die im weiteren Sinn etwas mit »Ruhe« zu tun haben: mit der tranquillitas ganz direkt, mit der »Sicherheit«, dann auch mit dem »Gleichgewicht«, das aber insgesamt nicht zur beherrschenden Vertragsmetapher der europäischen Vormoderne avancierte.[21] Diese Standardformel – der Friede wird geschlossen, um die Ruhe und Sicherheit Europas wiederherzustellen – erfährt im Verlauf des frühen 18. Jahrhunderts dann aber eine höchst aufregende Erweiterung: Ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es nicht mehr nur um die »Ruhe Europas«, sondern auf einmal auch um die Bewahrung oder Wiederherstellung seiner liberté. Im spanisch-britischen Frieden von 1713 ist, wenn ich es richtig sehe, zum ersten Mal auch von der »Libertas […] totius Europae« die Rede.[22]
8
Dass ein solcher Wandel von der tranquilitas zur libertas Europas überhaupt ins Auge gefasst wurde, hat selbstredend etwas mit einem »klassischen« Begriff der beginnenden Aufklärung zu tun, die vor allem die Kategorien der Willens- und Handlungsfreiheit des einzelnen diskutierte, aber auch damit, dass sich der Freiheitsbegriff im Verlauf des frühen und mittleren 18. Jahrhunderts erkennbar politisierte. Johann Georg von Justi hat seine Definition von politischer Freiheit zwar erst 1771 formuliert – politische Freiheit sei die »Freiheit des Staates in Ansehung seines Verhältnisses gegen andere Staaten« –,[23] aber in der Sache bewirkte genau das den Paradigmenwechsel von der tranquilitas zur libertas. Die Freiheit Europas: dem lag die Erfahrung des ludovizianischen Zeitalters zugrunde, der Wille, es nie mehr zu »universalmonarchischen« Versuchen kommen zu lassen, die Entschlossenheit nicht zuletzt, die Vielfalt der europäischen Staatenwelt, was die Staatsform, die Konfession, die Größe, die Ressourcen, die Schlagkraft betraf, nie mehr in Frage stellen zu lassen. Der historischen Semantik, der Begriffsgeschichte, steht hier noch ein weites Feld offen; eine gezielte Recherche scheint keinen Zweifel zu lassen, dass Großbritannien es war, das vorrangig ein Interesse daran hatte, die »Freiheit Europas« in das Vertragsvölkerrecht einzuführen. Nicht zufällig findet sich ein erster Beleg für Londons Entschlossenheit, »pour se mettre en estat de pouvoir toujours veiller à la liberté commune de l’Europe«, in einem Vertrag mit seinem kongenialen Partner jenseits des Kanals.[24]
Ebenso auffällig ist freilich, dass die Formel von der »liberty of Europe« in den Jahrzehnten nach Utrecht wieder zurücktritt. Es war jene Phase der internationalen Politik, die – zumindest bis in die frühen 1730er Jahre hinein – von einer schon von den Zeitgenossen als ganz und gar ungewöhnlich empfundenen Partnerschaft Londons und Versailles’ geprägt war,[25] von vielen Verträgen, die die beiden Mächte gemeinsam mit Dritten abschlossen. Schon allein diese Beobachtung könnte zu der Vermutung führen, dass die »liberty of Europe« nicht allen britischen Vertragspartnern gegenüber gleichmäßig und gleichförmig verwendet wurde – und dass sie niemals Verwendung fand, wenn Frankreich zu den Vertragspartnern zählte: das arrogante, überhebliche, die europäische Staatenwelt vermeintlich, konstruiert oder tatsächlich mit ihren universalmonarchischen Ansprüchen bedrohende Frankreich, das auch in seinem Innern das gerade Gegenteil von dem darstellte, was nach der Meinung aller Briten ihren Staat auszeichnete: Freiheit überall. »Freiheit«, so lässt sich demzufolge als Hypothese formulieren, wurde nur und ausschließlich als Formel gegen Frankreich verwendet, als Formel, um den Bourbonenstaat zu isolieren und moralisch in den Zustand des Aggressors schlechthin herabzudrücken.
9
Von daher ist es kein Zufall, dass die »liberty of Europe« genau zu dem Zeitpunkt wieder im Vertragsvölkerrecht auftauchte, als London wieder daran ging, Koalitionen gegen Frankreich zu schmieden: Im britisch-österreichisch-sardinischen Vertrag von 1743 vereinbaren die drei Partner »de s’unir ensemble plus étroitement et plus inséparablement« aus dem gemeinsamen Interesse heraus der »Conservation d’un juste Equilibre en Europe, d’ou depend la Liberté de l’Europe«.[26] Im britisch-polnisch-österreichisch-niederländischen Traktat von 1745 sichern sich die Partner die Aufrechterhaltung ihrer Verträge zu, »qui assûrent la liberté, la sûreté & la tranquillité publiques«.[27]
Das soll nicht heißen, dass in allen Verträgen der 1740er und 1750er Jahre die britische Diplomatie konstant die Formel von der »liberty of Europe« bemüht hätte; bei nachgeordneten Verträgen wie etwa dem vierseitigen Vertrag zur Vorbereitung der Kampagne von 1747 »begnügte« man sich mit der Formel vom »salut de l’Europe« und dem »bien de la cause commune«,[28] in der britisch-preußischen Präliminarkonvention vom August 1745 wird von der »tranquillité […] de l’Europe en général« gesprochen,[29] im britisch-russischen Subsidienvertrag vom Oktober 1747 von der »tranquillité […] en Europe«.[30] Aber, um die obige Aussage variierend noch einmal zu bekräftigen: In den wirklich wichtigen Verträgen mit britischer Beteiligung, die in irgendeiner Hinsicht einen antifranzösischen Affekt enthielten oder provozieren sollten, wurde »liberté/liberty« zur natürlichen Komplementärformel von »Europe«; in der Westminsterkonvention vom 11. Oktober 1757 zwischen Großbritannien und Preußen verständigten sich die beiden Monarchen vor dem Hintergrund der als »peu naturelle« charakterisierten französisch-kaiserlichen Allianz vom 1. Mai des Vorjahres darauf, »de faire les plus grands efforts pour maintenir les libertés de l’Europe«.[31]
Am Ende dieses Beitrags steht somit eine doppelte Generalaussage: Zunächst die, dass die Europa-Formel seit der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert die Grundsatzabschnitte der Friedensverträge dominierte und die aus der Christianitas abgeleiteten rhetorischen Figuren nahezu völlig verdrängt hatte beziehungsweise im Begriff stand, es zu tun. Die Staatenwelt hatte sich endgültig entschlossen, ihre Vertragsbeziehungen auf eine uneingeschränkt säkularisierte Basis zu stellen. Und die zweite Generalaussage ist nicht weniger aufregend: Großbritannien war das Land, das vor der Folie seines Selbstverständnisses von seiner eigenen politischen Kultur die Figur der »Freiheit Europas« in das Vertragsvölkerrecht einführte und sie immer in einem antifranzösischen Sinn verstand: Nur eine Macht sei von jeher darauf aus gewesen, die Freiheit Europas durch ihre universalmonarchischen Anwandlungen zu bedrohen und damit auch die Freiheit eines jeden Einzelstaates. In Konfliktsituationen, d.h. wenn es darum ging, antifranzösische Koalitionen zusammenzuzimmern, erwies sich »liberté/liberty« als die neue Zauberformel, die in ihrer politischen Schlagkraft weit über die »tranquilitas/tranquillité« hinausreichte. Man sage nicht, das Vertragsvölkerrecht in der Zeit der Aufklärung sei steril geworden und sei ohne politische Botschaften und Kampfbegriffe ausgekommen!
10
Black, Jeremy: Natural and Necessary Enemies: Anglo-French Relations in the Eighteenth Century, London 1986.
CTS siehe Parry, Clive.
Duchhardt, Heinz: Imperium und Regna im Zeitalter Ludwigs XIV., in: Historische Zeitschrift 232 (1981), S. 555–581.
Ders. u.a. (Hg.): Der Friede von Rijswijk 1697, Mainz 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte 47).
Ders.: The Missing Balance, in: Journal of the History of International Law 2 (2000), S. 67–72.
Ders.: Peace Treaties from Westphalia to the Revolutionary Era, in: Randall Lesaffer (Hg.), Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One, Cambridge 2004, S. 45–58.
Ders.: »Europa« als Begründungs- und Legitimationsformel in völkerrechtlichen Verträgen der Frühen Neuzeit, in: Wolfgang E. J. Weber u.a. (Hg.), Faszinierende Frühneuzeit. Reich, Frieden, Kultur und Kommunikation 1500–1800. Festschrift für Johannes Burkhardt zum 65. Geburtstag, Berlin 2008, S. 51–60.
Fisch, Jörg: Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses, Stuttgart 1979 (Sprache und Geschichte 3).
Heuvel, Gerd van den: »Freiheit (politisch)«, in: Werner Schneiders (Hg.), Lexikon der Aufklärung. Deutschland und Europa, München 1995, S. 134 f.
Kampmann, Christoph: Arbiter und Friedensstiftung. Die Auseinandersetzung um den politischen Schiedsrichter im Europa der Frühen Neuzeit, Paderborn u.a. 2001 (Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte N.F. 21).
Lesaffer, Randall (Hg.): Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One, Cambridge 2004.
Mühlen, Patrick von zur: Die Reichstheorien in der deutschen Historiographie des frühen 18. Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte GA 89 (1972), S. 118–146.
Parry, Clive (Hg.): The Consolidated Treaty Series, New York 1969–1981, Bd. 1–231.
Steiger, Heinhard: Der Westfälische Friede – Grundgesetz für Europa?, in: Heinz Duchhardt (Hg.), Der Westfälische Friede: Diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, München 1998 (Historische Zeitschrift, Beihefte 26), S. 33–80.
Stollberg-Rilinger, Barbara: Höfische Öffentlichkeit. Zur zeremoniellen Selbstdarstellung des brandenburgischen Hofes vor dem europäischen Publikum, in: Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte NF 7 (1997), S. 145–176.
11
[*] Heinz Duchhardt, Prof. Dr., Institut für Europäische Geschichte Mainz, Direktor der Abteilung für Universalgeschichte und Leiter des DFG-Projekts »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
[1] Fisch, Krieg und Frieden 1979.
[2] Ebd., S. 428.
[3] Ebd., S. 442.
[4] Zum Vertragsvölkerrecht generell vergleiche den aus einer Tilburger Tagung hervorgegangenen Sammelband Lesaffer, Peace Treaties 2004. Einschlägig für die hier zur Diskussion stehende Epoche Duchhardt, Peace Treaties 2004.
[5] Steiger, Westfälischer Friede 1998.
[6] Ebd., S. 73.
[7] Kampmann, Arbiter 2001.
[8] Vergleiche etwa als schlaglichtartigen Einblick Duchhardt, Imperium und Regna 1981; jetzt aber z.B. aus der Perspektive Kulturgeschichte des Politischen auch Stollberg-Rilinger, Höfische Öffentlichkeit 1997.
[9] Vergleiche von zur Mühlen, Reichstheorien 1972.
[10] Duchhardt, Europa als Legitimationsformel 2008.
[11] Erneuerung der Defensivallianz von Berlin 1692 VI 21, Zitat S. 2, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 17. März 2008), gedruckt in CTS 20, S. 45–58. Vergleiche das Vorwort zu dem Tagungsband Duchhardt, Rijswijk 1998, Vorwort S. VIII.
[12] Erneuerung der Defensivallianz von Berlin 1692 VI 21, Zitat S. 5, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 17. März 2008), gedruckt in CTS 20, S. 49.
[13] Defensivallianz von Berlin 1682 I 31, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 17. März 2008), gedruckt in CTS 16, S. 169–179.
[14] Friedensvertrag von Rijswijk 1697 IX 20, Frankreich, Generalstaaten, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 17. März 2008), gedruckt in CTS 21, S. 347–357.
[15] Friedensvertrag von Rijswijk 1697 IX 20 Frankreich, Großbritannien, gedruckt in CTS 21, S. 409–419, Zitat S. 411.
[16] Friedensvertrag von Rijswijk 1697 IX 20 (Frankreich, Spanien), gedruckt in CTS 21, S. 453–469, Zitate S. 455–456.
[17] Bündnisvertrag von Stockholm 1698 VII 9, Zitate S. 4 f., in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 17. März 2008), in franz. Übersetzung gedruckt in CTS 22, S. 179–184.
[18] Teilungsvertrag von Den Haag 1698 X 11, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 17. März 2008), mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 17. März 2007). Zitate S. 2, 13. Gedruckt in CTS 22, S. 197–206, Zitate S. 200 (Artikel 2), 204 (Artikel 13).
[19] Allianzvertrag von Den Haag 1701 IX 7, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 17. März 2008), gedruckt in CTS 24, S. 11–20. Nachdem bereits im Prooemium Frankreichs und Spaniens Haltung beklagt worden war, »ut se magis et magis inter se devinciant, ad opprimendam Europae libertatem […]«, heißt es in Artikel 2, dass den drei Vertragschließenden nichts mehr am Herzen liege »quam pax et tranquillitas generalis totius Europae«. Zitate: Online-Version S. 4 f.
[20] Die Belege können und sollen hier nicht alle ausgebreitet werden; vergleiche etwa noch aus dem Spanischen Erbfolgekrieg: Offensiv- und Defensivallianz von Lissabon 1703 V 16, S. 3, Erneuerung von Westminster 1703 VI 9, S. 3, Bündnis von Den Haag 1703 VII 19_29, S. 2, allesamt in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 18 März 2008), gedruckt in CTS 24, S. 375–407, 421–432, 439–450, die »Europa«-Belege S. 390, 423, 442; außerdem Vertrag von Turin 1704 VIII 4, CTS 25, S. 97–118, hier S. 103 (»Pax et tranquillitas generalis totius Europae«), Vertrag von Berlin 1704 XI 28, CTS 25, S. 215–225, hier S. 218; Präliminarartikel von Den Haag 1709 V 28, S. 4, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 18. März 2008), gedruckt in CTS 26, S. 317–329, hier S. 320 f.
[21] Duchhardt, Missing Balance 2000.
[22] Friedensvertrag von Utrecht 1713 VII 2_13, Artikel 2 S. 7, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 16. November 2007). Vergleiche die englische Übersetzung in CTS 28, S. 325–347, hier S. 325.
[23] Vergleiche den Artikel: van den Heuvel, Freiheit 1995, Zitat S. 134.
[24] Allianz von Den Haag 1701 XI 11, S. 4, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 18 März 2008), gedruckt in CTS 24, S. 55–62, Zitat S. 57.
[25] Vergleiche Black, Anglo-French Relations 1986.
[26] Bündnisvertrag von Worms 1743 IX 13, S. 3, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 18 März 2008), in ähnlicher Fassung gedruckt in CTS 37, S. 183–207, Zitate S. 187 (»union plus étroite & plus inséparable«, »conservation d’une juste balance en Europe, de laquelle dépendent ses Libertés«).
[27] Allianz von Warschau 1745 I 8, S. 2, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 18 März 2008), gedruckt in CTS 37, S. 307–318, Zitat S. 310.
[28] Konvention von Den Haag 1747 I 12, in: CTS 38, S. 49–66, Zitate S. 51.
[29] Präliminarkonvention von Hannover 1745 VIII 26, in: CTS 37, S. 411–416, Zitat S. 413.
[30] Subsidienvertrag von St. Petersburg 1747 VI 12_23, in: CTS 38, S. 145–149, Zitat S. 147; entsprechend in der Konvention von St. Petersburg 1747 XI 27, in: CTS 38, S. 177–186, hier S. 179.
[31] Konvention von Westminster 1757 I 11, in: CTS 40, S. 431–436, Zitat S. 433.
Heinz Duchhardt, »Europa« als Begründungsformel in den Friedensverträgen des 18. Jahrhunderts: von der »tranquillité« zur »liberté«, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 5–11.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008062408>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 6 oder 5–8.
Martin Peters *
Heiraten für den Frieden. Europäische Heiratsverträge als dynastische Friedensinstrumente der Vormoderne
Gliederung:
Text:
»Internationale Beziehungen« werden generiert durch politische und völkerrechtliche Institutionen und Instrumente. Schon im Mittelalter und besonders in der Frühen Neuzeit gehörten Diplomatie, Botschaftswesen, bilaterale und multilaterale Bündnissysteme sowie Kongresse zu den erprobten Kommunikationsmedien überregionaler und zwischenstaatlicher Sicherheitspolitik. Amnestieklausel, Einsatz von Kommissionen, Regularien beim Austausch von Gefangenen – allesamt dem vormodernen internationalen Recht entsprungen – haben ihre Gültigkeit bis heute erhalten. Seit dem 17. Jahrhundert lassen sich Utopien, Leitbilder und Richtlinien einer europäischen Friedensordnung, die auf einem System der kollektiven Sicherheit beruht, nachweisen.[1] Vormoderne Strategien der Friedenswahrung und -sicherung gewinnen heute durch die interdisziplinäre Forschung immer schärfere Konturen.[2]
Erstaunlicherweise geriet ein ganz besonderes Instrument der Friedenswahrung und -sicherung im Laufe der Zeit in den Hintergrund: die dynastische Ehe. Dies erstaunt umso mehr, weil doch gerade in der »Staatsheirat« interdynastische und zwischenstaatliche »Beziehungen« intensiv und buchstäblich formuliert und gelebt wurden. Für Mittelalter und Frühe Neuzeit kann zweifelsohne festgestellt werden, dass Dynastien für ein friedliches Europa heirateten.[3]
12
Europäische Heiratsverträge waren in der Vormoderne anerkannte Optionen dynastischer Regierungspolitik und konnten Imperien hervorbringen. Die Heirat zwischen der polnischen Königin Jadwiga und dem litauischen Fürsten Władysław II. Jagiełło am 2. Februar 1386 legte die Grundlage für die Dynastie der Jagiellonen und den Aufstieg der neu geschaffenen polnisch-litauischen Union zu einer führenden Macht im nordöstlichen Europa. Heiratsverträge bereiteten Allianzen vor oder untermauerten Bündnisse, begründeten Ansprüche auf Territorien oder ermöglichten Rangerhöhungen und Prestigegewinn. Als wichtiges Instrument des politischen Kalküls waren Eheschließungen zwischen Dynastien von gehörigem Interesse und unterstanden deshalb der Beobachtung der europäischen Mächte. Dynastische Ehen der Vormoderne waren machtpolitische Vereinbarungen, denen die subjektiven Wünsche der Ehepartner untergeordnet wurden. Als friedensstiftende Instrumente wurden sie ebenso gezielt eingesetzt, wie Waffenstillstände, Grenzrezesse, Präliminar-, Handels-, und Subsidienverträge oder auch Familienpakte. Um den Frieden zu sichern, mussten manche Ehen deshalb auch verhindert werden. Im Friedensvertrag von Barcelona (1493 I 19) verpflichten sich Ferdinand und Isabella, ihre Kinder nicht mit bestimmten Häusern zu verheiraten.[4] In Artikel 9 des Teilungsvertrages über das spanische Erbe (1700 III 3 und 1700 III 25) wurde die Gefahr, dass die Gebiete der spanischen Habsburger durch eine mögliche Ehe an Frankreich oder Österreich fallen könnten, expressis verbis ausgeschlossen. Es heißt:
»mais le tout à condition que le dit partage ne poura jamais estre reuny, ny demeurer en la personne de celuy qui sera Empereur ou Roy des Romains ou qui sera devenu l’ûn ou l’autre, soit par Succession testament, contrat de mariage, donation, eschange cession, appel, revolte, ou autre voye«.[5]
13
Heiratsverträge ermöglichten und verhinderten insofern europäische Sicherheitspolitik und grenzüberschreitende Kooperationen. Und sie waren besonders gut geeignet, um familiäre Nähe, Intimität, Vertrautheit und Freundschaft zwischen zwei fürstlichen Familien zu inszenieren. Dynastische Heiraten belebten in Mittelalter und Früher Neuzeit insofern die »internationalen beziehungsweise interdynastischen Beziehungen«. Welches Haus mit welcher Dynastie heiratete, war strategisch geplant und ein bedeutender Baustein der dynastischen Politik. Häufig wurden traditionell gute und friedliche Beziehungen zwischen zwei Häusern durch die Ehe erneuert, gesichert und öffentlich demonstriert.[6] Auf diese Weise entwickelte sich über die Generationen eine gewisse Präferenz für ein fürstliches Haus bei der Auswahl der Ehepartner. Als Beispiele können die häufiger abgeschlossenen Heiraten des Hauses Dänemark mit Hessen-Kassel oder Braunschweig dienen. Frankreich (Valois, Bourbonen) entwickelte eine Präferenz für Savoyen, Lothringen, England und Spanien. Louis, Herzog von Burgund und Marie-Abélaïde von Savoyen gingen 1696 IX 15 ihre Ehe in Turin ein. Ihre Vermählung wurde im Friedensvertrag vom 29. Juni 1696 (Artikel 3) fixiert. In der Präambel des Heiratsvertrages wird ausgeführt, dass diese Beziehung im Kontext der traditionellen Allianz zwischen den Häusern Frankreich und Savoyen steht:
»[…] mais aussy pour luy témoigner encore d[’]avantage la singuliere consideration, qu’elle fait de sa maison pour tant d’alliances reciproques si souvent contractées depuis plusieurs siecles entre la Maison de France, et celle de Savoye Sa Majesté seroit convenue par l’article 3e du d[i]t traité, que le mariage de Monseigneur le Duc de Bourgogne avec Madame la Princesse de Savoye fille ainee du dit tres haut, et tres puissant Prince Duc de Savoye et de Madame Anne d’Orleans Duchesse de Savoye se traittera incessamment pour s’effectuer de bonne foy lors qu’ils seront en age, et que le contract se fera presentement après quoy la d[it]e Dame Princesse sera remise entre les mains du Roy en execution du quel Article Sa M[ajes]té. auroit enyové à Turin […]«.[7]
14
Tradition und Gewohnheit legitimiert auch die Heirat zwischen dem Herzog von Lothringen und Elisabeth Charlotte von Orléans (1698 X 12). Im Heiratsvertrag wird die Jahrhunderte währende Allianz der Häuser Frankreich und Lothringen betont (»les alliances contractées depuis plusieurs siecles entre la maison de France et celle de Lorraine«).[8] Die Sicherung und Herstellung von Bündnissen strebte auch die spanisch-französische Heirat zwischen Louis, Prinz von Asturien, und Luise-Elisabeth von Orléans (1721 XI 16) an. Der Heiratsvertrag hebt bewusst die Freundschaft zwischen beiden Häusern hervor. Es heißt:
»[Louis XV.] porté du desir d’affermir et de rendre durable l’amitié parfaite et les liaisons étroites qui doivent toujours subsister entre les deux branches de sa Maison Royale, auroit arrêté et conclu le Traité de son mariage […].«[9]
Ein letztes Beispiel: In einer 1710 fixierten Vereinbarung, in der die Verlobung zwischen der späteren russischen Zarin Anna Iwanowa, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ehevertrages sieben Jahre alt war, und dem zweijährigen, bereits ein Jahr darauf verstorbenen Herzog Friedrich Wilhelm von Kurland festgeschrieben wurde, heißt es in der deutschsprachigen Ratifikation, dass das Eheverbündnis geschlossen werde:
»zu der allerhöchsten Ehren und zu etablierung gutten Verständnißes, und Vertrauens, zwischen beyderseits hohen Principalen, auch beförderung gedeylichen Aufnehmens, und Wohlfahrt zwischen beyderseits Reiche, und Länder«.[10]
15
Derzeit ist die Forschung bestrebt, dynastische Heiratsverträge verschiedenen Grundtypen zuzuordnen. Hermann Weber (1981), Peter Moraw (1997), Heinz Duchhardt (2001), Tobias Weller (2004) und jetzt auch Jan Paul Niederkorn (2007) unterscheiden sieben Kategorien von Eheverträgen, nämlich 1. Zuwachs der Hausmacht (Erwerbsheirat); 2. Herstellung von externen Bündnissen; 3. Herstellung von internen (Partei-)Bündnissen; 4. Besiegelung von Friedensschlüssen (Rekonziliationsheiraten); 5. Signal eines politischen Paradigmenwechsels; 6. Situationsbedingte Interessen[11] und 7. Soziale Mobilität und Prestige.[12] Grundsätzlich gilt, dass die Grenzen der Heiratsmotive fließend sein konnten. Zudem waren die Interessen der Vertragspartner häufig unterschiedliche. Für die Großmächte waren Heiraten eine Möglichkeit, kleinere Staaten an sich zu binden. Für kleinere Dynastien und Staaten hingegen, z.B. Savoyen und Toskana, waren sie eine ernstzunehmende Option, auf das Spiel der europäischen Mächte durch ein überregional vielfältiges Netzwerk Einfluss zu üben. Nicht selten kam es zu win-win Situationen, wie sich besonders gut anhand der Medici nachweisen lässt. Der Friedensvertrag von Florenz zwischen Heinrich II. von Frankreich und Cosimo von Medici (1552 VIII 4) mit seiner anti-kaiserlichen Stoßrichtung ist eine Folge der Ehe zwischen Katharina von Medici und ihrem fünf Jahre zuvor zum französischen König gekrönten Gatten.
Das wohl bekannteste Beispiel eines frühneuzeitlichen Friedensvertrages, der eine dynastische Ehe regelt und verkündet, ist der Pyrenäenfrieden (1659 XI 7), in dem die Heirat zwischen Ludwig XIV. und der spanischen Infantin María Teresa ausgehandelt wird. Dass die Heirat expressis verbis zur Friedensicherung diente, geht aus Artikel 33 des Pyrenäenfriedens hervor. Der Heiratsvertrag ist nicht nur Teil des Friedensvertrags und besitzt somit völkerrechtliche Relevanz, sondern soll dazu beitragen, dass der Friede, die Union, die Konföderation und die gute Verständigung eng, andauernd und unauflösbar wird. Friedens- und Heiratsvertrag sollen gleich sein an Kraft und Wert. Es heißt dort [Art. 33]:
»Et afin que cette paix et union, confédération et bonne correspondance soit comme on le désire d’autant plus ferme, durable et indissoluble lesdits deux principaux Ministres Cardinal Duc et Marquis Comte Duc en vertu du pouvoir spécial qu’ilz ont eu à cet effect des deux Seigneurs Roys, ont accordé et arresté à leur nom le mariage du Roy très Chrestien avec la Sérénissime Infante Dame Marie Térèse fille aisnée du Roy Catholique et ce mesme jour date des présentes ont fait et signé un traité particulier auquel on se remet touchant les conditions réciproques dudit mariage et le temps de sa célébration. Lequel traité à part et capitulation de mariage sont de la mesme force et vigueur que le présent traité comme en estant la partie principale et la plus digne aussy bien que le plus grand et le plus précieux gage de la seureté de sa durée«.[13]
16
Welche weitreichende Bedeutung Heiratsverträge für die christliche Welt erlangen konnten, das zeigt die Heirat zwischen Ludwig XIV. und María Teresa von Spanien. Der Mainzer Frühneuzeithistoriker Hermann Weber hat überzeugend herausgearbeitet, dass hier nicht nur die Wohlfahrt zweier Reiche geregelt, sondern geradezu die Sicherung »de la paix publique de la Chrestienté« angestrebt wurde.[14] Es heißt im Heiratsvertrag zwischen Ludwig XIV. und María Teresa:
»Que d’autant que leurs M[ajes]tez Tres Chrestienne et Catholiq[ue] sont venus et viennent a faire le Mariage afin de tant plus perpetuer et assurer par ce noeud et lien la paix publique de la Chrestienté Et entre leurs M[ajes]tez l’amour et La fraternité que chacun Espere Entr’elles et en contemplation aussy des Justes et Legitimes causes qui monstrent et persuadent l’Egalité et convenance dud[it] mariage, par le moyen du quel Et moyennant la faveur et grace de Dieu chacun en peut Esperer de tres heureux succez au grand bien et augmentation de la foy et Religion Chrestienne, au bien et benefice commun des Royaumes, sujetz et Vassaux des deux couronnes comme aussy pour ce qui touche et importe au bien de la Chose publique Et conservation desd[ites] Couronnes qu’éstant si grandes et puissantes elles ne puissent etre reunies en une seule et que des a present on previenne les occasions d’une pareille Jonction.«[15]
Öffentlicher Frieden und öffentliche Ruhe sind Schlüsselbegriffe frühneuzeitlicher Friedensverträge. Auch der Heiratsvertrag von Fontainebleau zwischen Spanien und Frankreich (1679 VIII 30) zielt auf die »tranquilité publique«.[16] Der Heiratsvertrag von München (1680 I 27) vermeidet Konflikte, indem die Gewohnheiten und Rechte beider Länder anerkannt und gleichgestellt werden. Es heißt dort, dass der Heiratsvertrag auf der Grundlage aller »formes et solennitez prescrites par les coustumis et usages du pays« geschlossen wurde.[17]
Seit Anfang des 18. Jahrhunderts dringt der Begriff »Europa« in die Heiratsverträge ein. In der Präambel des Heiratsvertrages zwischen Franz von Este und Charlotte von Orléans (1720 II 11) wird das fürstliche Haus unter die »principales Maisons de l’Europe« gezählt,[18] womit eine Art soziale Ordnung Europas suggeriert wird. Europa bildet hier eine Identifikations- und Bezugsgröße, eine Art Dach, unter dem sich verschiedene Häuser vereinen. Der Bezug zu Europa wird auch im Heiratsvertrag zwischen Ludwig XV. und Maria Leszczynska (1725 VIII 9) deutlich, in dem es um »le repos de son Royaume, et celuy de toute l’Europe« geht.[19] Heinz Duchhardt legt dar, dass die Metapher von der »Ruhe Europas« (repos; Tranquillität) seit etwa 1690 im europäischen Völkerrecht entwickelt wird, um die eigene Selbstlosigkeit und das allgemeine Interesse am Wohl der europäischen Staatenfamilie zu inszenieren. Seit 1713 weist Duchhardt eine neue, moderne Formel im Völkerrecht nach: die »liberty of Europe«.[20] Dieser Paradigmenwechsel lässt sich in Heiratsverträgen jedoch nicht immer belegen. Der oben erwähnte Heiratsvertrag aus dem Jahre 1725 zwischen Ludwig XV. und Maria Leszczynska operiert erstaunlicherweise noch immer mit der »Ruhe« und nicht mit der »Freiheit« Europas. Möglicherweise eignen sich Heiratsverträge nicht als Beleg, um die Ausformung der völkerrechtlichen Figur der »Freiheit« nachzuzeichnen. Auch aus diesem Grund erscheint eine umfassende Auswertung der vormodernen Friedens- und Heiratsverträge dringend erforderlich.
17
Die Analyse von dynastischen Heiratsverträgen zeigt, dass einige Häuser Ehepartner und -partnerinnen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Herkunftsländer an sich banden. Habsburg ging Ehen mit folgenden Häusern ein: Portugal, Spanien, Dänemark, Frankreich, Lothringen, Burgund, Polen, Ungarn, Böhmen, Tirol, mit einigen deutschen Reichsständen (Sachsen, Bayern, Pfalz-Neuburg, Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel) sowie einigen italienischen Häusern und Staaten (Mailand/Sforza, Savoyen, Este, Gonzaga, Toskana/Medici, Parma, Sizilien). Dabei ist festzustellen, dass sich Habsburg bis 1789 niemals mit Schweden, England, Niederlande (Oranien) und Brandenburg-Preussen verband. Auch mit Russland und dem Osmanischen Reich ging man keine Heiraten ein, obwohl es intensive Friedens- und Handelsabkommen zwischen Habsburg und Russland und – man denke an Passarowitz (1718 VII 21) und Belgrad (1739 IX 18) – auch mit dem Osmanischen Reich gegeben hat.
Die Romanovs sind auf dem europäischen Heiratsmarkt zwar nicht isoliert, verbanden sich aber vor 1800 nur mit den deutschen Fürstenhäusern Mecklenburg, Braunschweig-Wolfenbüttel, Hessen-Darmstadt und Württemberg sowie mit dem schwedischen Haus Holstein-Gottorf.[21]
Die aufeinander folgenden schwedischen Häuser Wasa, Pfalz-Zweibrücken, Hessen-Kassel, Holstein-Gottorf konzentrierten sich auf deutsche Fürstenhäuser, wie Sachsen(-Lauenburg), Baden(-Durlach), Pfalz, Holstein-Gottorp, Brandenburg, Hessen-Kassel, Pfalz-Sulzbach, Hessen-Darmstadt und Anhalt-Zerbst; doch schloss Schweden Ehen auch mit Polen, Österreich, Dänemark und Russland.
Ein weit verzweigtes europäisches Verwandtschaftsnetzwerk errichteten neben Habsburg auch England, Frankreich, Polen,[22] Sayoyen sowie die Medici.[23] Die Ehepartner der englischen Herrscher stammten aus Schottland, Dänemark, Portugal, Frankreich (Orléans), Burgund, den Niederlanden (Oranien), Polen und dem Deutschen Reich (der Pfalz, Hannover, Braunschweig-Lüneburg-Celle, Brandenburg-Ansbach, Sachsen-Gotha, Hessen-Kassel, Mecklenburg-Strelitz). Englische Herrscherfamilien verbanden sich nicht mit Spanien, Habsburg, Schweden, Russland, Savoyen und italienischen Häusern. Es ist auffällig, dass sich die Heiratspolitik der englischen Fürsten und Fürstinnen seit Georg I. mit der Thronbesteigung des Hauses Hannover auf die deutschen Adelsfamilien beschränkte.
Französische Fürsten und Fürstinnen (Valois, Bourbonen, Orléans) heirateten Ehepartner aus England, Spanien, Österreich, Polen, Lothringen, Bretagne, Navarra sowie italienscher (Savoyen, Este, Parma, Toskana/Medici) und deutscher Dynastien (Sachsen, Bayern, Pfalz, Baden). Ehen mit Portugal, Schweden, Dänemark und den Niederlanden (Oranien) wurden jedoch nicht abgeschlossen.
Vielfältige überregionale eheliche Verbindungen ging auch Polen ein, und zwar mit Österreich, Moskau, Spanien, Schweden, den deutschen Reichsständen (Sachsen, Brandenburg, Bayern, Pfalz) sowie den italienischen Staaten und Dynastien (Mailand/Sforza, Gonzaga). Doch heirateten polnische Fürsten und Fürstinnen niemals Mitglieder dänischer, portugiesischer, englischer und niederländischer (Oranien) Häuser.
Savoyen ging Heiraten mit Spanien, Frankreich, Lothringen, Burgund, deutschen (Bayern, Baden, Sachsen-Hildburghausen, Hessen) sowie italienischen Dynastien (Este/Modena, Gonzaga) ein. Die Medici vermählten sich mit Frankreich, Österreich, Lothringen, deutschen Reichsständen (Sachsen, Bayern, Pfalz) sowie mit italienischen Staaten (Parma, Mantua).
Unter den deutschen Fürstenhäusern gelang es vor allem den Häusern Bayern, Sachsen, Braunschweig und Pfalz, sich mit außerdeutschen Königs- und Fürstenhäusern zu liieren. Die hohe Präsenz der deutschen Dynastien auf dem europäischen Heiratsmarkt ist dabei signifikant. Deutsche Fürsten bestiegen nicht nur den englischen Thron, sondern auch den dänischen und schwedischen. Johannes Burkhardt meint, dass die deutschen Reichsstände gerade durch ihre internationalen dynastischen Beziehungen aktiv auf die europäische Friedens- und Sicherheitspolitik eingewirkt haben.[24]
18
Zwei »Staaten« waren vom europäischen Heiratssystem ausgeschlossen: Die Eidgenossen waren nicht auf dem europäischen Heiratsmarkt präsent, weil ihnen dieses dynastische Instrument aus staatsrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung stand. Auch Ehen europäischer Häuser mit dem Osmanischen Reich wurden nicht geschlossen. Welchen Einfluss religiöse und kulturelle Barrieren auf dieses Phänomen hatten, müsste näher untersucht werden. Immerhin ist eine armenisch-byzantinische (venezianische) Ehe aus dem Jahr 1458 zwischen dem Turkmenen Uzun Hasan und Theodora Megale Komnena – einer unehelichen Tochter des Kaisers von Trapezunt Johannes IV. – überliefert.[25]
Trotz der vielen Bemühungen, durch dynastische Ehen Sicherheit und Nachhaltigkeit von Friedensschlüssen zu erreichen, war dieses politisch und völkerrechtlich gezielt eingesetzte Instrument ein sehr fragiles, wie die vielen Spannungen, Konflikte und Kriege der Frühen Neuzeit belegen.
19
Burkhardt, Johannes: Sprachen des Friedens und was sie verraten. Neue Fragen und Einsichten zu Karlowitz, Baden und »Neustadt«, in: Stefan Ehrenpreis u.a. (Hg.), Wege der Neuzeit. Festschrift für Heinz Schilling zum 65. Geburtstag, Berlin 2007 (Historische Forschungen 85), S. 503–519.
Duchhardt, Heinz (Hg.): Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und Früher Neuzeit, Köln u.a. 1991.
Ders.: Die dynastische Heirat als politisches Signal, in: Mirosława Czarnecka u.a. (Hg.), Hochzeit als ritus und casus. Zu interkulturellen und multimedialen Präsentationsformen im Barock, Warschau 2001 (Orbis linguarum, Beihefte), S. 67–70.
Ders.: »Europa« als Begründungs- und Legitimationsformel in völkerrechtlichen Verträgen der Frühen Neuzeit, in: Wolfgang E. J. Weber u.a. (Hg.), Faszinierende Frühneuzeit. Reich, Frieden, Kultur und Kommunikation 1500–1800. Festschrift für Johannes Burkhardt zum 65. Geburtstag, Berlin 2008, S. 51–60.
Lesaffer, Randall: The three peace treaties of 1492–1493, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Kalkül – Transfer – Symbol. Europäische Friedensverträge der Vormoderne, Mainz 2006–11–02 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Beihefte online 1), Abschnitt 41–52.
URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/01-2006.html (eingesehen am 4. August 2007).
Malettke, Klaus: Richelieus Außenpolitik und sein Projekt kollektiver Sicherheit, in: Peter Krüger (Hg.), Kontinuität und Wandel in der Staatenordnung der Neuzeit. Beiträge zur Geschichte des internationalen Systems, Marburg 1991 (Marburger Studien zur Neueren Geschichte 1), S. 47–68.
Moraw, Peter: Das Heiratsverhalten im hessischen Landgrafenhaus ca. 1300 bis ca. 1500 – auch vergleichend betrachtet, in: Walter Heinemeyer (Hg.), Hundert Jahre Historische Kommission für Hessen 1897–1997, Marburg 1997 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 61), Teil 1, S. 115–140.
Niederkorn, Jan Paul: Die dynastische Politik der Habsburger im 16. und frühen 17. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 8 (2007), S. 29–50.
Roll, Christine: Dynastie und dynastische Politik im Zarenreich. Befunde und Überlegungen zur Heiratspolitik der Romanovs im 17. und 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 8 (2007), S. 77–102.
Schnettger, Matthias: Geschichte einer Dekadenz? Die italienischen Dynastien im Europa der Frühen Neuzeit, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 8 (2007), S. 50–75.
Spieß, Karl-Heinz: Europa heiratet. Kommunikation und Kulturtransfer im Kontext europäischer Königsheiraten des Spätmittelalters, in: Rainer C. Schwinges u.a. (Hg.), Europa im Späten Mittelalter, München 2006 (Historische Zeitschrift, Beihefte 40), S. 435–464.
Tresp, Uwe: Eine »famose und grenzenlos mächtige Generation«. Dynastie und Heiratspolitik der Jagiellonen im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 8 (2007), S. 3–28.
Weber, Hermann: Die Bedeutung der Dynastien für die europäischen Geschichte in der Frühen Neuzeit, in: Das Haus Wittelsbach und die europäischen Dynastien, München 1981 (Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 44/1), S. 5–32.
Weller, Tobias: Die Heiratspolitik des deutschen Hochadels im 12. Jahrhundert, Köln 2004 (Rheinisches Archiv 149).
20
[*] Martin Peters, Dr., Institut für Europäische Geschichte Mainz, Koordinator und Sprecher des DFG-Projekts »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
[1] Malettke, Richelieus Außenpolitik 1991.
[2] Duchhardt, Zwischenstaatliche Friedenswahrung 1991.
[3] Besonders in der Mediävistik wurden bislang dynastische Heiraten untersucht, vgl.: Spieß, Europa heiratet 2006.
[4] Lesaffer, Three peace treaties 2006, hier: Abschnitt 49. Im Vertrag von Sablé (1488 VIII 20) verpflichtet sich Franz II. von Bretagne, seine Töchter nicht ohne Einwilligung des französischen Königs zu vermählen.
[5] Neuer Teilungsvertrag über das spanische Erbe von London und Den Haag 1700 III 3 und 1700 III 25, Zitat S. 15, Transkription von Andrea Weindl, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[6] Vgl. Weller, Heiratspolitik 2004, S. 798 und 803.
[7] Heiratskonvention von Turin 1696 IX 15, Zitat S. 2, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. September 2007).
[8] Heiratsvertrag von Fontainebleau 1698 X 12, Zitat S. 2, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. September 2007).
[9] Heiratsvertrag von Paris 1721 XI 16, Zitat S. 1, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. September 2007).
[10] Heiratsvertrag von St. Petersburg 1710 VI 10/21, S. 3, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 24. November 2006).
[11] Zur Typologie von Heiratsverträgen und verschiedenen Sonderformen: Weber, Bedeutung der Dynastien 1981. Duchhardt, Dynastische Heirat 2001; Weller, Heiratspolitik 2004, S. 798 ff. Jetzt neu: Niederkorn, Dynastische Politik 2007.
[12] Moraw, Heiratsverhalten 1997.
[13] Vertrag von Île de Faisans (Pyrenäenfrieden) 1659 XI 7: Archiv des französischen Außenministeriums, Paris: Traités. Espagne 16590001: Traité de paix, dit ›traité des Pyrénées‹ (Ile des Faisans), Zitat S. 37 f., in: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 16. November 2007).
[14] Weber, Bedeutung der Dynastien 1981.
[15] Heiratsvertrag von Île des Faisans 1659 XI 7, Zitat S. 8 f., in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[16] Heiratsvertrag von Fontainebleau 1679 VIII 30, Zitat S. 1, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[17] Heiratsvertrag von München 1680 I 27, Zitat S.15, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[18] Heiratsvertrag von Paris 1720 II 11, Zitat S. 2, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[19] Heiratsvertrag von Versailles 1725 VIII 9: Archiv des französischen Außenministeriums, Paris: Traités. Pologne 17250004. Contrat de mariage entre Louis XV, roi de France, et Marie Leszczynska, princesse de Pologne. Versailles, 1725. 9 août, Zitat S. 1, in: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 16. November 2007).
[20] Vgl. den Beitrag von Heinz Duchhardt in diesem online-Sammelband sowie Duchhardt, Europa als Legitimationsformel 2008.
[21] Roll, Dynastie und dynastische Politik 2007.
[22] Tresp, Dynastie und Heiratspolitik der Jagiellonen 2007.
[23] Zur Heiratspolitik italienischer Dynastien: Schnettger, Geschichte einer Dekadenz 2007.
[24] Burkhardt, Sprachen des Friedens 2007, hier S. 518.
[25] Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Peter Seelmann, M.A. (Mainz).
Martin Peters, Heiraten für den Frieden. Europäische Heiratsverträge als dynastische Friedensinstrumente der Vormoderne, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 12–20.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008062408>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 13 oder 12–15.
Hildo van Engen *
Der Frieden von Ath (1357): Ein Schiedsspruch zwischen Dichtung und Wahrheit
Gliederung:
2. Der Brabanter Erbfolgekrieg
5. Eine mittelalterliche Chronik
Anhang: Der Frieden von Ath, Urkunde und Chronik
Text:
Am 4. Juni 1357 verkündete Herzog Wilhelm von Bayern, Graf von Holland und Hennegau, im südwestlich von Brüssel liegenden Städtchen Ath einen Schiedsspruch zur Schlichtung des so genannten Brabanter Erbfolgekrieges. Dieser Krieg, der die Nachfolge der herzoglichen Dynastie betraf, hatte etwa ein Jahr zuvor begonnen und wurde zwischen zwei Schwiegersöhnen des verstorbenen Herzogs Johann III. ausgetragen, nämlich Wenzel von Luxemburg, der zum Nachfolger bestimmt worden war, und Ludwig von Male, Graf von Flandern. Der Friedensvertrag von Ath ist in erster Linie von Bedeutung wegen der direkten politischen Konsequenzen für das Herzogtum Brabant, welche Jahrhunderte lang spürbar blieben. Der Vertrag ist überdies aber auch interessant aufgrund seiner ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte. Der holländische Graf scheute sich nicht, seine Position als Vermittler zu benutzen, um seine eigenen Interessen sicherzustellen und mit einer der beteiligten Parteien heimlich Absprachen über den Inhalt der Friedensverhandlungen zu treffen. Opfer dieses dreisten Vorgehens wurde das Brabanter Herzogspaar. Der Frieden von Ath war für Brabant dermaßen herabwürdigend, dass darüber noch lange danach mit Empörung – wenn auch nicht immer wahrheitsgemäß – berichtet wurde. Im 15. Jahrhundert wurde der Vertragstext sogar von einem Dichter übersetzt und in Versform gebracht. Das ist der dritte Grund, dem Vertrag von Ath in dieser Abhandlung Aufmerksamkeit zu schenken.
21
2. Der Brabanter Erbfolgekrieg
Herzog Johann III. von Brabant starb am 5. Dezember 1355, ohne einen männlichen Nachfolger zu hinterlassen. Da der Herzog drei Töchter hatte, die alle mit benachbarten Landesherren verheiratet waren, war schon von vornherein klar, dass die Nachfolge nicht problemlos vonstatten gehen würde. Schon 1354 war ein Vergleich bezüglich der herzoglichen Erbschaft von Kaiser Karl IV. genehmigt worden: die älteste Tochter, Johanna, würde Herzogin, während ihre zwei Schwestern Margaretha und Maria finanziell entschädigt werden sollten. Unter dem Druck des flämischen Grafen Ludwig von Male, dem Gatten Margarethas, musste diese Regelung aber revidiert werden, weil Ludwig sich bereits 1347 im Geheimen ausbedungen hatte, dass Margaretha nach dem Tod des Herzogs Johann III. von Brabant in den Besitz der Herrschaft Mechelen und der Stadt Antwerpen gelangen sollte. Da dies die Einheit des Herzogtums erheblich gefährden würde, stieß diese Vereinbarung auf großen Widerstand seitens der Brabanter Städte und des Adels, die sich noch vor dem Tod Johanns III. zusammenschlossen und erklärten, unter einem einzigen Fürsten in einem ungeteilten Herzogtum bleiben zu wollen. So geschah es, dass Johanns ältester Tochter Johanna Anfang 1356 als der neuen Herzogin von Brabant gehuldigt wurde.
Der herzogliche Status von Wenzel und Johanna wurde aber schon bald von Ludwig von Male und seiner Gattin Margaretha angefochten, die es auf den Besitz der in wirtschaftlicher Hinsicht wichtigen Städte Mechelen und Antwerpen abgesehen hatten. Daraus entwickelte sich in den Jahren 1356 und 1357 ein vehementer Streit. In diesem Brabanter Erbfolgekrieg gelang es dem flämischen Grafen im August 1356 innerhalb weniger Tage, einen großen Teil des Herzogtums für sich zu gewinnen, einschließlich wichtiger Städte wie Brüssel, Löwen, Antwerpen und Mechelen, die bereit waren, den flämischen Grafen als Herzog von Brabant anzuerkennen. Das eigentliche Herzogspaar, Wenzel und Johanna, erhielt nur noch im nördlichen Teil seines Herzogtums Unterstützung in Orten wie Grave, Herzogenbusch und Heusden, direkt südlich des Flusses Maas.[1]
22
Die Situation, in der sich Wenzel und Johanna befanden, war so ausweglos, dass sie sich gezwungen sahen, einen Mittelsmann um Hilfe anzurufen, der einen Friedensvertrag aushandeln sollte. Zu diesem Zweck wandten sie sich an Herzog Wilhelm I. von Bayern – als holländischer Graf genannt Wilhelm V. –, der sich bis zu diesem Moment aus dem Konflikt zwischen Brabant und Flandern herausgehalten hatte. Wilhelm erklärte sich zur Vermittlung bereit, machte dabei aber zur Bedingung, dass ihm die Herrschaft über das Land Heusden zugeteilt würde. In einer am 29. März 1357 zu Bergen op Zoom ausgestellten Urkunde erklärten Wenzel und Johanna, dass sie Wilhelm ›das Haus und Land von Heusden‹ (»den huyse ende lande van Husden met allen sinen toebehoirten«) übergeben würden, mit Ausnahme des so genannten Glockenschlags (»clocslach«), also des Rechts, die wehrhaften Männer aus dem Gebiet mittels Glockengeläuts zur Landesverteidigung aufzurufen. Dieses Recht blieb also in Brabanter Hand. Weiter bevollmächtigte das Brabanter Herzogspaar Wilhelm, eine Versöhnung zwischen ihnen selbst und dem Grafen von Flandern anzustreben (»eene zoene te dedinghen«). Sollte der holländische Graf damit Erfolg haben, könne er die Herrschaft von Heusden behalten; wenn es ihm aber nicht gelang, einen Friedensvertrag zustande zu bringen, sollte Wilhelm für Wenzel und Johanna Partei ergreifen und mit ihnen gegen Flandern in den Kampf ziehen. Sobald er in diesem Fall Holland verließe »om Brabant te hulpen te commen ende Vlaendren te schaden«, sollten ihm tausend Ritter und Soldaten zur Verfügung gestellt werden.[2] Mit dem Erwerb des Landes Heusden sollte für Wilhelm V. ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen.
23
Ursprünglich war das Land Heusden eine kleine, jedoch selbstständige Landesherrschaft, mit welcher der jeweilige Graf von Kleve die Herren von Heusden belehnte. Das Gebiet um das gleichnamige Städtchen hatte in verschiedener Hinsicht eine strategische Bedeutung: Aus der Perspektive sowohl der Grafschaft Holland als auch des Herzogtums Brabant war das Land Heusden ein Grenzbereich, und wegen der Lage entlang der Maas war es auch in wasserwirtschaftlicher und ökonomischer Hinsicht ein wichtiges Territorium. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Herzog von Brabant und der Graf von Holland beide sehr bemüht waren, ihren Einfluss in diesem Gebiet zu verstärken. Zunächst profitierte der jeweilige Herr von Heusden von diesen Verhältnissen, indem er beide mächtigen Nachbarn, wenn möglich, gegeneinander auszuspielen versuchte. Das änderte sich aber am Ende des 13. Jahrhunderts: Nachdem Johann III. von Heusden eine misslungene Revolte gegen den holländischen Graf Floris V. unterstützt hatte, wurde er gezwungen, die Stadt Heusden dem Grafen zu übertragen. Auf diese Weise kam Heusden in holländischen Einflussbereich, wobei über die althergebrachten Ansprüche des Grafen von Kleve als des höchsten Lehnsherrn hinweggegangen wurde. Der holländische Machteinfluss war aber nur von kurzer Dauer, da Johann von Heusden wenige Jahre später, 1296, in die Ermordung des Grafen Floris V. involviert war, so dass die Grafschaften Holland und Seeland für ihn fortan verbotenes Gebiet waren. Es ist nicht verwunderlich, dass der Herr von Heusden sich unter diesen Umständen dem Herzog von Brabant annäherte; während der ersten Jahre des 14. Jahrhunderts wurden die Beziehungen zwischen Heusden und dem Herzog immer enger.[3]
24
Trotzdem gelang es dem holländischen Graf Wilhelm III. – in einer chaotischen Zeit nach dem Tod Johanns IV. von Heusden – Stadt und Land von Heusden 1318 zu kaufen. Dieser Kauf war aber umstritten und führte im Sommer desselben Jahres zu einem bewaffneten Kampf um Heusden, der sich mehr oder weniger zu einem Krieg zwischen Holland und Brabant auswuchs, bis er schließlich durch einen Schiedsspruch beendet wurde. Die Anrechte des Herzogs von Brabant, unterstützt vom Grafen von Kleve, wurden dabei als legitimer beurteilt als die des Grafen von Holland, so dass Heusden in den Einflussbereich des Herzogtums zurückkehrte. In den folgenden Jahrzehnten baute der Herzog seinen Machteinfluss immer stärker aus, bis die vollständige Annexion und Eingliederung Heusdens in das Herzogtum Brabant bevorzustehen schien.[4]
Wenn Stadt und Land von Heusden dann doch – plötzlich und völlig unerwartet – von Brabant an Holland übergingen, so lag dies nur in der aussichtslosen Lage von Wenzel und Johanna begründet, die der Graf von Holland im Frühjahr des Jahres 1357 unbarmherzig ausnutzen konnte. Doch hatte er für diese geschickte Abrundung seines Territoriums noch einen Friedensvertrag zu realisieren.
25
Nach der Übergabe von Heusden am 29. März 1357 wurden die Beziehungen zwischen Brabant und Holland weiter vertieft. Am 12. April versprachen Wenzel und Johanna und Graf Wilhelm V. einander eingehende militärische Unterstützung.[5] Inzwischen hatte Wilhelm sich wahrscheinlich schon an den Grafen von Flandern gewandt mit der Frage, ob dieser bereit sei, einen Frieden mit Brabant zu schließen. Am 4. Mai gab Ludwig von Male Wilhelm die Erlaubnis, zwischen Flandern und Brabant eine Versöhnung (»eenre zoenen ende pais«) zustande zu bringen, der er sich zu unterwerfen versprach.[6]
Wie sich die Unterhandlungen zwischen Wilhelm und Ludwig genau entwickelten, ist unbekannt; es ist aber zumindest klar, dass der holländische Graf in diesen Tagen eine radikale Kehrtwende gemacht haben muss, und vom Brabanter ins flandrische Lager überlief. Dies erweist sich aus dem Versprechen Wilhelms an Ludwig am 5. Mai 1357, dass er in seinem Schiedsspruch acht Bedingungen zu Ludwigs Gunsten aufnehmen würde: Wilhelm versprach, Ludwig die Herrschaft über Mechelen zuzuweisen, und für dessen Gattin Margaretha die Erträge der Stadt Antwerpen sowie eine weitere jährliche Summe auszuhandeln. Weiter sagte Wilhelm zu, dass diejenigen Städte und Adligen, die Ludwig als Herrscher gehuldigt hatten, verpflichtet würden, ihm jährlich jeweils sechs Wochen lang militärische Unterstützung zu leisten. Ludwig wurde außerdem eine Entschädigung in Aussicht gestellt, und jeder sollte die Güter, die er vor Ausbruch des Krieges besaß, zurückerhalten. Wenzel und Johanna sollte untersagt werden, aus dem Nachlass des Herzogs Johann III. etwas zu verkaufen, und Ludwig das lebenslange Recht bekommen, den Titel ›Herzog von Brabant‹ zu führen, da die Brabanter Stände ihn als ihren Herrn anerkannt hatten. Zum Schluss versprach Wilhelm, dass er sich bemühen wolle, etwaige Differenzen bezüglich der Erbansprüche Margarethas zu beseitigen.[7] Wilhelms Bereitschaft, den Wünschen des flämischen Grafen in diesem Ausmaß entgegenzukommen, hängt vermutlich damit zusammen, dass die Übergabe Heusdens vom Gelingen der Friedensverhandlungen abhängig war.
26
Die versprochenen Bedingungen waren für das flämische Grafenpaar in jeder Hinsicht vorteilhaft, für Wenzel und Johanna jedoch ganz und gar nicht, und darum sollten sie auch nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Ohne Zweifel ist dies der Grund für die Existenz einer zweiten, am selben 5. Mai angefertigten Urkunde, in der Wilhelm Ludwig nur versprach, innerhalb von einem Monat seinen Schiedsspruch in dem Konflikt mit Brabant zu verkünden und bis zum Äußersten zu gehen, um den Frieden zu realisieren, auch wenn die Brabanter Partei ihre Bereitschaft dazu unverhofft aufgeben sollte.[8]
Der Adel und die Städte des Hennegaus, Hollands und Seelands, von deren Mitwirkung die Politik Wilhelms vielfach abhängig war, waren über die geheimen Verabredungen zwischen Holland und Flandern höchstwahrscheinlich nicht informiert worden. Mit ihrem Einverständnis versprach Wilhelm am 15. Mai nochmals, dass er seinen Schiedsspruch spätestens Anfang Juni verkünden würde, und sagte Ludwig militärische Unterstützung zu, falls es ihm bei der Durchführung des Vertrages an etwas mangeln würde.[9]
Kurz darauf konnte der holländische Graf einen Waffenstillstand (»een bestant van den gescille«) erreichen. Am 18. Mai willigte Ludwig darin ein, nachdem Wenzel und Johanna schon vorher ihr Einverständnis erklärt hatten.[10] Schließlich wurde Wilhelm vom Brabanter Herzogspaar am 1. Juni wiederum bevollmächtigt, einen Frieden zu verwirklichen, dem sie zu gehorchen versprachen. Ihre Urkunde wurde von einigen prominenten Adeligen und Städten ebenfalls besiegelt.[11]
Der Frieden trat am 4. Juni 1357 ein. Anders als alle weiter oben besprochenen Texte war die Urkunde des Grafen Wilhelm nicht auf Niederländisch abgefasst, sondern auf Französisch, der Sprache der internationalen Diplomatie. Zuerst wird erwähnt, dass der Graf seinen Schiedsspruch wegen des großen Unheils infolge der Feindseligkeiten zwischen Flandern und Brabant verkündete. Diese würden noch länger andauern, wenn man nicht einen Versuch wagte, Frieden zu erreichen (»bien de pais, concorde et loyal amour«). Zwischen den beiden Parteien solle es Frieden geben, da Johanna und Margaretha Schwestern und beide Länder auch in anderer Hinsicht eng miteinander verbunden seien. Der eigentliche Schiedsspruch des Grafen enthielt die folgenden Bestimmungen:[12]
- Fortan gibt es Frieden zwischen Flandern und Brabant;
- Die Kriegsgefangenen beider Parteien werden freigelassen, ohne dass ein Lösegeld bezahlt werden muss;
- Ein jeder wird wieder eingesetzt in die Güter, die ihm im Krieg entwendet wurden;
- Die Städte Löwen, Brüssel, Nijvel und Tienen und die Adeligen, die den Grafen von Flandern als ihren Herrn anerkannt haben, leisten ihm jährlich jeweils sechs Wochen lang und auf eigene Kosten militärische Unterstützung, und deshalb darf der Graf lebenslang den Titel ›Herzog von Brabant‹ führen;
- Der Graf und die Gräfin von Flandern erhalten wegen der umfangreichen Ausgaben, die sie während des Erbfolgekrieges zu tragen hatten, den Besitz der Stadt und Herrschaft Mechelen, wie es schon früher vereinbart war;
- Zum Ausgleich für ihre Aussteuer, die wegen des Krieges nicht bezahlt worden war, wird Margaretha von ihrer Schwester Johanna mit Antwerpen belehnt;
- Wenzel und Johanna dürfen keinen einzigen Teil des Herzogtums verkaufen oder veräußern;
- Margaretha und Ludwig geloben Johanna von Brabant die vasallitische Gefolgschaft für Antwerpen;
- Alle Brabanter Kaufleute sollen frei und unbehelligt Handel treiben ohne die Bedingungen, die während des Krieges erlassen worden waren.
Die Bestimmungen dieses Friedensvertrages stimmen fast völlig überein mit den Bedingungen, die Wilhelm schon Anfang Mai Ludwig versprochen hatte. Anders als damals wurde jetzt jedoch näher bestimmt, dass Ludwig und Margaretha die Herrschergewalt Wenzels und Johannas anerkennen, und dass sie die Abtei von Affligem nicht länger als Befestigungsanlage verwenden können. Die Entschädigung für Ludwig, von welcher am 5. Mai noch separat die Rede war, wurde offensichtlich mit der Übergabe von Mechelen gleichgesetzt, und im definitiven Friedensvertrag wurde das Versprechen Wilhelms, sich um etwaige Differenzen bezüglich der Erbansprüche Margarethas zu kümmern, nicht mehr mit aufgenommen. Über die Urkunde vom 5. Mai hinaus wurden im Friedensvertrag drei Bestimmungen allgemeineren Charakters hinzugefügt, und zwar die Bestimmungen 1, 2 und 9.
Um Missverständnissen in seinem Vertrag vorzubeugen, fasste Graf Wilhelm am nächsten Tag in Lessines, unweit von Ath, noch acht weitere Artikel separat ab. Mit diesen Anordnungen, die auch auf Französisch formuliert wurden, erklärte und präzisierte der Graf einige Bestimmungen aus seinem Vertrag vom Vortag.[13]
Alles in allem kann konstatiert werden, dass der Graf von Holland seine geheimen, Anfang Mai getroffenen Verabredungen mit dem flämischen Grafen einhielt. Für Wenzel und Johanna müssen die Ergebnisse der Vermittlung Wilhelms äußerst enttäuschend gewesen sein. Sie hatten ihn ins Vertrauen gezogen, er aber hat ihre Interessen verraten, anstatt sie zu verteidigen, und sich dafür sogar noch mit Heusden belohnen lassen.
27
5. Eine mittelalterliche Chronik
Obwohl der Vertrag von Ath niemals vom Kaiser ratifiziert wurde und somit formal gesehen nicht rechtsgültig war, hat er die politische Situation des Herzogtums Brabant nachhaltig beeinflusst. Die Enttäuschungen, die es darüber in Brabant gab, finden in der Brabanter Historiographie des 15. Jahrhunderts in ausgezeichneter Weise Ausdruck. Das beste Beispiel dafür liefert eine zwischen 1432 und 1441 anonym verfasste Chronik, die als die Fortsetzung der Brabantse yeesten [Brabanter Chronik] bekannt ist – jener berühmten mittelniederländischen Reimchronik aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, in welcher der Antwerpener Stadtschreiber Jan von Boendale die Geschichte Brabants aufgezeichnet hatte. Sein Werk kann als die erste nationale Brabanter Geschichtsschreibung betrachtet werden, die dank der Abfassung in der Volkssprache für eine breitere Masse verständlich war.
Der Text Boendales wurde fast ein Jahrhundert später von einem anonymen Autor um nicht weniger als dreißigtausend Verszeilen ergänzt. Diese Fortsetzung behandelt die Brabanter Geschichte beginnend mit dem Tod Herzog Johanns III. 1355 bis zum burgundischen Machtantritt im Jahre 1430. Wie Boendale selbst beschreibt auch sein namenloser Nachfolger die Ereignisse deutlich aus Brabanter Perspektive. Für die Fortsetzung benutzte er eine große Zahl relevanter Urkunden, die er manchmal fast wortgetreu in Reime brachte. Das ist einigermaßen bemerkenswert, da im 15. Jahrhundert der Reim für Chroniktexte nicht länger üblich war und Reimtexte zu dieser Zeit sicherlich nicht mehr den Ruf von Zuverlässigkeit hatten.[14]
In der Fortsetzung der Brabantse yeesten kommen der Brabanter Erbfolgekrieg und die Entstehungsgeschichte des Vertrags von Ath ausführlich zur Sprache. Nachdem der anonyme Dichter ausführlich dargestellt hatte, wie die Opponenten Wenzel und Ludwig gelobten, sich dem gräflichen Schiedsspruch zu fügen, präsentierte er die Fortsetzung unter der Überschrift »Dit is tseggen hertoghen Willems van Beyeren, sgreven van Henegouwen, van Hollant«, eine versierte Übersetzung in Reimform des ursprünglich in französischer Prosa verfassten Vertrages von Ath vom 4. Juni 1357, was schon wegen des Umfangs dieses Urkundentextes keine geringe Leistung ist. In der Chronik nimmt die Übersetzung fast dreihundertfünfzig Verszeilen ein![15] Damit ist der Vertrag von Ath vermutlich ein sehr seltenes Beispiel eines in Reime gesetzten Friedensvertrags. Die Übersetzung in der Chronik folgt ziemlich genau dem Wortlaut der Urkunde.[16] Auch die separaten Artikel vom 5. Juni werden in der Chronik dargeboten, allerdings in paraphrasierter Form.
28
Nachdem der namenlose Dichter also anhand von Urkundentexten sachlich die Tatsachen präsentiert hatte, hielt er die Zeit für gekommen, seine eigene Meinung zu äußern. Dabei widmete er der Übergabe des Landes Heusden besonders viel Aufmerksamkeit. Faszinierend ist es zu sehen, wie der Übergang Heusdens und der Vertrag von Ath in der kollektiven Erinnerung des 15. Jahrhunderts derart miteinander verknüpft waren, dass ganz allgemein davon ausgegangen wurde, Graf Wilhelm habe die Regelung bezüglich Heusdens in seinen Vertrag mit aufgenommen. Die vom anonymen Dichter in extenso dargestellten Urkunden melden darüber aber gar nichts:
»Nu willen eneghe seggen meere,
als dat grave Willem, die heere,
oec soude hebben gheseit, int fijn,
in dit seggen: ›Hosden mijn‹.
Des en es niet; hets gheloghen,
daer sonder en hadt niet wesen mogen,
die brieven en souden van dien saken
emmer eneghe mensie maken.«[17]
Deshalb lässt der Chronist wissen, wie der Graf wirklich in den Besitz von Heusden gelangte, nämlich indem er es sich einfach aneignete:
»Al en seide hijt in dien seggen niet,
soe eest andersins gheschiet.
Want men wel weet, onghelogen,
dat hijt aen hem heeft ghetoghen.
Met onrechte: het en was niet sijn,
maer hi maecter af: ›Hosden mijn‹.«[18]
Der Dichter suggeriert hier, dass der holländische Graf sich Heusden unrechtmäßig angeeignet hat. Er untermauert seine Behauptung mit dem Argument, dass Heusden vor Ausbruch des Brabanter Erbfolgekrieges noch ordnungsgemäß zu Brabant gezählt wurde. Anschließend bricht der Dichter seine chronologische Darlegung ab, um zu erklären, wie Heusden schon im 13. Jahrhundert von Herzog Johann III. unterworfen worden war, nachdem der Herr von Heusden versucht hatte, sich Holland anzunähern. Seitdem seien – so der Dichter – Burg, Stadt und Land von Heusden herzogliches Lehngut gewesen, trotz des widerrechtlichen Verkaufs Heusdens an den Grafen Wilhelm III. von Holland im Jahre 1318. Überdies hätten Wenzel und Johanna von Brabant feierlich versprochen, das Land von Heusden niemals von Brabant zu trennen.[19] Der holländische Graf habe also kaum etwas mit Heusden zu tun:
»Aldus eest openbaer bekant
dat die greve van Hollant
daer aen en hadde clein noch groot,
al stac hi daer in sinen poot. […]
Als tvorseide orloghe was gheresen,
heeft hi Hosden, borch ende lant,
al ghetogen aen sijn hant,
ende voer sine ghehouden twaer,
al en doet hij gheen verclaer
noch in sijn seggen gheen ghewach,
als men hem te vragen plach
hoet met Hosden soude sijn,
soe mocht hi seggen: »Hosden mijn«!
daer af dat die worde vorscreven
noch al int ghemein sijn bleven.«[20]
Nochmals wird dem Grafen vorgeworfen, dass er in dem Vertrag von Ath Heusden mit keinem Wort erwähnt hatte, sich dessen ungeachtet aber in dem Kampfgewühl zwischen Wenzel und Ludwig diese Güter angeeignet hatte unter dem Motto: ›Heusden mein‹.
29
Interessant ist die Mitteilung des Dichters, dass die Wörter »Heusden mein« noch ›allgemein bekannt geblieben sind‹ (»noch al int ghemein sijn bleven«). Hiermit wird auf den Bekanntheitsgrad verwiesen, dessen sich der Ausdruck »Heusden mein« im 15., möglicherweise schon im 14. Jahrhundert offenbar erfreute. Tatsächlich wurde dieser Ausdruck zu einem geflügelten Wort, welches bis zum 19. Jahrhundert in unterschiedlichen historiographischen Werken auftaucht. Seit etwa 1500 wurde die erweiterte Form »Heusden mein, Mechelen dein« üblich, womit habgierige Leute bezeichnet wurden, oder Menschen, die nur ihre eigenen Interessen im Auge haben.[21]
Obwohl der namenlose Dichter nachdrücklich hervorhebt, dass er ein altes Missverständnis aufklärt – nämlich, dass Graf Wilhelm sich mittels des Vertrages von Ath Heusden zugeeignet hätte – schafft er gleich ein neues, indem er vorsätzlich die Wahrheit verdreht. Dass die Übergabe Heusdens in Wirklichkeit schon am 29. März 1357 schriftlich festgehalten worden war, bleibt in der Chronik nämlich völlig außer Betracht. Der anonyme Dichter der Fortsetzung war aber mit dem Urkundenmaterial bestens vertraut, so dass er auch diese Urkunde gekannt haben muss. Somit ließ er die Vereinbarung vom 29. März also ganz bewusst aus seiner Geschichte weg, damit das vermeintlich widerrechtliche Gepräge des Vorgehens des holländischen Grafen besser zur Geltung kam und die Argumentation an Nachdruck gewann.
Die Fortsetzung der Brabantse yeesten hat auf die spätere Brabanter Geschichtsschreibung so großen Einfluss ausgeübt, dass sich die Empörung über das Auftreten des Grafen noch über Jahrhunderte hinweg gehalten hat.
30
Die große Aufmerksamkeit, die in der Historiographie auf den Frieden von Ath gerichtet wurde – die Brabantse yeesten sind wohl das beste Beispiel dafür –, zeigt, welch heikles Thema der von Brabant erlittene Verlust auch lange danach noch immer war. Dass der Blick dabei vor allem auf Heusden gerichtet wurde (das ja genaugenommen kein Bestandteil des Ather Friedensvertrags war), lässt sich zum größten Teil daraus erklären, dass im Laufe des 15. Jahrhunderts Antwerpen wieder in Brabanter Hände fiel, und Mechelen sich von Flandern löste und eine selbständige Entität wurde. Heusden blieb aber unvermindert holländisches Besitztum, und dies trug dazu bei, dass es zu einer Art Symbol für das Unrecht wurde, das der holländische Graf in Brabanter Augen verübt hatte. Die Brabanter fanden sich hiermit nicht ohne weiteres ab und bemühten sich lange, dieses Unrecht rückgängig zu machen.
Nachdem schon im 14. Jahrhundert Wenzel selbst Versuche dazu angestrengt hatte, ergab sich 1420 eine hervorragende Gelegenheit, das Land Heusden wieder in Brabanter Hände zurückzugewinnen. Im Rahmen eines Streits um die Nachfolge des verstorbenen Grafen Wilhelms VI. von Holland wurde Heusden in jenem Jahr von einer kleinen Brabanter Armee eingenommen. Die holländische Erbin, Jakoba von Bayern, war zwar verheiratet mit Herzog Johann IV. von Brabant, doch vermochte dieser nicht, den rechtmäßigen Erbanspruch Jakobas gegen ihren Onkel Johann von Bayern zu verteidigen. So gelangte Johann ziemlich einfach in den Besitz der Grafschaften Holland und Seeland. Diese Situation wurde von den Brabanter Ständen aber nicht akzeptiert; sie traten erfolgreich für Jakoba ein und konnten deshalb 1420 Heusden und die holländische Nachbarstadt Geertruidenberg erobern. Jakoba ließ sich dort feiern, aber unter Brabanter Druck geschah das nicht in ihrer Eigenschaft als Gräfin von Holland, sondern als Herzogin von Brabant. Eine tatsächliche Annexion durch Brabant war jedoch nicht erreichbar, so dass eine juristische Konstruktion ausgedacht werden musste, um Heusden trotzdem an Brabant binden zu können: Stadt und Land von Heusden sollten fortan brabantisch bleiben, bis alle Kosten im Rahmen des Brabanter Feldzugs gegen Heusden und Geertruidenberg zurückerstattet wären. Man versäumte aber, irgendetwas schriftlich festzulegen, und so blieb auch dieser Brabanter Anspruch letzten Endes ohne Wirkung. Jedoch tauchte diese Bestimmung regelmäßig in den Brabanter Quellen wieder auf, zum Beispiel in den »Blijde inkomsten« (französisch: Joyeuses entrées), die Bestätigung der geltenden Privilegien eines neuen Herzogs bei seinem Einzug. Zum letzten Mal geschah dies in der »Blijde inkomst« Philipps II. 1549.[22]
31
Die Unruhe bezüglich Heusden kam im Laufe des 15. Jahrhunderts in eine neue Phase, als sowohl Holland (1428) als auch Brabant (1430) in das burgundische Reich aufgenommen wurden und somit in einer Personalunion miteinander verbunden waren. Dies führte zu der Situation, dass Herzog Philipp von Burgund als Landesherr von Holland versprechen musste, das Land von Heusden bleibe holländisch, während er gleichzeitig als Herzog von Brabant in aller Deutlichkeit zu erklären hatte, dass er die Brabanter Ansprüche auf Heusden unterstütze. Dieser Widerspruch wurde 1452 vom burgundischen Herzog beendet, als dieser entschied, dass Burg, Stadt und Land von Heusden zur Grafschaft Holland gehörten. Interessant ist übrigens, dass der (drohende) Verlust der Brabanter Autonomie infolge der Integration in den burgundischen Herrschaftsverband in den Jahren um 1430 der Brabanter Geschichtsschreibung einen starken Impuls gegeben hat, wie er zum Beispiel zum Ausdruck kommt in der ausführlichen Erörterung, die der Heusdener Frage in den Brabantse yeesten zuteil wurde.[23]
Dennoch fügte man sich in Brabant auch nach 1452 nicht einfach der Zuteilung Heusdens an Holland, wie schon von P. Hoppenbrouwers dargelegt wurde. Trotz des fortwährenden Brabanter ›Vorbehalts‹ ist die holländische Souveränität über Heusden jedoch nicht mehr ernsthaft bedrängt worden. Als Heusden während des Aufstands (»de Opstand«) gegen die Spanische Regierung 1577 endgültig die Seite der Generalstaaten wählte, war die territoriale Beziehung mit Holland auf Dauer sichergestellt.[24]
32
Letztendlich war ein Umbruch nötig, um die holländische Souveränität über Heusden zu beenden. Am Ende des 18. Jahrhunderts, nach der Französischen Revolution, machte die Republik der Vereinigten Niederlande der Batavischen Republik Platz, was mit einer durchgreifenden Revision der Verwaltungsstrukturen einherging. Dazu wurden unter anderem Pläne entwickelt, die Gebietsgrenzen neu einzuteilen: des ›territorialen Gleichgewichts‹ halber sollte die Grenze zwischen den zu errichtenden Departements Brabant und Holland geändert werden. Die Debatte darüber schleppte sich aber so lange hin, dass die beabsichtigte Änderung erst nach der Entstehung des Königreichs der Niederlande vollzogen wurde. 1815 wurde gesetzlich festgelegt, dass ein erheblicher Teil der Provinz Holland, darunter das Land von Heusden, künftig der Provinz Brabant angehörte.[25]
Die 1815 zustande gekommene Grenze zwischen den gegenwärtigen Provinzen Süd-Holland und Nord-Brabant ist bis auf den heutigen Tag intakt geblieben. Das bedeutet aber nicht, dass damit auch die Auswirkungen der Ereignisse von 1357 völlig aufgehoben wären. Im Volksmund werden das Land Heusden und einige anliegende Gebiete als ›Holländisches Brabant‹ bezeichnet. Und das nicht ohne Grund, da zum Beispiel Mentalität und religiöse Überzeugung der Bewohner noch immer stark vom Kalvinismus geprägt sind und daher eher als holländisch denn als brabantisch charakterisiert werden können. Das 1357 von Brabant erbrachte Opfer zur Realisierung des Friedens von Ath hat also nicht nur Jahrhunderte lang die politische Einteilung der Niederlande beeinflusst, vielmehr sind nach genau 650 Jahren die Folgen dieses mittelalterlichen Friedensvertrags vor Ort noch immer spürbar.
33
Avonds, Piet / Brokken, Hans M.: Heusden tussen Brabant en Holland (1317–1357). Analyse van een grensconflict, in: Varia Historica Brabantica 4 (1975), S. 1–95.
Boffa, Sergio: Warfare in medieval Brabant 1356–1406, Woodbridge 2004.
Engen, Hildo van: »Heusden mijn, Mechelen dijn«. Over de lotgevallen van een vergeten spreekwoord, in: Historische Reeks van het Land van Heusden en Altena 16 (2007), S. 9–31.
Hoppenbrouwers, Peter C. M.: Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden (ca. 1360–ca. 1515), Wageningen 1992 (AAG bijdragen 32), Deel A–B.
Latjes, P.: De wording en bestuurlijke indeling van Hollands-Brabant tijdens de jaren 1796–1815, in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift 14 (1982), S. 168–175.
Laurent, H. / Quike, F.: La guerre de la succession du Brabant (1356–1357), in: Revue du Nord 13 (1927), S. 81–121
Mieris, Frans van: Groot Charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland, Leiden 1753–56, Bd. 1–4.
Stein, Robert: Politiek en historiografie. Het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw, Löwen 1994 (Miscellanea Neerlandica 10).
Uyttebrouck, André: Le gouvernement du duché de Brabant au bas moyen âge (1355–1430), Brüssel 1975 (Université Libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres 59, 1–2), Bd. 1–2.
Willems, Jan Frans (Hg.): Les gestes des ducs de Brabant, en vers flamands du quinzième siècle / De Brabantsche Yeesten of Rymkronyk van Braband, Brüssel 1839–69, Bd. 1–4.
34
Anhang: Der Frieden von Ath, Urkunde und Chronik
| Frieden von Ath, 4. Juni 1357
Originalurkunde: Lille, Archives du Nord, B 269–7882. |
Brabantse yeesten
Brüssel, Bibliothèque Royale, Hs. 17017, f. 18r–20v. |
| Dus Guillames de Baiuieres, contes de Haynau, de Hollande, de Zellande et sires de Frize, faisons sauoir a tous que nous, rewardans le grant grief, mortalité et pestilence, qui a estet auoec les arsins et domaiges entre no chier et amé cousin Lodewijc, conte de Flandres, duc de Brabant, conte de Neuers et de Rethenz et sires de Malines, et ses boines villes et pais et bonnes gens, nobles et non noblez, d’une part, et no chier et amé cousin seigneur Wencelin, duc de Luxembourch et de Brabant, et no chiere anthe la duchoise de Luxembourch et de Brabant, leur bonnes villes et pais et bonnes gens, nobles et non nobles, d’autre part, et encore s’en peuist estre ensieuis, se li dessus nommet ne s’en fuissent mis par nostre requeste et pourcach sur nous, qui ce auons empris, pour bien de pais, de concorde et de loyal amour, qui doit estre entre yaus, tant par affiniteit qu’il ont deus seurs germaines et que leur pais sont tenant l’un à l’autre, dont il doiuent estre loyal amit et visin ensamble, et aussi que nous en estiemes et sommes tenu dou meller, pour le cause de ce que nous estons de linage prochain a l’un et a l’autre, et pour abaissier et estindre si grant grief et crueuse emprise, que faite auoient l’un sur l’autre, que toute bonne gent doiuent desirer et estre lyet pour ce est il que nous, dus Guillames de Bauieres dessus nommés, par le pooir que no dessus dit cousin et nostre anthe nous ont donnet, et par leurs lettres ouuertes, de dire et sentensijer no dit, ordenons, declarons et disons no dit dit, en la fourme et manière que chi après s’ensieut. | Hertoghe Willem van Beyerlant,graue van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelant, heere van der Vryeschen rijcken, doen te weten yegheliken, aensiende die grote verderffelijcheit, manslacht ende sterflijcheit, die van brande sijn aen gheresen, ende scaden, die hebben ghewesen, tusscen onsen gheminden verderflijc onsen neue graue Lodewijc van Vlaendren, hertoghe van Brabant, graue van Neuers, dat goede lant, van Rethees ende van Mechelen heere, sinen goeden steden, ende vort meere sinen goeden lieden, edel ende rijcke, ende onedelen des ghelike van Vlaendren, ter eender zijde, ende ons liefs neuen danderzijde van Lutzenborch, hertoghe Wencelijn, ende van Brabant, metten vrienden sijn, daer noch meer quaets wt hadde geresen hadde dit opnemen niet ghewesen bij onsen versueke veruolght dus vort, dwelc wij, om pays, om goet accort, aen hebben genomen tonser pine, wt rechter minnen, die sculdich tsine es tusschen hen onuerbrekelike, mids dat sij jn huwelike twee susteren hebben, sij v bekant, ende oec haerer beider lant deen aen dander es gheleghen, soe sijn si sculdich dan te plegen goeder minnen, ende ghebuersamheit, tegader, met ghetrouwicheit. Ende om dat wij, jn rechter trouwen, van maeghscape sijn daer jn ghehouwen te blusschen ende te doen belet alsoe vreseliken opset als sij daden, jn allen wegen, sal elc goet mensce sijn genegen, ende stellen tot peise sijn begert hier om wij Willem voere verclert van Beyeren, mids der machtichede onser neuen, onser moyen mede, mids openen brieuen, claer bescreuen, ons die sentencie hebben ghegeuen, ordeneren wij, ende verclaren ende seggen ons seggen, ende openbaeren, jn der vorme, jnder maniere na volgende nv al hiere: |
| [1] Premiers, que bonne pais soit entre nos dessus nommés cousins et anthe, leur pays, villes et gens, nobles et non nobles, de che jour en auant sans iamais resmouuoir, pour cause ne occoison qui ait esté entre yaux, iusques au jour d’huy, et que bonne faueur et loyal amour aient l’un a l’autre, en tous cas ossi bien et ossi auant que s’il n’enwissent onques eut nulle dissencion l’un a l’autre, sans faire nul rewart ne reproche, de cose qui auenue soit, en quelconques manière que ce soit, par fait de wiere ne autrement. | [1] Jnden jersten, wij pais wtgeuen tusscen onse voirseide neuen ende onser moyen tsine jn vreden edle, onedle, lant ende steden, van desen daghe nv vort ane, ende nemmermeer weder op tstane om enich ocsuyn dat es gheleden, tusscen hen, tot den dage van heden, ende ghetrouwe minne, ende anders niet, dragen, ocht noit en waer gheschiet, ende nemmermeer, om dese saken, orloghe noch vermaen maken. |
| [2] Jtem que tout prisonnier qui pris ont estet a le cause de ces wieres, tant de l’une partie comme de l’autre, qui paijet n’ont leur raenchon, ou dont li jours de paiement n’est eskens, qui sont en prison ou en recreance, soient quitté et deliuré, sans riens paijer ne estre poursuiwit de nulle renchon, fors que leur frais raisonnablement. | [2] Jtem alle die sijn gheuanghen, die wile dorloge heeft ghehanghen jn dene of jn dander partye, ja alzoe verre als sye haer ranchoen niet en hebben betaelt noch daer af dach en hebben ghetaelt, maer die gheuangen sijn buten desen, selen quijt ende vry wesen met redeleken coste, sonder te doene veruolch van enegen ranchoene. |
| [3] Jtem nous rewardans que aucunes personnes pour le dit debat et wieres sont eskachiet dou leur et de chou fachent ou puissent faire pourcach, tant de l’une partie comme de l’autre, ou autrement li hayne demourroit entre les dis paijs, s’il ne reuenoient sur le leur, disons que pour bien de pais et de concorde cascuns reuiegne sur le sien, en tel point qu’il le treuue en tel fourme et maniere qu’il le tenoit pardeuant les wieres dessus dictes et foient en bonne et ferme pais sans faire nule ramenteuanche des debas ne des choses qui auenues sont et se fera nos chiers cousins li contes de Flandres vuidier se warnison d’Afflighem, et remettre l’abbé et sen conuent ens, et deffaire se fortereche, et ne porront no dit cousin de Flandres ne de Brabant dore en auant le dite eglise apriesser, de faire maison deffensaule, comme cest eglise et ordene, appartenans au seruiche Nostre Seigneur, et demourra dore en auant comme abbeye et maison de religion, sans iamais faire, ne de l’une partie ne de l’autre, nulle fortereche. | [3] Jtem wij sien aen dat ghone dat om den twist enege persone ute den haeren sijn verdreuen, ende mids den orloge wt sijn bleuen, die volgen ocht volgen mochten bi tide, jn deen of jn die ander zijde, daer af mocht bliuen haet ocht nijt, hier na, jn toecomender tijt, op dat elcken, die es verdreuen, tsine niet weder en waere ghegeuen. Soe seggen wij, om goede eendrachticheit, om pays der lande voerseit, dat elc opt sine comen sal, jnder vormen ende manieren al dat hijt voer den orloghe te houden plach, sonder prologhe, jn peyse, sonder vermaninghen vanden vorleden dinghen. Ende sal ons gheminde neue doen van Vlaendren ruymen sijn garnisoen van Haffligem, ende in regement den abt setten, jn sijn couent, ende vort bij geen van onsen neuen en sal daer werhuys sijn verheuen, noch belasten van nv vort, maer laten tgodshuys, soet behoert, den dienst Gods daer jn te doene, als huys van religioene. |
| [4] Encore disons et ordenons, pour tant que les bonnes villes de Brabant et aucuns des baneres, cheualiers et escuiers dou dit pays fisent foit, serement et hommaige a no dit cousin de Flandres, que dore en auant le vie de no dit cousin, les villes de Louuaing, de Brousselle, de Niuelle et de Thielemont le seruiront, cascune ville vne baniere a escuches de ses armes, et desous cascune baniere vint cinq hommes d’armes, sijs sepmaines durant, sur le coust et le frait dou pais et des dictes villes de Brabant, vne fois l’an, toutes fies que nos dis cousins de Flandres ara host de sen dit pais de Flandres, encontre tous, hors mis le duc et le ducesse, no anthe, et le pais de Brabant, et entre ches quatre banieres ara deus baneres et deus cheualiers, et, parmi tant, nos dis cousins doit quitter les dictes bonnes villes de Brabant, les chevaliers et escuiers de leur foy et saarement que fait li ont, et anuller et rendre les lettres que faites en furent, et ossi pour chou que par le certaine requeste, que les dictes bonnes villes et les chevaliers et escuiers de Brabant, qui iuret auoient, par leur conseil et accort, nos dis cousins emprist le title de duc de Brabant, jl li demoura, s’il li plaist, toute se vie, pour le seruice qu’il doit auoir d’yaus, si que dit est. | [4] Noch seggen wij ende ordeneren om dat somme steden ende baenritsheeren van Brabant, ridders ende knechte vercoren, manscap, trouwe ende eet geswoeren hebben onsen vorseiden neue van Vlaendren, soe lange als hi leue, dat Louen ende Bruessel mede, Niuele ende Thienen die stede, hem eens des jaers alle viere dienen, elc met eenre bannier van haerer wapen, verstaet den sijn, van ses weken den termijn, onder elc XXV man ghewapent, wanneer si van onsen neue des werden versocht, tegen wien dat wesen mocht sijn orloghe, behouden daer jnne den hertoghe ende der hertoginne, onser moyen van Brabant, of oec tegen haere goede lant. Onder dese banieren sullen wesen II baenrutse, II ridders gepresen. Dit sullen sij doen, als vore ghenant, ten coste des lands van Brabant. Ende mids dien sal ons neue vorseit quijt schelden trouwe ende eyt den goeden steden van Brabant, ende den edelen, ende te hant te nieute doen ende ouergeuen die brieue, diere af waren gescreuen. Ende want, ten versuecke der steden enten edelen, die hem eet deden, ende bij haeren rade, ons neue tzier vromen den titel heeft aenghenomen hertoge van Brabant hem te scriuen, soe sal hem dien titel bliuen, op dat hi wille, al zijn leuen, om des dienst wille vorscreuen. |
| [5] Jtem comme nos chiers et amés cousins li contes de Flandres li peres, iadis de bonne memoire, si acquist et acata le ville de Maslines, les villiaus et appartenanches d’icelle, et nos tres chiers et amés sires et oncles li roys Phelippes de France, qui Diex fache bonne merchit, en ordenast et desist que, pour chou que nos dis cousins quitteroit le dit markiet, jl aroit quatre vins sijs mille et chuinq cens royaus d’or, et il soit ensi que nos dis cousins de Flandres a present si ait eut grans cous, frais et domaiges, en ches wieres durans, a le cause de chou que tenut ne li fu mies le premiere pais et ordenance, qui accordee fu a Aske et sayellee, nous, en restoir et recompensacion de chou, disons, ordenons et declarons que dores en auant il et ses hoirs, contes ou contesse de Flandres, soit sires de le dicte ville de Maslines, des villiaus et des appartenanches et appendances d’icelle, a tous jours perpetuelment et heritablement, en le fourme et maniere que les lettres dou dit accat contenoyent, et que li vesques de Liege et ses capitles l’en rechiurent en foy et en hommaige, des quels on tient la dicte ville de Maslines en fief, a tenir le dit conte de Flandres, no cousin, et ses hoirs, frankement, hiretaulement et perpetuelment, sans autruij auoir ne demander droiture, signerie ne hauteur, et se doit no dicte anthe et nos cousins de Luxembourch et de Brabant, pour le doubte des debas qui s’en porroient naistre en temps auenir, rendre toutes les lettres qu’il en ont de le dicte ordenanche, que nos dis chiers oncles li roys en fist, de le dicte ville de Maslines, deuens trois sepmaines proismes. | [5] Jtem alsoe zalegher ghedochte ons lieue gheminde neue cochte (van Vlaenderen ons neuen vader) die stat van Mechelen, en algader die dorpen ende haer toe behoeren, ende ons geminde heere vercoren ende oem, Philips van Vranckrike, wiens ziele God van hemelrike ghenedich si, ordeneerde sijn seggen, soe wanneer hij soude af leggen dien coep, die hi hadde ghedaen ons vorseide neue, soude hi ontfaen LXXXVIM VC ryeale van goude, verstaet mijn tale ende want ons neue nv ter tijt van Vlaenderen, mids dit ghestrijt, die wile dorloghe heeft ghereden, cost ende scade groot heeft leden, mids dat den peis, sij v verclaert, die gemaect ende bezegelt waert tot Assche, alzoe die brieue wt spreken, hem niet ghehouden en was sonder breken, soe seggen wij ende ordeneren, om sijn scade te compenseren, ende in beternessen van desen dingen, dat hi ende sijn nacomelinghen, grauen ende grauinnen mede, sullen heere sijn vander stede van Mechelen, ende al haer aencleuen, erflec, eewelec, sonder begeuen, jn alder vormen, jn alder saken, dat die brieue des coeps mensie maken, alsoe hi eet ende manscap dede den bisscop enten capittel mede, daer men af hout die stat te lene, openbaerlijc jnt gemene, dat die ons neue van Vlaenderen al eewelec vry behouden sal, hi ende sijn oer, jn erflecheden, sonder jement anders heerlicheden daer jn te hebben, oft enich recht, ende sal ons vorseide moye sleght ende ons neue van Lutzenborch ende van Brabant, om tbesorch dat toe comende mocht op risen, ouer geuen ende bewijsen alle die brieue samentlike des seggens ons oems van Vranckrike, die si op Mechelen hebben moghen, binnen drie weken, nuertoghen. |
| [6] Jtem comme il soit ensi que no chiere et amee cousine, le contesse de Flandres, ne fust onques assenee ne payé de no tres chier et amé cousin le duc de Brabant sen pere, qui Diex absoille, dou droit de son mariage ne de droiture que escheir li peuwist de luj, ne en meubles ne en catels, pourquoy le dicte wiere se commencha, nous, en recompensacion de chou, disons, ordenons, et li accordons a auoir cascun an, pour li et pour ses hoirs qu’elle a a present ou ara de no chier cousin de Flandres, jusques a le somme de dijs mille florins de Florenche par an, et pour celle dicte somme no dicte cousine tenra heritaulement, pour li et pour ses hoirs deuant nommés, en fief et en hommaige de no anthe le ducesse et de ses hoirs, dus de Brabant, la ville d’Anwiers, et toutes les appendances et appartenances entirement, deuens leur frankise, auoec le iustice haute et basse, rentes et reuenues, en rabat des dis mil florins par an. Et ou cas que le dicte ville, les rentes et reuenues dessus dictes ne porroient les dijs mil florins de Florence acomplir, nous li assenerons, par iuste prisie, faite deuens le mois apres le date de ches lettres, de chou qu’il faura de le dicte some de florins par an, es villiaus et reuenues estans au plus pres de le dicte ville d’Anwiers, et de chou deuera no dicte cousine de Flandres faire foy, homaige et seruiche, et nos cousins de Flandres comme ses mambours et leur hoir, sicomme dit est, a no chiere et amee anthe dessus nommee et a ses hoirs, dus de Brabant, ensi que frere et seur maisnet ou maisnee doiuent faire a leur frere ou seur aisnet ou aisnee. Et se doit le ville d’Anwiers deuens trois sepmaines proismes faire serement a no cousine le contesse de Flandres et a no cousin le conte de Flandres comme ses mambours, et parmi tant quant no dicte cousine de Flandres et nos cousins li contes de Flandres comme ses mambours feront faire a yaus de le dicte ville serement, il leur aront enconuent et confermeront frankement a tenir toutes les frankises, priuileges et chartres qu`il ont des dus de Brabant, de temps passet iusques au jour duy. | [6] Jtem alzoe ons gheminde nichte grauinne van Vlaendren gheen gherichte van onsen zeere gheminden neue haeren vader (wien God vergeue Sijn mesdaet) noch bewijsinghe ghehadt en heeft, noch betalinghe van huwelike noch van allen rechte des haerre mocht toe vallen, noch jn hauen, noch jn kasteelen van haeren susterliken deelen, daer jerst wt sproot die werringe, wij, als voere een rechtinghe van desen, seggen ende ordeneren onser nichten ende acorderen haere ende haer oeir, ende al doyr, dat sij namaels crygen sal van onsen neue haeren man van Vlaendren, elcx jaers vort an die somme van XM florine van Florenchen, goet ende fine, ende voer welcke somme vorseit sal ons nichte jn erflecheit, sij ende haer oer voere ghenandt, van onser moyen van Brabant ende van haeren oeyre vort aen, jn manscape ende te lene ontfaen die stat van Antwerpen, met al haeren toebehoerten, groot ende smal, met neder ende hogher heerlicheit, jn afslaghe vander sommen vorseit. Ende of die renten en opcomingen der vorseider stad niet en volstringen die XM florine voere gelesen, sullen wij, na datum van desen, binnen eenre maent, met justen prijsen, vanden ghebreke vort bewijsen, op die naeste renten, daer naest ghelegen, ende sal ons vorseide nichte hier tiegen manscap ende eet van ghetrouwichede doen, ende ons neue mede, als haere momboer, sijts ghewes, ende haer oer, als vorseit es, onser gheminder moyen, ende vort den oeyre van Brabant, als dat behoort den joncsten brueder of suster mede, den outsten te doene, na die zeede. Ende sal van Antwerpen die port hulden ende zweren vort, ten naesten III weken, of daeren binnen, onser nichten der grauinnen, ende onsen neue daer toe meere, als haere momboer ende heere. Ende mids desen, soe sal ons nichte ende neue hen houden al, ghelouen ende confirmeren vry te houden al haer hanteren, chartren, priuilegen, uryheden, die si hebben lange vorleden vanden hertogen gheworuen van Brabant, die sijn ghestoruen. |
| [7] Encore disons et ordenons que de ce jour en auant no chiere et amee anthe, le ducesse de Luxembourch et de Brabant, ne nos cousins li dus de Luxembourch et de Brabant, comme ses mambours, ne peuent vendre, aliener ne eslongier le pays de Brabant en tout ne en partie. | [7] Noch seggen wij, ende ordeneren jn ons seggen ende declareren dat van desen dage vort an ons gheminde moye, noch haer man, hertoghe van Lutzenborch en van Brabant, als haer mombaer, tgoede lant moghen en selen, om ghene letten, bezwaren, vercopen noch versetten, noch becommeren, jn ghenen keere, jn al noch jn deele, nemmermere. |
| [8] Et encore disons que no chiere cousine le contesse de Flandres, et nos chiers cousins li contes comme ses mambours, doiuent faire foy et homaige de le dicte ville d’Anwiers et des appendances, dont elle sera assenee iusques a le somme de dijs mille florins par an, sicomme dit est, a no chiere et amee anthe le ducesse de Brabant, pour li et pour ses hoirs, dedens les quinse jours apres le date de ces lettres, et il le doiuent recheuoir, et toutes ches dictes raisons, ordenances, et deuises dessus dictes, ou cas que aucuns tourbles y porroit estre, de l’une partie ou de l’autre, nous, dus Guillames dessus nommés, y mettons nostre retenanche en tout ou en partie pour ordener et declarer, si auant que bon nous samblera, pour les dictes parties warder en leur droit et raison, toutesfois que requis en serons, de l’une partie ou de l’autre, dedens le moys apres leur semonce. | [8] Noch seggen wij, met rijpen sinne, dat ons lieue nichte de grauinne van Vlaendren, ende ons neue mede als haer momboer, met eede zweeren sullen eet van trouwen om des sij Antwerpen sullen houwen voer XM penninge voer ghelesen, des jaers, soe hen dat es bewesen. Des sullen sij manscap doen ende eyt onser lieuer moyen vorseit, voer haere en voer haer oerlinghe, ende selen gescien dese dinge binnen XV dagen met lieue, na die date van desen brieve. Ende jn al dit seggen vorseit, of daer eneghe donkerheit jn gheuiele, van enegher zijde, namaels in toecomenden tijde, wij, hertoghe Willem openbaren, behouden daer jn ons verclaeren, ons goet duncken, ons declareren, jn al, jn deele, als wi des weeren versocht, van enegher partye. |
| [9] Et parmi toutes ces ordenanches dessus dictes, nous disons que bonne pais soit entre nos dessus nommés cousins et leur pays ensamble, a tous iours mais. Et che dit disons par nostre discrecion, comme poissans, par le forche et viertut que li dessus nommet nous en ont donnet, sur leur lettres et obliganches que faites en ont a nous. Encore disons et declarons, pour plus grant amour et faueur auoir l’un à l’autre, et pour toutes doutez et obscurtés oster, que tous marcheans de Maslines, d’Anwiers, de Louuaing, de Brouselles et de toutes les autres villes de Brabant puissent aler, passer et mener paisiulement et amiablement leurs marchandises de l’une ville a l’autre, sanz nulle nouuelle ordenanche, deffense, ne occoison acoustumer, autrement qu’il n’estoit endeuant le commenchement de ches weres. Et pour tant que li dus de Brabant anchiennement, pour le cause de le seignourie d’Anwiers, s’escrisoit marchis dou Saint Empire, et il soit ensi que par no ordenance dessus dicte, no chiere cousine le contesse de Flandres soit assenee de le dicte ville d’Anwiers, en la maniere que dit est, atenir en foy et en hommaige de no dicte chiere anthe, et de ses hoirs dus de Brabant, nous ordenons et declarons que li titles dou marchit demeure a no dicte anthe et a ses hoirs, dus de Brabant, pour cause de le souueranietet et que on le tient en fief de li. | [9] Ende mids alder ordenanchen, die wye hebben vorsproken ende wt gheseit, seggen wy pays, eendrachticheit, tusschen onse lieue neuen, haer lande, ende des daer aen mach cleuen. Ende dit seggen wi mids die cracht, bij onser discrecien, ende mids macht die ons onse vorseide neuen met obligacien hebben ghegeuen, met bezegelden brieuen wel gheraect, die ons daer af sijn ghemaect. Noch seggen wij en verclaren mede, om meerder minne en vriendelijchede, deen ten anderen vort aen te dragen, ende vreese ende donkerheit te verjagen, dat alle coopliede van Mechelijn, van Antwerpen, van Louen, wie si sijn, van Bruessel, ende vanden anderen steden van Brabant, selen vort met vreden haer comenscap minlijc hanteren, vredelec liden ende keeren deen stat ter andre, met vredsaemheit, sonder ander nuwicheit, ocsuyn of nuwe costume te maken, ende sullen bliuen al die saken soe sij stonden, van nv vort an, eer dat orloghe jerst began. Ende om dat van outs es bleuen dat die hertogen hebben ghescreuen van Brabant, alst es blikelike, mergrauen vanden Roemschen rijcke, ouermids der heerlecheit vander stat van Antwerpen vorseit, ende al eest alsoe dat wij gheordenert hebben, waer bij onse lieue nicht van Vlaendren sal hebben die bewisinghe al op Antwerpen, groot en clene, als vorseit es, sal sijt te lene van onser lieuer moyen ontfaen van Brabant, ende haeren oeyre vort aen. Wij ordeneren ende verclaren jn ons wtsprake, ende openbaeren dat vort dien titel bliuen sal onser vorseider moyen, ende al haeren oeyre, teewegen dagen, die den name van Brabant dragen, mids der souerainlijcheit vander hogher heerlicheit, ende ment van haere hout te lene. |
| En tesmoing des choses dessus dictes, nous, dus Guillames de Baiuiere dessus nommés, auons mis et appendut no sayel a ches presentes lettres, qui furent faictes et donnees en no vile d’Ath le jour de le Trinitet, quatrisme jour dou mois de juing l’an de grace mil trois cens cinquante siept. | Jn orconden al ghemene ende in ghetughe der waerheit, wij Willem van Beyeren vorseit hebben wthangende ghedruct, met lieue, onsen zegel aen dese brieue, jeghenwordich ghemaect, ghegheuen jn onser stat van Aedt, ghescreuen opder heileger Driuoldicheit dach, die IIII daghe jn junio lach, jnt jaer van gracien openbaer XIIIC ende seuen ende vijftich jaer. |
35
[*] Hildo van Engen, Dr., Streekarchief Land van Heusden en Altena (Nl), Archivar, zeitweise freier Mitarbeiter im DFG-Projekt »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
Ich danke Stefanie Doll und Ulla Bucarey (München), die so freundlich waren, den vorliegenden Text zu korrigieren.
[1] Laurent / Quicke, Guerre de la succession 1927; Boffa, Warfare in medieval Brabant 2004, S. 3–10.
[2] Originalurkunde in Nationaal Archief zu Den Haag, Archiv der Grafen von Holland, Inv. Nr. 1146. Eine Edition findet man in Van Mieris, Charterboek 1753–56, Bd. 2, S. 867–877, ad 1356 März 29.
[3] Avonds / Brokken, Heusden tussen Brabant en Holland 1975, S. 11–29.
[4] Ebd., S. 29–83.
[5] Laurent / Quicke, Guerre de la succession, S. 114 f.
[6] Van Mieris, Charterboek, Bd. 3, S. 21; WILLEMS, Gestes 1839–69, Bd. 2, S. 536, Nr. 57 (Insertion in Urkunde vom 5. Mai 1357).
[7] Ebd., Bd. 2, S. 536–538, Nr. 57.
[8] Ebd., S. 538 f., Nr. 58.
[9] Ebd., S. 539 f., Nr. 59 (ad 1357 Mai 5.) beziehungsweise S. 541, Nr. 60.
[10] Ebd., S. 541 f., Nr. 61.
[11] Ebd., S. 542 f., Nr. 62.
[12] Der genaue Wortlaut des Vertrages ist im Original diesem Aufsatz im Anhang beigefügt.
[13] Willems, Gestes, Bd. 2, S. 547 f., Nr. 64.
[14] Bezüglich der Fortsetzung siehe Stein, Politiek en historiografie 1994, S. 31–57; zum anonymen Dichter siehe S. 125–141; zum Reim siehe S. 143–153.
[15] Auch der Text der Übersetzung ist im Anhang beigefügt.
[16] Willems, Gestes, Bd. 2, S. 73–76, Verszeilen 2041 f.
[17] Ebd., S. 78, Verszeilen 2153–2160: Nun sagen überdies einige Leute, / dass Graf Wilhelm, der Herr / letztlich auch gesagt hätte / in seinem Schiedsspruch: »Heusden mein«. / Das ist unrichtig; es ist gelogen, / falls das nicht so war, / hätten die Urkunden diese Tatsache / immer erwähnen sollen.
[18] Ebd., S. 78, Verszeilen 2165–2170: Da er es in diesem Schiedsspruch nicht erwähnte, / so ist es anders geschehen. / Man weiß wohl, ungelogen, / dass er es sich angeeignet hat. / Zu Unrecht: es gehörte nicht ihm, / aber er machte daraus: »Heusden mein«.
[19] Ebd., S. 84, Verszeilen 2211–2336.
[20] Ebd., S. 84 f., Verszeilen 2337–2340 und 2354–2364: Also ist öffentlich bekannt / dass der Graf von Holland / damit gar nichts zu tun hatte, / auch wenn er seine Nase da hineinsteckte. / […] / Als der erwähnte Krieg ausgebrochen war, / hat er Heusden, Burg und Land, / sich ganz angeeignet, / und es als sein Eigentum betrachtet, / wenn er das auch nicht erklärt / oder in seinem Schiedsspruch nicht erwähnt, / wenn man ihn zu fragen pflegte / wie es mit Heusden wäre, / dann sagte er: »Heusden mein«! / weshalb der Ausspruch / noch immer allgemein bekannt geblieben ist.
[21] Siehe Van Engen, Heusden mijn, Mechelen dijn 2007.
[22] Uyttebrouck, Gouvernement du duché de Brabant 1975, Bd. 1, S. 51–54; Hoppenbrouwers, Middeleeuwse samenleving 1992, Deel A, S. 6–8.
[23] Ebd., Deel A, S. 8–10. Zu den Konsequenzen der Burgundisierung für die Brabanter Historiographie siehe Stein, Politiek en historiografie 1994, S. 167–206.
[24] Ebd., Deel A, S. 10.
[25] Hierzu siehe Latjes, Indeling van Hollands-Brabant 1982.
Hildo van Engen, Der Frieden von Ath (1357): Ein Schiedsspruch zwischen Dichtung und Wahrheit, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 21–35.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008062408>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 22 oder 21–24.
Andrea Weindl *
Europäische Handelsverträge – Friedensinstrument zwischen Kommerz und Politik
Gliederung:
2. Die Anfänge der europäischen Handelsverträge
3. Eine Sonderform des Handelsvertrags: Die Kapitulation
4. Der Handelsaufschwung zu Beginn des 16. Jahrhunderts
5. Der Handelsvertrag als diplomatisches Instrument
6. Der Handelsvertrag als innen- und außenpolitisches Kampfmittel
7. Der außereuropäische Handel
Text:
Der Handelsvertrag ist ein in Genese, Zielsetzung und Bedeutung besonders interessantes Instrument der Friedenssicherung. Denn in seinen historischen Ursprüngen diente der Handelsvertrag weniger der Schaffung oder Bewahrung von Frieden zwischen zwei verschiedenen Herrschaftsbereichen, sondern er sicherte die Versorgung eines Herrschaftsbereiches mit im Land nicht herstellbaren Gütern. Dagegen versprach man der Gegenseite, die ursprünglich weniger als staatlich organisierte Macht auftrat, sondern aus mehr oder weniger locker verbundenen Kaufmannsgruppen oder einzelnen Kaufleuten bestand, bestimmte Privilegien und Rechtssicherheit. Erst die Übertragung von Rechten und Privilegien lockerer Personenverbände auf staatliche Einheiten ermöglichte die Nutzung des Handelsvertrags als Friedensinstrument, das die Schaffung von Frieden zwischen zwei oder mehreren Vertragspartnern mit der Durchsetzung weitergehender politischer und ökonomischer Ziele verband; zugleich führte diese Übertragung zu dem etwas uneindeutigen Charakter von Handelsverträgen.
Es mag an der Mehrdeutigkeit des Handelsvertrages liegen, dass bis dato eine durchgängige historische Untersuchung des Phänomens fehlt. Wirtschaftshistoriker setzen mit ihren Untersuchungen oft erst nach der Umsetzung freihändlerischen Gedankenguts, also nach dem Handelsvertrag von 1786 zwischen Frankreich und England, an; für die Zeit davor scheint der Blick auf die Entwicklung des Handelsvertrags als Friedensinstrument vielfach durch den Antagonismus zwischen Frankreich und England verstellt, der, bis 1786 auch auf wirtschaftlichem Gebiet ausgetragen, dem Protektionismus Vorschub leistete. Dabei wurden alle den Handelsvertrag bestimmenden Merkmale bereits im 16. und 17. Jahrhundert voll ausgebildet, so dass eine Untersuchung der Genese dieses Vertragstyps durchaus als lohnenswert erscheint.
Im Allgemeinen regelten die Verträge wechselseitige Handelsfreiheit, den Zugang zu Häfen, ungehinderte Ein- und Aus- oder Durchfuhr, Vereinbarungen zum Handel mit den Feinden des Vertragspartners, Zollhöhen und -erleichterungen, Niederlassungsfreiheit für die Angehörigen der Handelspartner, das Recht auf den Erwerb von Grundbesitz, auf Berufsausübung oder auf Errichtung von Gewerbebetrieben, Rechtsschutz, Gewissensfreiheit, Ausweisung von Friedhöfen und Erbsicherung für im Gastland verstorbene Kaufleute sowie die konsularische Vertretung. Wie noch zu zeigen sein wird, konnten aber vor allem die Vereinbarungen, die bis ins kleinste Detail z.B. die Abfertigungsmodalitäten am Zoll oder die Festsetzung und Bekanntgabe der Zollsätze regelten, die entscheidenden sein im europäischen Wettbewerb um die besten Bedingungen auf bestimmten Handelsplätzen.
36
Der folgende Artikel zeichnet die Entwicklung bi- und multilateraler Handelsvereinbarungen von ihren Ursprüngen bis zum bereits erwähnten Vertrag von 1786 nach. Der Schwerpunkt muss dabei sicherlich auf der Frühen Neuzeit liegen, als sich der Handelsvertrag in ein echtes politisches Instrument verwandelte. Im vorliegenden Rahmen können sicherlich nicht alle jemals geschlossenen Handelsabkommen untersucht werden. Auch wäre eine derartige Aufzählung bei aller Divergenz der einzelnen Verträge zwar umfassend, aber über die Entwicklung des Vertragstyps wenig aussagekräftig. Vielmehr sollen einzelne Verträge, die Wendepunkte in der Entwicklung der Handelsverträge markieren oder allgemein zulässige Schlüsse ermöglichen, exemplarisch behandelt werden. Parallel dazu gilt es, die Rahmenbedingungen, welche die Herausbildung dieses Vertragstyps begünstigten, genauer zu umreißen. So kann hier zwar nicht die Entwicklung des europäischen Handels im Einzelnen nachgezeichnet werden, doch müssen zumindest einige Entwicklungslinien, insoweit sie mit der Weiterentwicklung von Handelsverträgen in Verbindung stehen, Erwähnung finden.
37
2. Die Anfänge der europäischen Handelsverträge
Die Privilegienvergabe an einzelne Kaufleute oder Kaufmannsgruppen mag so alt sein wie der Fernhandel selbst. Bereits im Altertum bildete sich zur Sicherung zwischenstaatlicher Handelsverbindungen die Praxis heraus, fremden Kaufleuten und Agenten gewisse Privilegien und eine Sondergerichtsbarkeit, sei es durch Richter des Gastlandes oder durch eine der fremden Gruppe angehörigen Person einzuräumen. Auch wenn es sich bei diesen Vereinbarungen nicht um völkerrechtliche Verträge zwischen politischen Einheiten handelte, sondern um seitens eines Machthabers gewährte Privilegien an Personen oder Gruppen, die nicht oder nur eingeschränkt übertragbar waren, stellten diese Abmachungen doch die Vorbilder für den Inhalt späterer zwischenstaatlicher Verträge.[1]
Die entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung von einfachen Privilegien hin zu den vielseitigen und differenzierten Handelsverträgen der Neuzeit war die staatliche Verdichtung der verschiedenen Herrschaftsgebiete zu administrativ durchorganisierten Territorialstaaten mit abgeschlossenen Zollgebieten und eigener handelspolitischer Zielsetzung. Gleichzeitig existierten auch die einseitigen Privilegienerteilungen weiter, die Fürsten und Fürstinnen oftmals als Einnahmequellen dienten. So kannten das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit ein Nebeneinander von einfachen, schriftlich festgelegten Handelsprivilegien und tatsächlichen zwischenstaatlichen Verträgen, die die Handelsusancen zwischen verschiedenen staatlichen Einheiten festlegten. Nur letztere erlangten völkerrechtliche Bedeutung und so sollen nur diese hier einer genaueren Betrachtung unterzogen werden.
Noch im Mittelalter wurden Bündnis- oder Friedensverträge oft durch einen Artikel zum Handel ergänzt, der recht allgemein Freihandel vereinbarte. Freihandel meinte damals allerdings nicht viel mehr, als dass den Untertanen eines anderen Staates keine separat ausgestellten Seebriefe für ihren Handel abverlangt wurden. Dennoch konnte ein Souverän die Ein- oder Ausfuhr jedes erdenklichen Produktes nach Gutdünken verbieten oder seinen eigenen Untertanen oder privilegierten Kompanien reservieren. Juristischen Schutz für Ausländer gab es unter der schlichten Freihandelsformel so gut wie keinen. Bei der Fortentwicklung des Handelsvertrags ging es nun darum, personell erteilte Privilegien in zwischenstaatliches Recht zu überführen, so dass diese Privilegien oder Handelskonditionen Verhandlungsmasse in der internationalen Diplomatie wurden und ihre (Nicht-)Einhaltung über den Zustand der Beziehungen zweier oder mehrerer Länder zueinander mitbestimmte.
Der Fernhandel innerhalb des christlichen Europa wurde während des Mittelalters vorwiegend über Messen abgewickelt. Der Zugang zu diesen Messen sowie die Geschäftsabwicklung wurden durch die Ausbildung einer speziellen Handelsgesetzgebung geschützt sowie durch Privilegienvergabe der Herrschaftsträger (Fürsten oder Stadtstaaten) zu Gunsten gebietsfremder Kaufleute geregelt.[2] Während sich die Privilegien für einzelne Kaufleute eines anderen Herrschaftsgebietes meist auf die Erlaubnis zur Ein- oder Ausfuhr eines Gutes in einer bestimmten Menge oder über einen bestimmten Zeitraum erstreckten, sicherten solche für ganze Kaufmannsgruppen eines anderen Landes, für die so genannten »Nationen«, den Angehörigen der jeweiligen Gruppe bestimmte Rechte und Freiheiten im Gastland für einen längeren oder unbestimmten Zeitraum zu. Auf diese Weise sollte die Versorgung mit nur im Ausland erhältlichen Gütern gesichert werden. Einzelprivilegien blieben personenbezogen; Privilegien für Kaufmannsgruppen wurden zunehmend zum Politikum zwischen unabhängigen politischen Einheiten. Neben Kaufmannsgruppen aus einem Herkunftsland sicherten sich Städtebünde wie die Hanse Handelsrechte und Privilegien. Im 13. und 14. Jahrhundert bildeten diese zum größten Teil vertraglich festgeschriebenen Handelsgarantien die Grundlage der weiten Wirtschaftsbezüge der Hanse.
Diese Organisationsform galt vor allem für das christliche Europa und so weitete sich der Handel parallel zu den Eroberungen des Christentums im Mittelmeerraum aus. In Verbindung mit der Ausweitung des italienischen Handels nach Byzanz, insbesondere nach den Kreuzzügen und der Errichtung des Lateinischen Kaiserreichs, kam es zu den ersten zwischenstaatlichen Handelsverträgen,[3] und auch nach Ende der lateinischen Herrschaft regelte Byzanz seine Beziehungen zu den Mittelmeeranrainern anhand von Handelsverträgen.[4]
38
3. Eine Sonderform des Handelsvertrags: Die Kapitulation
Bei den Eroberungen des östlichen Mittelmeerraums durch das Osmanische Reich blieb der Austausch zwischen den unterschiedlichen Kulturräumen Islam und Christentum vorwiegend den Angehörigen ethnischer Minderheiten wie Armeniern und Juden oder auch Griechen überlassen. Zwar federten die italienischen Stadtrepubliken die Eroberungen des Osmanischen Reiches im Mittelmeer durch den Abschluss verschiedener Handelsabkommen ab, die ihnen Eigengerichtsbarkeit zubilligten,[5] doch insgesamt ging der Handel durch italienische Kaufleute im östlichen Mittelmeerraum zurück und die Italiener verlagerten ihren Schwerpunkt nach Nordeuropa und auf die Iberische Halbinsel.[6] Immerhin entwickelte sich aus den Abmachungen mit dem Osmanischen Reich eine ganz eigene Variante von Handelsabkommen. Die in der Frühen Neuzeit so genannten Kapitulationen wurden mit außerhalb des europäischen Rechtskreises stehenden, den bis zum 19. Jahrhundert als »pays hors de chrétienité« bezeichneten Staaten, abgeschlossen.
Die zunächst von orientalischen Herrschern als einseitige Privilegiengewährung verstandenen Abkommen nahmen mit der Zeit den Charakter völkerrechtlich bindender Verträge an.[7] Insbesondere der Vertrag zwischen Frankreich und dem Osmanischen Reich von 1535 / 941 (nach islamischer Jahreszählung)[8] gilt als grundlegend für die Entwicklung der Kapitulationen. Zentraler Bestandteil des Vertrages war die Eigen- oder Konsulargerichtsbarkeit, welche die zum Teil großen Unterschiede zwischen christlicher und moslemischer Rechtsauffassung überbrücken helfen sollte und so den Handel zwischen verschiedenen Kulturen erst ermöglichte. Auf Grundlage dieses Abkommens, das zu Lebzeiten Suleimans des Prächtigen Gültigkeit behalten sollte,[9] und einiger bestätigender Folgeabkommen nahm Frankreich das Schutzrecht für die Katholiken innerhalb des osmanischen Staatsgebiets in Anspruch, ein Recht, das es ab 1617 mit Österreich teilte. Die weitestreichende Kapitulation wurde zwischen Frankreich und dem Osmanischen Reich 1740 geschlossen.[10] Sie sollte auf ewig gelten und räumte dem französischen Gesandten Vorrang vor seinen europäischen Kollegen ein. Wenngleich dieser Vertrag der letzte war, der als Kapitulation bezeichnet wurde, diente er zahlreichen Folgeverträgen europäischer Mächte mit nicht-christlichen Staaten als Vorbild. Denn ähnliche Probleme stellten sich nicht nur im Austausch mit dem Islam, sondern auch mit dem Fernen Osten, und sogar innerhalb Europas kam es nach der Reformation zu ähnlichen Fragestellungen. Doch während die Kapitulation noch bis ins 18. Jahrhundert durchaus als ein Rechtsinstrument angesehen werden kann, das man im Bemühen entwickelte, die Gräben zwischen unterschiedlichen Rechtsauffassungen zu überbrücken und so den Handel zwischen Ost und West erst zu ermöglichen, verkam die Vertragsform im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr zu einem Instrument des informellen Kolonialismus.[11]
39
4. Der Handelsaufschwung zu Beginn des 16. Jahrhunderts
Insgesamt nahm der Fernhandel zu Beginn der Frühen Neuzeit aufgrund verschiedener sich gegenseitig verstärkender Umstände zu. Technologische Verbesserungen[12] im ausgehenden 15. Jahrhundert hatten zu einer Diversifikation der Tuchproduktion in Europa geführt, so dass sich die Nachfrage nach Rohstoffen für diesen Wirtschaftszweig erhöhte. Der wirtschaftliche Aufschwung sorgte für frei werdende bäuerliche Arbeitskraft, die in den städtischen Produktionszyklus miteinbezogen werden konnte, und vergrößerte die Konsumentenschar. Dazu kam eine Änderung der Kleidungssitten, so dass verstärkt leichtere und billigere Tuche oder Baumwollstoffe nachgefragt wurden. Schließlich sorgte die europäische Expansion für neue Rohstoffe und neue Konsumenten.
Die Produktion zwischenstaatlich vermarktbarer Güter, die zum Einen breite Bevölkerungsschichten mit Lohnarbeit, zum Anderen über den Fernhandel die entstehenden Staaten mit Einnahmen in Form von Zöllen und Abgaben versorgte, entwickelte sich zum ökonomischen Rückgrat der jungen europäischen Territorialstaaten. Das bedeutete, dass sowohl der Ankauf von im eigenen Land nicht herstellbaren Rohstoffen als auch der Absatz der fertigen Produkte in einem im Vergleich zum Mittelalter weitaus größeren Ausmaß gesichert werden musste. Gerade in den so genannten Handelsnationen entschied die Sicherung der Handelsverbindungen über die Machtposition von Fürsten und Souveränen und entwickelte sich so zur Voraussetzung für die Wahrnehmung von Gestaltungsspielräumen in der Politik.[13] Das erklärt die Zunahme der Zahl der Handelsverträge und ihre Verfeinerung als diplomatisches Instrument im Verlauf der Frühen Neuzeit.
40
So ist es auch kein Zufall, dass Frankreich über die bereits erwähnte Kapitulation mit dem Osmanischen Reich 1535 versuchte, die italienische Vorherrschaft im Levantehandel aufzubrechen. Denn das aufstrebende Osmanische Reich fragte europäische Produkte nach und versorgte im Gegenzug Europa mit begehrten Rohstoffen und Gewürzen aus der Levante und Südostasien.[14] Doch der Vertrag zwischen Franz I. und Suleiman II. dem Großen ging über die Bedeutung für den Handel hinaus. Begleitet wurde er nämlich durch ein Bündnis, das gegen den Kaiser gerichtet war, und so mag dieses Vertragswerk nicht nur beispielgebend für ein Abkommen mit nicht-christlichen Staaten gewirkt haben, sondern auch für die enge Verquickung zwischen Politik und Kommerz. Wenngleich diese Verträge wegen der osmanischen Bedrohung der europäischen Vorposten im östlichen Mittelmeer Europa skandalisierten, hielt dies zahlreiche andere Staaten nicht davon ab, in der Folge ähnliche Verträge mit dem Osmanischen Reich oder mit dessen nordafrikanischen Vasallen zu schließen.[15]
Obwohl sich auch innerhalb des christlichen Europas der Handelsvertrag in etwa zeitgleich zu den bereits beschriebenen Abkommen mit den »Pais hors de la Chrétienté« ausbildete, nahm er doch eine geradezu entgegengesetzte Entwicklung. Denn aufgrund der erstarkenden Staatsgewalt wurde das Personalitätsprinzip des Rechtes zugunsten des Territorialitätsprinzips nach und nach beseitigt und alle Fremden dem Handelsrecht und der eigenen Gerichtsbarkeit unterworfen. Es gab zwar immer wieder Versuche, Sonderrechte und Sondergerichtsbarkeit gegenüber einem schwächeren Vertragspartner durchzusetzen, doch im Laufe des Ringens um ein Mächtegleichgewicht verschwanden auch diese Ansätze. Über diese Beschneidung von Rechten konnte der Handel gerade wegen des Abschlusses eines Handelsvertrags (oder von Handelsartikeln in einem Friedens- oder Bündnisvertrag) behindert oder zugunsten politischer Ziele umgesteuert werden.
41
So bedeutete beispielsweise der 1489 zwischen Kastilien und England geschlossene Vertrag von Medina del Campo, der den jeweils fremden Kaufleuten die Beachtung der lokalen Gesetze und Abgaben vorschrieb, de facto die Abschaffung einiger Privilegien spanischer Kaufleute. Deren Hauptgeschäft mit den britischen Inseln war jahrzehntelang die Einfuhr französischen Waids gewesen. Eine englische Navigationsakte ebenfalls aus dem Jahr 1489 behielt die Einfuhr von Waid aus Toulouse heimischen Schiffen vor, eine Regelung, die auf den Ausbau der bis dahin eher schwachen englischen Handelsflotte abzielte. So fanden die spanischen Kaufleute kaum englische Schiffe, um ihre Geschäfte weiterzuführen. Ihre starke Stellung in London ging zurück.[16] Die Auseinandersetzungen zwischen Spanien und Frankreich in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts verdeutlichen die besondere Bedeutung der englischen Allianzpolitik für die Auseinandersetzungen auf dem Kontinent, die immer wieder gegen ökonomische Zielsetzungen abgewogen werden mussten – ein Handlungs- und Diplomatiemuster, das für die meisten europäischen Staaten in der Frühen Neuzeit mit wechselnden Besetzungen prägend blieb. Zum Einen spielte England eine zentrale strategische Rolle für die spanische Kriegsführung gegen Frankreich, zum Anderen fürchteten die Spanier im Falle der englischen Neutralität den Verlust der eigenen Handelsverbindungen. Als nach dem Eintritt Ferdinands von Aragón in die Heilige Liga England die Neutralität bewahrte, wiesen die Katholischen Könige ihren Botschafter in England an, auf eine Entscheidung hinsichtlich eines Vertragsabschlusses beziehungsweise der Ratifizierung von Medina del Campo zu dringen, da neutrale englische Kaufleute den Spaniern den Handel mit Frankreich aus der Hand nähmen. Je länger dieser Zustand dauerte, umso mehr schädigte das nicht nur die spanischen Kaufleute, sondern nützte auch den englischen, so dass man dort in Zukunft einen endgültigen Vertrag noch weiter hinauszögern würde.[17]
Als Beispiel für einen Handelsvertrag zwischen zwei Handelspartnern mit relativ einfachen, bilateralen Austauschbeziehungen und gleichgerichteten Interessen auf beiden Seiten kann der so genannte Magnus Intercursus von 1496 zwischen den Niederlanden und England gelten. Prägend für den wirtschaftlichen Austausch zwischen den beiden Gebieten war gegen Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts vor allem der Export ungefärbten Tuches aus England, das in Flandern veredelt wurde. Der Magnus Intercursus gab dieser Austauschbeziehung einen rechtlichen Rahmen und blieb trotz kleinerer Streitigkeiten und Zusatzverträgen in den Jahren 1506 und 1515 bis zum Einfuhrstopp von 1563 in Kraft, als der Aufstand der niederländischen Nordprovinzen das Verhältnis zwischen England und den inzwischen Spanischen Niederlanden nachhaltig veränderte.
42
5. Der Handelsvertrag als diplomatisches Instrument
Die Nutzung von Handelsverträgen als diplomatisches Instrument, dessen Bedeutung über den ökonomischen Zweck weit hinausging, kann beispielhaft am wechselhaften Schicksal der portugiesischen Staatlichkeit und ihrer Bündnispolitik ermessen werden, die vor allem über den Handel gesteuert wurde. Aufgrund der frühen Expansion des Landes bei gleichzeitig relativ geringer eigener Größe und Einwohnerzahl waren Portugals Entdeckungen und Seehandel immer von der Präsenz ausländischer Kaufleute abhängig. Sie sorgten für die nötige Kapitalzufuhr, für den Import von in Afrika und später in Asien und Amerika verhandelbaren Produkten sowie für den Export der überseeischen Güter in die europäischen Länder. Bis zur Thronunion mit Spanien konnte diese Notwendigkeit in althergebrachter Weise, nämlich über die Vergabe von Privilegien und Lizenzen geregelt werden. Zu Diskussionen kam es erstmals, als der bereits erwähnte Aufstand der Niederländer die Welthandelsstadt Antwerpen beeinträchtigte, so dass die nordwesteuropäischen Kaufleute gezwungen waren, für den Ankauf der begehrten außereuropäischen Produkte die überseeischen Häfen selbst anzulaufen und die portugiesischen Monopole zu verletzen –[18] mit dem Argument, dass die Freizügigkeit des Handels auch außereuropäische Territorien einschließe. Allerdings gingen diese gegen Portugal gerichteten Handelsargumente spätestens nach der Thronunion mit Spanien 1580 im größeren Kampf der Niederländer, Engländer und Franzosen gegen Spanien und das Haus Habsburg auf. Wo immer man Spanien in Übersee treffen konnte, betraf das nun auch eigentlich portugiesisches Hoheitsgebiet, so dass sich zum Beginn des portugiesischen Unabhängigkeitskampfes 1640 mehrere von Portugal reklamierte Besitzungen in den Händen vor allem von Niederländern und Engländern befanden.[19]
Für die Erringung und Bewahrung seiner Unabhängigkeit blieb Portugal, zumindest bis zu deren endgültiger Anerkennung durch Spanien im Jahr 1667 immer von ausländischer diplomatischer und militärischer Unterstützung abhängig. Da ein Bündnis mit Portugal für den Vertragspartner wenig militärische Unterstützung versprach, war man nur gegen Handelskonzessionen bereit, sich für die portugiesische Sache stark zu machen. Zwangsläufig konnten hierfür keine Einzelprivilegien genügen; der Handel avancierte zur völkerrechtlichen Verhandlungsmasse, der nicht allein bi- oder multilaterale Austauschbeziehungen regelte, sondern als diplomatisches Instrument im Ringen der Staaten um die europäische Vorherrschaft genutzt wurde. Obwohl die portugiesischen Überseegebiete vor allem durch die holländische Seemacht angegriffen wurden, erschienen die Generalstaaten durch ihren anhaltenden Kampf um ihre Unabhängigkeit von den spanischen Habsburgern als natürliche Verbündete im Kampf um die portugiesische Unabhängigkeit. So schlossen beide Länder im Juni 1641 einen Handelsvertrag, den sie mit einem Waffenstillstand in Übersee und einem Beistandspakt in Europa verbanden. In diesem Abkommen akzeptierte die portugiesische Seite erstmals, wenn auch nur vorläufig, niederländische Kolonien und Handelsposten in von Portugal reklamierten Gebieten und tauschte dagegen militärische Unterstützung in Europa.[20]
43
Neben den Generalstaaten boten sich noch weitere mit den Habsburgern verfeindete Mächte an, die portugiesische Unabhängigkeit zu unterstützen. Spanien begleitete seine militärischen Auseinandersetzungen mit Handelsembargos, in der Annahme, dass vor allem die über Spanien und Portugal gehandelten Überseeprodukte entscheidend im Kampf um wirtschaftliche Vorherrschaft waren. Für Spaniens Feinde lag es daher nahe, die spanischen Embargos über die Anerkennung des Herzogs von Bragança im Tausch gegen Handelsrechte in Portugal aufzubrechen. So vereinbarte Frankreich mit Portugal eine Allianz, die, wenn auch recht allgemein formuliert, die Etablierung des Handels wie vor der Thronunion vorsah. Nur wenig später schloss Schweden einen Handelsvertrag mit Portugal, der gegenseitige Handelsfreiheiten gewährte. In Artikel 15 dieses Abkommens vereinbarte man sogar Eigengerichtsbarkeit bei Streitigkeiten der jeweils fremden Gruppe untereinander.[21] Doch nicht nur Auseinandersetzungen mit Spanien veranlassten die europäischen Staaten zur Unterstützung der portugiesischen Sache. Die durch den portugiesisch-niederländischen Vertrag eröffnete Möglichkeit der friedlichen Nutzung der eigenen Kolonien durch die Niederländer rief deren ärgste wirtschaftliche Rivalen auf den Plan. Trotz günstiger Handelsverträge mit Spanien war es den Engländern bis dahin nicht gelungen, ein Abkommen über außerhalb Europas liegende Gebiete zu erzielen, weder eine Anerkennung dieser Gebiete, noch die Erlaubnis über den Unterhalt legaler Handelsverbindungen mit diesen Gebieten. So schloss Karl I. von England mit dem Herzog von Bragança im Jahre 1642 ebenfalls ein Abkommen, in dem ihm althergebrachte Handelsprivilegien zugestanden wurden.[22]
44
Die Bedeutung der Abkommen ging für alle Unterzeichnenden dieser bilateralen Vertragsserie weit über den Handel hinaus. Für Johann von Bragança zählte zunächst die förmliche Anerkennung als Johann IV. von Portugal, ein Titel, der ihm im- oder explizit[23] von seinen Vertragspartnern durch die Intitulatio der Verträge gewährt wurde. Für alle Vertragspartner gemeinsam bedeutete ein blühender Handel mit Portugal neben dem direkten Zugriff auf Überseeprodukte eine Schwächung der spanischen Macht, über diesen Zugriff mit zu entscheiden. Die Vereinigten Provinzen der Niederlande konnten vor allem ihre brasilianischen Kolonien nur unter friedlichen Bedingungen wirtschaftlich ausbauen. Bei aller Vorherrschaft im europäischen (Welt-)Handel hatten die spanischen Embargos die niederländischen Handelstätigkeiten stark beeinträchtigt und große Teile des Zwischenhandels auch mit Kolonialprodukten waren von den Engländern übernommen worden.[24] Das portugiesisch-niederländische Abkommen lief nun vor allem englischen Interessen entgegen. England befand sich mit Spanien im Frieden und hatte bereits seit dem Ende des niederländisch-spanischen Waffenstillstands 1621 weite Teile des europäischen Handels mit der Iberischen Halbinsel übernehmen können. Der Vertrag zwischen den Vereinigten Provinzen und Portugal erlaubte nun nicht nur den Niederländern die freie Einfuhr von Zucker aus ihren brasilianischen Kompanien, er verpflichtete Portugal auch, bei eigenem Mangel niederländische Schiffe für den Brasilienhandel zu mieten oder zu kaufen und vereinbarte eine vorläufige Besitzstandswahrung aller Kolonien. Damit wurde den Niederländern erlaubt, Kolonialwaren zu günstigeren Konditionen zu importieren, als die Engländer sie in ihrem erneuerten Handelsvertrag mit Spanien von 1630[25] erhalten hatten, ein Umstand, der dem englischen Handel nachhaltig schaden musste.[26] Allerdings befand sich England mit Spanien im Frieden und eine Anerkennung eines von Spanien als Rebellen betrachteten Fürsten als König von Portugal hieß, diesen Frieden zu brechen, was wiederum die von Spanien zugestandenen Handelsverbindungen aufs Spiel setzte. Auf der anderen Seite befand sich Karl I. von England durch den englischen Bürgerkrieg selbst in desolater politischer Lage. Ihm musste bewusst sein, dass eine Anerkennung des Bragançaherzogs als König von Portugal zwangsläufig zur Verärgerung seines spanischen Verbündeten führen würde, doch der englische König war sich wohl darüber im Klaren, dass Spanien ihm nicht unter allen Umständen das Königtum zu garantieren gewillt war, und dass es aufgrund der eigenen innenpolitischen Lage dazu auch gar nicht in der Lage war. Für den Augenblick konnte die spanische Politik gegen die Anerkennung weder militärisch noch politisch etwas unternehmen.[27] Hinzu kam, dass die prospanischen Kräfte am englischen Hof im Laufe des Jahres 1641 an Boden verloren. Die Aufnahme von Verhandlungen mit Portugal entsprach folglich der innerenglischen Machtverschiebung zu Ungunsten der Spanier.[28] Außerdem kann der Vertrag mit Portugal als der Versuch Karls I. gewertet werden, sich indirekt die Unterstützung sowohl kolonialunternehmerischer Kräfte, die eng mit seinen Gegnern im Parlament zusammenarbeiteten, als auch die der alten Kaufmannseliten zu sichern. Dass er sich für seine innenpolitischen Auseinandersetzungen Hilfe von Portugal erwartete, ist eher unwahrscheinlich; die aufständischen Portugiesen waren mit der Sicherung ihrer Macht beschäftigt. Die eher schwache Machtposition der englischen Seite zeigt sich schließlich in der Formulierung des Vertrages. Die Engländer erhielten zwar einen Artikel, der ihnen erlaubte, auch kriegswichtige Waren nach Kastilien zu transportieren sowie eine Meistbegünstigungsklausel, die ihren Status recht allgemein demjenigen der Holländer anpasste, doch konnte man keine Zugeständnisse hinsichtlich außereuropäischer Territorien erringen. Sowohl die Verhandlungen über Ostindien als auch diejenigen über Afrika wurden vertagt.[29]
Ebenso wenig konnten die Portugiesen verpflichtet werden, bei eigenem Mangel englische Schiffe für die Brasilienflotte zu pachten, das Privileg, das man den Holländern eingeräumt hatte. Hierüber sollte eine noch zu ernennende Kommission abschließend verhandeln. Steuer- und Zollsätze wurden mit keinem Wort in dem Vertrag erwähnt. Die Artikel über religiöse und kaufmännische Freiheiten wurden im Wesentlichen den Vereinbarungen zwischen Spanien und England von 1604 beziehungsweise früheren englischen Privilegien in Portugal nachempfunden.
45
6. Der Handelsvertrag als innen- und außenpolitisches Kampfmittel
Bereits dieses etwas ausführlichere Beispiel weist darauf hin, dass Handelsverträge im 17. Jahrhundert aufgrund der politischen Umbrüche in Europa an Komplexität gewannen. Gleichsam als Gegenbeispiel, für das Scheitern starker Handelspositionen ohne staatliche Verdichtung, lässt sich die Hanse anführen. Denn immer weniger tolerierten die europäischen Staaten fremde Verpflichtungen und darüber hinaus besaß die Hanse für die europäischen Mächte im 17. Jahrhundert kaum noch politisches Gewicht.[30] So gelang der Hanse zwar noch der Abschluss eine Reihe von Handelsverträgen, doch diese konnten kaum mit darüber hinaus weisenden Zielen kombiniert werden.[31]
Wo z.B. der Magnus Intercursus, wenngleich als bilateraler völkerrechtlicher Vertrag verfasst, einfache, klar strukturierte Austauschbeziehungen regelte und über 60 Jahre Gültigkeit behalten sollte, gestalteten die staatliche Verdichtung der verschiedenen Herrschaftsgebiete zu Territorialstaaten, ihre wachsende dynastische Verflechtung untereinander und der Kolonialhandel, der in seinem Ausgangsmoment von den Iberischen Staaten reklamiert wurde, die Handelsbeziehungen der europäischen Staaten völlig um. Denn zum Einen führte die Diversifikation des Handels zur Herausbildung verschiedener Interessengruppen innerhalb eines Staates, so dass ein Handelsvertrag über den Umweg des europäischen Bündnissystems beinahe automatisch eine bestimmte Gruppe bevorzugte beziehungsweise einer anderen schadete. So schadete im oben genannten Beispiel der englische Vertrag mit Portugal von 1642 Englands alt eingesessenen Merchant Adventurers, die mit den Spanischen Niederlanden ihren Handel trieben, während er den neuen Kräften des kolonialen Unternehmertums, deren Ziel die Brechung des spanischen Monopolsystems sein musste, nutzte. Denn tatsächlich führten der oben genannte Vertrag und weitere Folgeverträge zu Schwierigkeiten für englische Kaufleute in den Gebieten der spanischen Habsburger. Dazu kam, dass Handelsverträge zwischen völkerrechtlich gleichberechtigten Partnern auf Gegenseitigkeit abzielten. Den wirtschaftspolitischen Anschauungen aller europäischen Staaten gemein war jedoch das Abzielen auf eine positive Handelsbilanz. Diese versuchte man vor allem durch den Schutz der heimischen Industrien zu erlangen, was dem Abschluss von Handelsverträgen zum Teil diametral entgegen stand. So ersehnten beispielsweise englische Tuchweber und -händler das Öffnen des französischen Marktes über einen Handelsvertrag mindestens ebenso stark, wie es die Unternehmer der noch jungen Seidenindustrie aus Angst vor der übermächtigen französischen Konkurrenz fürchteten. Das Ringen um den Ausgleich derartig entgegengesetzter Interessen innerhalb der verschiedenen Staaten bestimmte lange Zeit die polit-ökonomischen Diskussionen um den Abschluss von Handelsverträgen. Noch dazu sah man außenpolitische Stärke aus einer starken internationalen Handelsposition entspringen. Ziel zahlreicher Handelsvereinbarungen war folglich nicht das Durchsetzen freihändlerischer Ideen, sondern eine optimale Positionierung der eigenen Kaufleute auf den internationalen Märkten. Als optimal galt nicht ein für alle möglichst freizügiges System, sondern die Besserstellung gegenüber anderen »nationalen« Gruppierungen.
46
Dies erklärt zum Teil die komplizierten, detailreichen Regelungen einzelner Handelsartikel. Denn um über einen Handelsvertrag auszuschließen, dass andere Kaufleute als die eigenen über einen in der Zukunft abzuschließenden Vertrag mit einem Drittstaat auf einem bestimmten Markt besser gestellt würden, hatte sich die Meistbegünstigungsklausel entwickelt. Sie sollte dem Vertragspartner die gleichen Vorteile wie dem meistbegünstigten Vertrags- beziehungsweise Handelspartner sichern. So waren in den spanischen Handelsabkommen mit den Vereinigten Provinzen 1648 und mit Frankreich 1659 jeweils Meistbegünstigungsklauseln vereinbart worden. Als nun England 1667 seinen Handel mit Spanien auf eine neue Vertragsgrundlage stellte, musste es darum gehen, sich gegenüber den niederländischen und französischen Konkurrenten Vorteile zu verschaffen. Man verfiel darauf, über eine durch die spanischen Behörden kaum korrekt durchsetzbare Zollabwicklung dem englischen Schmuggel Tür und Tor zu öffnen. Denn während öffentlich angeschlagene Zollsätze für die Kaufleute aller Nationen relativ leicht vergleichbar waren, eröffneten sich die Vorteile bei der Zollabwicklung nicht jedwedem Beobachter.[32] In der Praxis standen nicht jedem Kaufmann die Vertragstexte zur Verfügung.
In der Folge der Zunahme von Handelsvereinbarungen entwickelten die frühneuzeitlichen europäischen Staaten ein ausgeklügeltes und phantasievolles System nichttarifärer Handelshemmnisse zur Umgehung einzelner Artikel. Unterband ein Handelsvertrag die Erhebung prohibitiver Zollsätze oder den Erlass von Einfuhrverboten, rekurrierten die frühneuzeitlichen Staaten oftmals entweder auf den Seuchenschutz, der den Zutritt von Waren aus bestimmten Gegenden unterband[33] oder auf die Luxusgesetzgebung, die über das Verbot des Konsums bestimmter Waren die wirtschaftliche Entwicklung zu steuern suchte. Während im 15. und 16. Jahrhundert diese Art Gesetzgebung noch das vom Souverän als schädlich angesehene Durcheinandergeraten der Stände verhindern sollte, erhielt sie im 17. und 18. Jahrhundert eine rein wirtschaftliche Ausrichtung.[34]
47
So geht der wohl bekannteste, weil prägnanteste Handelsvertrag der Frühen Neuzeit auf eine derartige Luxusgesetzgebung zurück. England hatte sich im Zuge des portugiesischen Kampfes um die Unabhängigkeit im Handelsvertrag von 1654 und Heiratsvertrag von 1661[35] hervorragende Handelsmöglichkeiten am portugiesischen Markt gesichert und Portugal nahm vor allem englisches Tuch für den iberischen und amerikanischen Markt ab. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts begann die merkantilistisch ausgerichtete portugiesische Administration, eine heimische Tuchproduktion aufzubauen und schützte diesen aufkeimenden Wirtschaftszweig über besagte Luxusgesetzgebung, denn Zollhöhen beziehungsweise ein Verbot der Zollerhöhung ohne englische Zustimmung waren im Vertrag von 1654 festgelegt worden. Gleichzeitig litt das portugiesische Hauptexportgut Wein auf dem englischen Markt unter der französischen Konkurrenz, der zum Einen geschmacklich bevorzugt wurde, zum Anderen niedrigeren Zollsätzen sowie günstigeren Frachtraten unterlag. Die Förderung des Zuckeranbaus auf niederländischen, französischen und englischen Plantagen verschärfte das Problem einer negativen portugiesischen Handelsbilanz ebenso, wie sie englische Kaufleute um ihre Position am portugiesischen Markt insgesamt fürchten ließ.[36] Als die Alliierten in den Auseinandersetzungen des beginnenden Spanischen Erbfolgekriegs Portugal über ein Bündnis aus der Allianz mit Frankreich und Spanien lösten, begleitete der englische Verhandlungsführer Methuen diesen Vertrag deshalb mit einem Handelsabkommen. In zwei knappen Artikeln wurde vereinbart, die Tucheinfuhr aus England wieder zuzulassen, wie zu jener Zeit, bevor die entsprechende Pregmática den Import verboten hatte. Dagegen verpflichtete sich die englische Seite, für die Einfuhr portugiesischen Weins ein Drittel weniger Steuern als für französischen zu erheben. Sollte diese Regelung jemals verletzt werden, stünde es den Portugiesen frei, die Einfuhr englischen Tuchs erneut zu untersagen.
Dieser Vertrag wird ob seiner Prägnanz als der exakteste und bekannteste Wirtschaftsvertrag der Frühen Neuzeit, wenn nicht aller Zeiten, angesehen. Gleichzeitig ist wohl kaum ein Vertrag in der polit-ökonomischen Literatur so umstritten. Während der Vertrag für die einen als »Meisterstück scheinheiliger Gaunerei«[37] des englischen Handelsbürgertums gilt – ein Diktum, das vor allem von Marxisten und Dependenztheoretikern, aber auch von der nationalistischen portugiesischen Geschichtsschreibung gerne aufgenommen wurde –,[38] sehen eher der klassischen Tradition verbundene Wissenschaftler die Vorteile zu gleichen Teilen auf beiden Seiten. Adam Smith wähnte die Vorteile des Vertrages sogar allein auf portugiesischer Seite, hatten die Engländer doch von nun an Wein zu konsumieren, der ihnen nicht schmeckte, teurer war und von weiter her als der französische gebracht werden musste. Das Beispiel des Austauschs von Wein gegen Tuch zwischen Portugal und England diente Ricardo schließlich ein halbes Jahrhundert später zur Entwicklung seiner Theorie der komparativen Kostenvorteile, die bei derartig gelagerten Handelsbeziehungen Gewinner auf beiden Seiten ausmacht.
48
7. Der außereuropäische Handel
Eine gesonderte Betrachtung verdient sicherlich der Komplex des außereuropäischen Handels und dessen Regelung im europäischen Vertragswesen. Nachdem Portugiesen und Spanier nach der Absegnung ihrer Einflussgebiete durch den Papst ihre Handelsmonopole postuliert und administrativ umgesetzt hatten, blieb der Handel mit den außereuropäischen Gebieten Kastiliern und Portugiesen vorbehalten, die gezwungen waren, ihre Handelstätigkeiten über Sevilla beziehungsweise Lissabon abzuwickeln.[39] Neben den Monopolverletzungen aufgrund der Ausweitungen der kriegerischen Auseinandersetzungen auf Kolonialgebiete drängten natürlich mit den erstarkenden Handelsflotten auch Angehörige von mit den Iberern in Frieden lebenden Staaten auf die außereuropäischen Märkte. Während in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kaum die Notwendigkeit bestand, Überseegebiete in europäische Friedensschlüsse mit einzubeziehen, fand man später in mündlichen Vereinbarungen zwischen Spanien und Frankreich eine Formel, die den Frieden auf europäisches Gebiet begrenzte und jenseits gedachter Linien, die mehrmals neu bestimmt wurden, das Recht des Stärkeren entscheiden ließ. Seit 1634 hatte sich weitgehend die von Kardinal Richelieu gezogene Linie durchgesetzt, die entlang des alten Nullmeridians durch die kanarische Insel Ferro lief.[40] Dazu trat in einigen Verträgen die Regelung, die Schifffahrt in außereuropäische Gebiete »in uso e observancia«, d. h. nach Gebrauchsrecht zu gestatten, wobei es für die Erschließung neuer Anlaufplätze theoretisch der Gegenseite überlassen blieb, zu beweisen, dass vor dem zuletzt geschlossenen Vertrag bereits ein Untertan des eigenen Staates den betreffenden Platz angelaufen hatte. In der Praxis fuhr Spanien allerdings fort, je nach Kräfteverhältnis Seefahrer im spanischen Herrschaftsbereich wegen Piraterie zu verfolgen. Andererseits argumentierten auch die Spanier je nach Bedarf mit dem Argument des »no peace beyond the line«. Nachhaltig aufgeweicht wurde dieses Prinzip mit dem bereits erwähnten zehnjährigen Waffenstillstand zwischen Portugal und den Niederlanden von 1641 und vor allem mit dem Westfälischen Frieden, in dem Spanien die holländischen Überseegebiete anerkennen musste. In Nachfolge der Niederländer gewannen jedoch im Laufe des 17. Jahrhunderts auch Engländer, Franzosen, Dänen, Schweden und sogar Brandenburger Stützpunkte in Afrika, Amerika oder Asien und alle bemühten sich, den Handel mit diesen Stützpunkten oder Kolonien ihren eigenen Untertanen zu reservieren. Schlechterdings konnte ab dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Konsolidierung der eigenen Kolonien von Spanien (und Portugal)[41] und später allen Kolonialmächten nicht mehr die Aufhebung des Handelsmonopols gefordert werden, ohne aufgrund des Prinzips der Gegenseitigkeit sein eigenes zu gefährden. Hinzu kam, dass man über den Mechanismus der Meistbegünstigungsklausel die Konkurrenz von Dritten fürchtete. Gleichzeitig musste aber wegen der scharfen Konkurrenz zwischen den Seemächten jede Anerkennung außereuropäischer Gebiete durch Spanien und Portugal beinahe schon zwangsläufig Bemühungen Dritter nach sich ziehen, ihre Beziehungen mit den Kolonialmächten neu zu ordnen.
49
Diese Zusammenhänge verliehen einzelnen Handelsmonopolen eine besondere Bedeutung, vor allem dem so genannten Asiento de Negros. Mit dem Verlust Portugals hatte Spanien wegen mangelnder eigener Handelsstützpunkte in Afrika den Zugriff auf schwarze Arbeitskräfte verloren, so dass die Erlaubnis zur Versorgung Spanisch Amerikas mit diesen Arbeitskräften, der Asiento de Negros, zum umkämpften Monopol unter Europas Handelsnationen avancierte. Zunächst vergab die spanische Krone den Asiento an einzelne Handelshäuser, die mit den europäischen Überseekompanien Verträge über Lieferkontingente abschlossen. Aufgrund der Vormachtstellung der Holländer im interkontinentalen Handel blieb es über weite Teile des 17. Jahrhunderts der niederländischen Westindienkompanie (WIC) vorbehalten, das Gros der Sklaven von Afrika nach Spanisch Amerika zu liefern. Gegen Ende des Jahrhunderts verfiel die Vormachtstellung der WIC etwas und so belieferten in den 1690ern Niederländer, Engländer, Franzosen und kleinere Händler gemeinsam die portugiesische Companhia de Cacheu, die zwar seit 1696 den Asiento hielt, selbst aber kaum in der Lage war, die im Kontrakt vereinbarte Anzahl an Sklaven zu liefern. Nach der Besteigung des spanischen Throns durch Philipp von Anjou wurde 1703 der Asiento de Negros den Franzosen überschrieben. Die Vereinbarung schloss kategorisch jede andere Nation von dem Handel aus und reservierte den Franzosen zudem das Recht, alle amerikanischen Waren als Bezahlung zu akzeptieren und diese auch außerhalb der Westindienflotte nach Europa zu transportieren. Das gefährdete nicht nur den mühsam mit Spanisch-Amerika aufgebauten legalen oder illegalen Direkthandel der Seemächte, sondern auch den Handel mit Spanien. Die Engländer ließen sich beispielsweise den Absatz ihrer Tuchwaren in Spanien mit amerikanischen Waren bezahlen, ebenso wie sie jahrzehntelang von den französisch-spanischen Auseinandersetzungen profitiert hatten, indem sie die in Amerika und für die Seefahrt unabdingbare französische Leinwand nach Spanien lieferten. Die französisch-spanische Vereinbarung ließ die übrigen Mächte nachhaltig um ihre durch Amerika erweiterten Absatzmärkte in Spanien fürchten. So erhielt der Asiento de Negros nicht nur für den Ausbruch des Spanischen Erbfolgekriegs eine große Bedeutung, eine wichtige Rolle sollte er auch auf den Friedensverhandlungen zu Utrecht spielen.
50
Im März 1713 unterzeichnete der spanische König einen neuen, von den Briten entworfenen Asiento de Negros, der das Recht auf die Belieferung Amerikas mit Sklaven erstmals in den Rang eines Staatsvertrags erhob. Eine Verletzung der Rechte der Vertragsnehmer, d.h. der englischen South Sea Company, würde in Zukunft dem Bruch eines zwischenstaatlichen Vertrages gleichkommen, dessen Erfüllung zwei Monarchen durch ihre Unterschrift garantierten. Neben der Belieferung Amerikas mit Sklaven gestattete man den Asentisten, jährlich ein Schiff von 500 Tonnen mit europäischen Waren zu beladen und zu Messezeiten in Amerika zu verkaufen, da man, wie es hieß, um die hohen Verluste wusste, die ein Asiento de Negros gemeinhin mit sich brachte. Damit verschaffte sich Großbritannien Zutritt zum spanischen Monopolsystem, ohne dass dieses System für alle geöffnet werden musste. Kurioserweise drängten nun die Generalstaaten ihrerseits nicht auf eine Teilhabe, sondern ließen die Beibehaltung des spanischen Monopolsystems in ihrem Friedens- und Handelsvertrag mit Spanien mit der Ausnahme eben jenes Asiento festschreiben.[42] Bei abnehmender Seemacht erschien es der Handelsnation günstiger, den Status quo zu belassen, als über die Abschaffung des Monopols alle Nationen am Überseehandel zu beteiligen. In ihrem Friedensvertrag mit Frankreich vereinbarten die Niederländer, dass die Franzosen keine anderen Handelsvorteile mit Spanien und Spanisch-Amerika in Anspruch nehmen dürften, als diejenigen, die sie zu Zeiten Karls II. besessen hätten oder die, welche allen anderen auch gewährt würden.[43]
Tatsächlich erwies sich vor allem das Recht des annual ship in britischen Augen als lohnenswert, da die Regelung zahlreiche Schmuggelmöglichkeiten eröffnete[44] und immer wieder bemühte sich Spanien, wenn auch vergeblich, um die vorzeitige Aufhebung des Kontraktes, so dass noch im Frieden von Aachen 1748 die Erfüllung der ausstehenden vier Jahre des Vertrages vereinbart wurde.[45]
51
Insgesamt allerdings lässt sich feststellen, dass die Auseinandersetzung um außereuropäische Gebiete von dem spanisch-niederländischen Antagonismus, der vor allem durch den Befreiungskampf der Niederländer motiviert und mit dem Westfälischen Frieden beigelegt wurde, über den Kampf um die Seeherrschaft zwischen den Vereinigten Provinzen und England in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf die Rivalität zwischen Frankreich und England überging, die sowohl politisch als auch ökonomisch ausgetragen wurde. Das hieß in Friedenszeiten von englischer Seite aus eine Politik prohibitiv hoher Zölle gegen französische Waren, während in Kriegszeiten der Handel meist ohnehin unterbunden wurde. Im Friedensvertrag von Utrecht 1713 scheiterte sogar der Abschluss einer Meistbegünstigungsklausel mit Frankreich am Widerstand des von den Whigs beherrschten britischen Parlaments.[46] Selbst in dem ersten, dem Gedanken des Freihandels verpflichteten, britisch-französischen Handelsvertrag von 1786, der die im Vergleich sensationell niedrigen Zollsätze von 10–15 Prozent vereinbarte, nahm man französische Seidenwaren aus den Regelungen aus.
Seit die Vereinbarungen von Utrecht den Engländern einerseits die Stützpunkte Gibraltar und Menorca zur Kontrolle des Mittelmeers und damit des Levantehandels, andererseits den Asiento und somit einen Teil des Direkthandels mit Spanisch Amerika übertragen hatten, warfen die französische Politik und Publizistik den Briten die Zerstörung französischer Handelsmacht vor. So hatte Großbritannien seine führende Stellung im Kolonialhandel im 18. Jahrhundert vor allem gegen Frankreich zu verteidigen, so dass man seit dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts die europäische Politik beider Staaten als Resultat ihres außereuropäischen Antagonismus interpretieren kann.[47] Heinz Duchhardt hat festgestellt, dass das Maß, in dem
»Wirtschafts- und Kolonialfragen das gesamte Staatenleben des 18. Jahrhunderts prägten […] nicht nur an der sprunghaft steigenden Zahl von bilateralen Verträgen mit allein ökonomischer Zweckbestimmung abgelesen werden [kann], sondern beispielsweise auch, daran, in welch starkem Maß nun Handelskompanien in Art von pressure groups auf den Friedenskongressen auftauchten und Wirtschaftsfachleute den Delegationen zu den Friedenskongressen zugeordnet wurden, um dort die kommerziellen bzw. kolonialen Interessen der heimischen Kompanien oder Erzeuger zu vertreten«.[48]
Zwar mag die quantitative Zunahme dieser pressure groups angezweifelt werden, da sie bereits im 17. Jahrhunderts auf ihre Souveräne einzuwirken suchten;[49] in jedem Fall aber verschaffte die Umgestaltung der »nationalen Wirtschaftssysteme«, welche die Interessen der heimischen Wirtschaft stärker mit den Anforderungen eines Kolonialsystems in Einklang brachte, den Forderungen dieser pressure groups eine größere Einstimmigkeit und mehr Durchschlagskraft.[50]
52
Die Entwicklung von der Erteilung körperschaftlicher oder persönlicher Privilegien zur Erleichterung des Handels hin zum Abschluss zwischenstaatlicher Handelsverträge oder der Vereinbarung von Handelsartikeln innerhalb von Bündnis- oder Friedensverträgen nahm in der europäischen Rechtsgeschichte zwei unterschiedliche Wege. Auf der einen Seite entwickelte man mit Rechtsnormen anderer Staatswesen die so genannten Kapitulationen, die stark von Elementen des Fremdenrechts geprägt waren. Das Gewicht dieser Abkommen lag auf der Loslösung der fremden Kaufleute aus den Rechtsnormen des Gastlandes. Wenn die Rechtsordnungen der Vertragspartner in wesentlichen Elementen fundamental von einander abwichen, weil ihr Ursprung zum großen Teil in nicht verhandelbaren religiösen Vorschriften und Vorstellungen lag, dann konnte nur auf diese Weise der wirtschaftliche Austausch gesichert werden; erst im Zeitalter des Imperialismus wurde die Kapitulation vor allem als Instrument eines informellen Kolonialismus genutzt.
Auf der anderen Seite wurde im Vertragsrecht der christlichen Staaten Europas das Personalitätsprinzip des Rechtes zugunsten des Territorialitätsprinzips nach und nach beseitigt und alle Fremden dem Handelsrecht und der eigenen Gerichtsbarkeit unterworfen. Allerdings zielten Handelsabkommen im Verlauf der staatlichen Verdichtung in Europa nicht mehr allein auf die Sicherung des Austauschs nicht herstellbarer Güter, sondern der Handelsvertrag avancierte zu einem von mehreren Instrumenten der Diplomatie, über das neben der Sicherung der Handelsverbindungen Bündnispolitik betrieben, die Rivalität mit Dritten ausgefochten und die Erwirtschaftung einer positiven Handelsbilanz vorangetrieben wurde. Auch heimischen Handelseliten konnten über dieses außenpolitische Instrument Vergünstigungen verschafft oder Privilegien genommen werden.
Der Hanse gelang im 17. Jahrhundert noch der Abschluss von einigen Handelsverträgen mit den wichtigen europäischen Staaten, doch der Städtebund wurde kaum mehr als politischer Machtfaktor wahrgenommen, so dass im 17. Jahrhundert zwar kaum ein wirtschaftlicher Niedergang der Hanse einsetzte, der politische aber besiegelt wurde.
53
Die unterschiedlichen Zielrichtungen von Handelsabkommen führten einerseits zu detaillierten Bestimmungen, mit welchen der Handel bis ins Kleinste geregelt werden sollte, zum Anderen zu einer ganzen Palette von Maßnahmen, mit welchen die Staaten versuchten, über die Auslegung und Umsetzung der Abkommen negative Folgen für die eigene Wirtschaft abzumildern und über die Behandlung der fremden Kaufleute das eigene diplomatische Instrumentarium zu erweitern, ohne einen offenen Bruch zu riskieren.
Neben der staatlichen Verdichtung der europäischen Herrschaftsgebiete spielt der außereuropäische Handel eine herausragende Rolle für die Entwicklung des Handelsvertrags. Denn über die iberischen Monopolsysteme blieb der außereuropäische Handel zunächst dem europäischen nachgeordnet und so konnte es nur über gute Bedingungen am spanischen und portugiesischen Markt gelingen, legal am Überseehandel teilzuhaben. Als ab Mitte des 17. Jahrhunderts die iberischen Staaten gezwungen waren, nach und nach die Besitzungen anderer Mächte in Afrika, Asien und Amerika anzuerkennen, blieb aufgrund der Rivalität der europäischen Staaten untereinander das Monopolsystem das bestimmende Element der Handelsabkommen. Jetzt versuchte man, dieses System zu Abwehr unliebsamer Konkurrenz zu nutzen, während man sich um die Erlangung von Sonderlizenzen und einzelner Handelsmonopole bemühte, wie z.B. um den Asiento de Negros, der Gegenstand mehrerer Abkommen im 18. Jahrhundert wurde.
Handelsverträge schufen also nicht nur Frieden. Sie konnten sich gegen Dritte richten, die eigene Handelsbilanz verbessern helfen, selbst wenn dies dem Prinzip der Gegenseitigkeit diametral entgegen lief, oder auf einen Zweck jenseits des Handel abzielen, wie z.B. auf die politische Unabhängigkeit. Angesichts dieser Mehrdeutigkeit mag die Annäherung an freihändlerische Ideen im französisch-englischen Edenabkommen von 1786 schon fast verwundern oder tatsächlich als ein Sieg makroökonomischer Überlegungen über die europäische Machtpolitik gefeiert werden. Letztlich bleibt auch in heutiger Zeit bei allen Diskussionen um WTO und Freihandel eine Außenhandelspolitik, die Wirtschaftshilfe und Handelsabkommen an politische Bedingungen knüpft, diese Vorgaben aber im Falle ausreichend großer Rivalität mit Drittstaaten bedingungslos beiseite schiebt, nach wie vor zumindest ebenso stark dem Gedanken der Politik wie dem der Ökonomie verhaftet.
54
Azevedo, Lúcio J.: Épocas de Portugal économico, Lissabon 1978.
Barrie, Viviane: La prohibition du commerce avec la France dans la politique anglaise à la fin du XIIème siècle, in: Revue du Nord 59 (1977), S. 343–359.
Bergenroth, Gustav Adolph u.a. (Hg.), Calendar of Letters, Despatches, and State Papers, relating to the negotiations between England and Spain, preserved in the Archives at Simancas and elsewhere, London 1862–1978, Bd. 1–13.
Bisoukides, Perikles: »Kapitulationen«, in: Handwörterbuch der Rechtswissenschaften 3 (1928), S. 485–490.
Braudel, Fernand: Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts. Der Handel, München 1986.
Brazão, Eduardo: Uma Velha Aliança, Lissabon 1955.
Brenner, Robert: Merchants and revolution. Commercial change, political conflict and London’s overseas traders, 1550–1653, Cambridge 1993.
Childs, Wendy R.: El Consulado del mar, los comerciantes de Burgos e Inglaterra, in: Actas del V Centenario del Consulado de Burgos (1494–1994), Burgos 1994, Bd. 1, S. 349–420.
Claro, Joao V.: A aliança inglesa: Historia e fim dum mito, Lausanne 1943.
CSP Spain siehe Bergenroth, Gustav Adolph.
Duchhardt, Heinz: Balance of Power und Pentarchie. Internationale Beziehungen 1700–1785, Paderborn 1997 (Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen 4).
Ders.: Die Hanse und das europäische Mächtesystem des frühen 17. Jahrhunderts, in: Antjekathrin Graßmann (Hg.), Niedergang oder Übergang? Zur Spätzeit der Hanse im 16. und 17. Jahrhundert, Köln u.a. 1998 (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte N.F. 44), S. 11–24.
Elliott, John: A Europe of composite monarchies, in: Past and Present 137 (1992), S. 48–71.
Figueiredo, Fidelino de: Portugal nas guerras europeas, Lissabon 1914.
Flaig, Egon: Der Islam will die Welteroberung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.09.2006, S. 35.
Gupta, Arun Das: The Maritime Trade of Indonesia: 1500–1800, in: Om Prakash (Hg.): European Commercial Expansion in Early Modern Asia, Aldershot 1997 (An expanding World 10), S. 81–116.
Hughes, Paul L. u.a. (Hg.): Tudor Royal Proclamations, New Haven u.a. 1964–1969, Bd. 1–3.
Kahle, Günter: Lateinamerika in der Politik der europäischen Mächte, Köln u.a. 1993.
Kamen, Henry: Spain 1469–1714. A Society in Conflict, New York 1983.
Konetzke, Richard: Süd- und Mittelamerika I. Die Indianerkulturen Altamerikas und die spanisch-portugiesische Kolonialherrschaft, Frankfurt/Main 1965 (Fischer Weltgeschichte 22).
Le Goff, Jacques: Das Hochmittelalter, Frankfurt/Main 1965 (Fischer Weltgeschichte 11).
Ligthart, Henk / Reitsma, Henk: Portugal’s semi-peripheral middleman role in its relations with England, 1640–1760, in: Political Geography Quaterly 7 (1988), S. 353–362.
López Martín, Ignacio: Entre la guerra económica y la persuasión diplomática. El comercio mediterráneo como moneda de cambio en el conflicto hispano-neerlandés (1574–1609), in: Robert Escalier (Hg.), Crises, conflits et guerres en Méditerranée, Nice 2005, Bd. 2 (Cahiers de la Méditerranée 71).
Rau, Virginia: Subsidio para o estudo do movimento dos portos de Faro e Lisboa durante o seculo XVII, in: Anais da Academia Portuguesa da Historia 2, serie 5 (1954), S. 197–277.
Dies.: Privilégios e legislação portuguesa referentes a mercadores estrangeiros (séculos XV e XVI), in: Hermann Kellenbenz (Hg.), Fremde Kaufleute auf der Iberischen Halbinsel, Köln 1970 (Kölner Kolloquien zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1), S. 15–30.
Rymer, Thomas (Hg.): Foedera, conventiones, literae et cuiuscunque generis acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes vel communitates: ab ineunte saeculo duodecimo, videlicet ab anno 1101, ad nostra usque tempora, habita aut tractata; ex autographis, infra secretiores archivorum regiorum thesaurarias, per multa saecula reconditis, fideliter exscripta, Londini 1704–1735, Bd. 1–20.
Sanz, Porfirio: England and the Spanish foreign policy during the 1640s, in: European History Quarterly 28 (1998), S. 291–310.
Schüller, Karin: Einführung in das Studium der iberischen und lateinamerikanischen Geschichte, Münster 2000.
Sombart, Werner: Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, München / Leipzig 1916, Bd. 1–3.
TRP siehe Hughes, Paul L.
Wild, Stefan: Islamwissenschaftler wünschen Sachkunde. Zum Artikel von Egon Flaig »Der Islam will die Welteroberung« (F.A.Z. vom 16. September), in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.09.2006, S. 10.
Weindl, Andrea: Wer kleidet die Welt? Globale Märkte und merkantile Kräfte in der Frühen Neuzeit, Mainz 2007 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 211).
Ziegler, Karl Heinz: The peace treaties of the Ottoman Empire with European Christian powers, in: Randall Lesaffer (Hg.), Peace treaties and international law in European history: from the late Middle Ages to World War One, Cambridge 2004, S. 338–364.
55
[*] Andrea Weindl, Dr., Institut für Europäische Geschichte Mainz, Wiss. Mitarbeiterin im DFG-Projekt »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
[1] Vgl. Bisoukides, Kapitulationen 1928, S. 489.
[2] Vgl. Le Goff, Hochmittelalter 1965, S. 196–198.
[3] 1083 zwischen Byzanz und Venedig, 1112 zwischen Byzanz und Pisa, 1228 und 1251 zwischen Genua und Venedig. Vgl. Bisoukides, Kapitulationen, S. 489. Im Jahr 1157 versprach in einem Vertrag der Scheich von Tunis den Pisanern seinen Schutz und gewährte gewisse Handelserleichterungen.
[4] Verträge mit Genua 1261, 1275, 1352, 1382, mit Pisa 1261, mit dem Osmanischen Reich 1391, mit Ragusa 1451. Vgl. Ebd., Kapitulationen, S. 489.
[5] Im Gegenzug für die bedingungslose Unterwerfung der Genueser und gemäß den Bestimmungen des Korans, nach denen freiwillig Unterworfenen gewisse Freiheiten zu belassen sind, erließ Mohammed II. am Folgetag der Eroberung Konstantinopels ein Dekret, das den Genuesern persönlichen und vermögensrechtlichen Schutz, Handels-, Verkehrs- und Religionsfreiheit gewährte und die Wahl eines Richters erlaubte, der ihre Streitigkeiten schlichten sollte. 1454, 1479, 1502, 1516 und 1534 wurden Verträge ähnlichen Inhalts mit Venedig sowie 1460 und 1513 mit Florenz geschlossen. Vgl. Bisoukides, Kapitulationen, S. 490. Ziegler gibt als Daten der Kapitulationen zwischen dem Osmanischen Reich und Venedig 1479, 1482, 1502, 1540 und 1567 an. Vgl. Ziegler, Peace treaties of the Ottoman Empire, S. 340 f., 345.
[6] Vgl. Braudel, Handel 1986, S. 162–167.
[7] Ziegler weist darauf hin, dass der Sultan in seiner Funktion als Kalif kein Interesse daran hatte, Ungläubige dem islamischen Recht zu unterwerfen. So wurden die Kapitulationen den eigenen Untertanen als herrschaftliche Erlasse oder Privilegien präsentiert, gegenüber den europäischen Mächten als Friedens- und Freundschaftsverträge. Vgl. Ziegler, Peace treaties of the Ottoman Empire 2004, S. 342 u. 345.
[8] Vgl. Friedens- und Allianzvertrag von Konstantinopel 1535 II / 941, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[9] Egon Flaig vermutet, dass sich der Sultan aufgrund der Änderung der Kräfteverhältnisse gezwungen sah, islamisches Recht zu verletzen, das Frieden mit Ungläubigen auf den Zeitraum von höchstens 10 Jahren begrenzte. Allerdings befand sich das Osmanische Reich 1535 noch im Aufschwung und so werden eher außerreligiöse Überlegungen zur Versorgungssicherheit ausschlaggebend gewesen sein. Vgl. Flaig, Islam will die Welteroberung 2006. Zur Debatte um Flaigs umstrittenen Artikel vgl. Wild, Islamwissenschaftler wünschen Sachkunde 2006. Zur Gültigkeitsdauer von Friedens- und Handelsverträgen zwischen moslemischen und in ihren Augen ungläubigen Herrschern vgl. auch Ziegler, Peace treaties of the Ottoman Empire, S. 339–358.
[10] Vgl. Kapitulation von Konstantinopel 1740 V 28, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[11] Erst nach dem Ersten Weltkrieg ging das Kapitulationssystem schrittweise zurück und fand sein endgültiges Ende 1956, als die USA auf die Konsulargerichtsbarkeit in Marokko verzichteten.
[12] Z.B. ist das Flügelspinnrad 1480 erstmals nachgewiesen.
[13] In England beispielsweise verfügte der König lediglich über die Ein- und Ausfuhrsteuern unabhängig vom Parlament.
[14] Auch nach der Entdeckung des Seewegs durch Portugal gelang es den Portugiesen nicht, den gesamten Handel mit Europa zu kontrollieren. Und so blieben im 16. Jahrhundert die alten Handelsmuster über die Levante vorherrschend. Vgl. Gupta, Maritime Trade of Indonesia 1997, S. 93.
[15] 1580, 1583, 1587 und 1675 schlossen England, 1612 und 1680 die Vereinigten Provinzen mit dem Osmanischen Reich Kapitulationen ab. An den Jahreszahlen lässt sich der Bedeutungszuwachs der levantinischen Märkte für die nordwesteuropäischen Länder seit Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts ablesen.
[16] Vgl. Childs, Consulado del mar 1994, S. 356 f. Zu den Nachverhandlungen und Bemühungen der Katholischen Könige, eine Ausnahme aus dieser Regelung zu erwirken, vgl. CSP Spain 1, Nr. 37, 60, 91, 94, 107, 113, 121, 143, 158, 172, 182, 204, 206. Zu den Folgeabmachungen vgl. auch Rymer, Foedera 1704–1735, Bd. 12. Archivo General de Simancas (AGS), Patronato Real Caja 52/87, fol. 4305r (3. November 1494), Caja 52/180, fol. 4653r.
[17] Vgl. CSP Spain 1, Nr. 137, 21. Juni 1496.
[18] Vgl. Rau, Privilégios 1970, S. 18 f.
[19] Im Vertrag von Tordesillas aus dem Jahr 1494 hatten Spanien und Portugal die Einflusssphären so unter sich aufgeteilt, dass theoretisch alle außereuropäischen Gebiete östlich der in Tordesillas bestimmten Demarkationslinie in portugiesischen Einflussbereich fielen. Vgl. Schüller, Einführung 2000, S. 24.
[20] Auch wenn die Niederlande 1654 ihre Kolonien in Brasilien wieder räumen mussten, blieben die meisten vormals portugiesischen Gebiete in Asien in niederländischer Hand. Träger der Eroberungen waren die holländischen Überseekompanien, deren Besitzansprüche jedoch in völkerrechtlichen Verträgen festgeschrieben wurden. Vgl. Waffenstillstand und Beistandspakt von Den Haag 1641 VI 12, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, (eingesehen am 26. Februar 2008).
[21] Im Gegensatz dazu wurde die Eigengerichtsbarkeit in den vorab erwähnten Kapitulationen auch gegenüber den Untertanen des Gastlandes zugestanden, so dass die Fremden der örtlichen Rechtssprechung entzogen blieben. Innerhalb Europas wurden die Relikte der Eigengerichtsbarkeit im 18. Jahrhundert vollständig abgebaut. Vgl. Freundschafts- und Handelsvertrag von Stockholm 1641 VII 29, Artikel 15, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 16. November 2007).
[22] Vgl. Friedens- und Handelsvertrag von London 1642 I 29, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 16. November 2007).
[23] Vgl. Allianzvertrag von Paris 1641 VI 1, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[24] Vgl. López Martín, Comercio mediterráneo 2005.
[25] Die Engländer hatten Zollsätze von 26% beziehungsweise 36% für ihren Handel mit Brasilien zu zahlen. Die Beziehungen zwischen Spanien und England wurden durch den Friedensschluss von 1604 bestimmt, der vor allem den Handel zwischen den beiden Staaten regelte. Auch wenn dieser Frieden zwischen 1625 und 1630 wegen der Pfalzfrage und der gescheiterten Heirat zwischen Karl I. und der Infantin Maria Anna von Spanien unterbrochen wurde, legte der Friede von 1630 die Beziehungen im Wesentlichen gemäß der Vereinbarungen von 1604 fest.
[26] Zur Übermacht der Holländer zu dieser Zeit beim Handel mit Lissabon, wo die Kolonialwaren umgeschlagen wurden, vgl. Rau, Subsidio 1954, Tab. D, E, S. 251.
[27] Zur Zeit des englischen Bürgerkriegs hatte man auch in Spanien mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu kämpfen. Katalonien versuchte mit Hilfe Frankreichs seine Unabhängigkeit durchzusetzen, die Rebellion in Portugal brachte die Dynastie der Braganças an die Macht, und im Süden des Landes versuchte der Herzog von Medina Sidonia, Andalusien in die Unabhängigkeit zu führen. Vgl. Elliott, Composite monarchies 1992 und Kamen, Spain 1983.
[28] Vgl. Sanz, England and the Spanish foreign policy 1998, S. 294–296.
[29] An portugiesischen Stützpunkten in Afrika war es zu Schwierigkeiten für englische Kaufleute gekommen. Die Portugiesen versuchten mit Hilfe der Holländer zu verhindern, dass sich Spanien dort über englische Händler mit Sklaven für seine Kolonien versorgte. Seit den 1640er Jahren wurde die holländische WIC durch ihre Vorherrschaft an der Westküste Afrikas die wichtigste Versorgerin Spanisch-Amerikas mit Sklaven. Wollte man den Holländern dieses Monopol streitig machen und über den Sklavenhandel am Direkthandel mit Amerika teilnehmen, war man vom Zugang zu portugiesischen Stützpunkten abhängig. Vgl. Biblioteca da Ajuda (BA), Codex 51–V–17 Obras politicas, fol. 121–126.
[30] Vgl. Duchhardt, Hanse 1998, S. 23 f.
[31] Vgl. z.B. Erneuerung von Den Haag 1645 VIII 4, Allianz- und Handelsvertrag von Paris 1655 V 10, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[32] Vgl. Friedens- und Freundschaftsvertrag von Madrid 1667 V 23, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 16. November 2007). Kein englisches Schiff durfte vor dem Entladen von Zollbeamten untersucht werden; nicht mehr als drei niedere Angestellte der Zollbehörden, die für ihre Anfälligkeit für Bestechungen bekannt waren, konnten abgeordnet werden, das Entladen zu überwachen. Berücksichtigt man, dass diese Angestellten von den Zollbehörden bezahlt werden mussten und den Kaufleuten oder Kapitänen die Fristsetzung des Entladens freistand, kann man sich leicht vorstellen, dass dieser Paragraph vor allem dem illegalen Handel dienen sollte. Selbst wenn die spanischen Behörden nach der Entladung noch Schmuggelgut an Bord der Schiffe finden sollten, blieb den Verantwortlichen acht Tage Zeit, die Waren beim Zoll zu melden. Versäumten sie die Meldung, durfte lediglich das Schmuggelgut konfisziert werden. Weder der Kaufmann, noch die Mannschaft, noch seine übrige Ware mussten weitergehende Sanktionen befürchten (Artikel 10). Konnte ein Kaufmann seine Waren in einem Hafen nicht verkaufen, durfte er sie an einem anderen Hafen anlanden, ohne erneut zollpflichtig zu werden. Als einziger Beweis dafür, dass die Zölle bereits entrichtet worden seien, hatte sein Wort zu gelten (Artikel 11). Schließlich wurde das Vorgehen gegen des illegalen Handels verdächtigte Schiffe, die in den Häfen des jeweils anderen Schutz suchten, stark eingeschränkt (Artikel 12).
[33] Philipp II. begleitete 1563 seine Auseinandersetzungen mit England mit einem Einfuhrverbot aller englischen Waren, das mit dem Argument einer in England grassierenden Seuche begründet wurde. Daraufhin verbot Elisabeth I. ihrerseits sämtliche Importe aus den Niederlanden, da sie feststellte, dass die Niederländer weiterhin ohne Angst vor Ansteckung nur Unnötiges und Überflüssiges nach England lieferten. Vgl. TRP 2, Nr. 521.
[34] Gerade bei Textilien konnte über die genaue Festlegung ihrer Machart auf Produkte aus bestimmten Regionen gezielt werden.
[35] Vgl. Friedens- und Handelsvertrag von Westminster 1654 VII 10, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 16. November 2007); Brazão, Velha Aliança 1955, Tratado de 1661.
[36] Vgl. Weindl, Wer kleidet die Welt 2007, Kap. 4.2.2.
[37] Sombart, Der moderne Kapitalismus 1916, Bd. 2, S. 973.
[38] Vgl. z.B. Lighthart / Reitsma, Portugal’s role 1988; Azevedo, Épocas de Portugal 1978, S. 405–410; Claro, A aliança inglesa 1943; Figueiredo, Portugal nas guerras 1914, S. 21.
[39] Tatsächlich wurde vom spanischen König auch Handel von und nach den Kanaren lizenziert, ebenso wie gelegentlich ausländische Kaufleute auf den Überseeflotten zu finden waren oder Handel zwischen Manila und Acapulco stattfand. Entscheidend für den vorliegenden Zusammenhang ist jedoch der Monopolanspruch, der den Überseehandel zum Politikum machte. Vgl. Konetzke, Süd- und Mittelamerika 1965, S. 329–333.
[40] Vgl. Kahle, Lateinamerika 1993, S. 12–16.
[41] Für Portugal ist das nur eingeschränkt gültig, weil die portugiesische Handelsflotte als nicht stark genug angesehen wurde, das eigene Monopol nachhaltig zu gefährden, so dass sich England bereits im Heiratsvertrag von 1661 Zugang zum portugiesischen Überseeimperium sicherte.
[42] Vgl. Friedens- und Handelsvertrag von Utrecht 1714 VI 26, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 16. November 2007). In Artikel 31 heißt es wörtlich: »S[u] M[ajestad] C[atolica] promete no permitir que alguna nazion estrangera qualquiera que sea, y por qualquiera razon, û debaxo de qualquier pretexto, embie Nabio ô Nabios, û baya â comerziar â las Yndias Españolas; Y al contrario S[u] M[ajestad] se empeña de restablezer ŷ mantener despues la nabegazion ŷ Comercio en estas Yndias, dela manera que todo estaba durante el Reynado del difunto Rey Carlos segundo, ŷ conforme â las leyes fundamentales de España que prohiben absolutamente â todas las naziones extrangeras la entrada ŷ el Comercio en estas Yndias, y reserban uno y otro unicamente â los Españoles subditos de su dicha Magestad Catt[oli]ca, ŷ para el cumplimiento de este Artículo los Señores Estados Generales prometen tambien ayudar â S[u] M[ajestad] C[atolica] bien entendido que esta regla no perjudicará al contenido del contracto del asiento de Negros echo ultimamente con su Magestad la Reyna dela Grande Bretaña.«
[43] Bemerkenswert ist allein schon die Tatsache, dass dieser Vertrag Bestimmungen über den Handel eines der Vertragspartner mit einem an diesem Abkommen unbeteiligten Drittstaat trifft. Vgl. Friedensvertrag von Utrecht 1713 IV 11, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 16. November 2007). In Artikel 32 heißt es wörtlich: »Le Roy tres Chrestien consent aussy et promet qu’il ne pretendra, ni n’acceptera aucun autre avantage, ni pour luy mesme, ni pour ses sujets, dans le Commerce et la navigation soit en Espagne, ou dans les Indes Espagnoles, que celuy dont on a joui pendant le Regne du feu Roy Charles 2.d, ou qui seroit pareillement accordé à toute autre Nation trafiquante.«
[44] Das annual ship wurde häufig von kleineren Booten begleitet, die das Schiff vor Ort immer wieder beluden, so dass aus den 500 Tonnen erlaubter Ware um ein Vielfaches mehr wurde. 1731 kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein spanischer Beamter Kapitän Jenkins ein Ohr abschnitt, das dieser konservierte und das acht Jahre später, vor dem Parlament gezeigt, antispanische Hysterie in England auslöste und zum so genannten Capitain Jenkins’ ear war führte, der zunächst um koloniale Fragen ausgetragen wurde und später im Österreichischen Erbfolgekrieg aufging.
[45] Vgl. Friedensvertrag von Aachen 1748 X 18, Artikel 16, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, (eingesehen am 16. November 2007).
[46] Vgl. Barrie, Prohibition du commerce 1977, S. 349.
[47] Vgl. Duchhardt, Balance of Power 1997, S. 89 f.
[48] Ebd., S. 93.
[49] Vgl. z.B. Brenner, Merchants and revolution 1993.
[50] Vgl. Weindl, Wer kleidet die Welt 2007, S. 254–256.
Andrea Weindl, Europäische Handelsverträge – Friedensinstrument zwischen Kommerz und Politik, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 36–55.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008062408>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 37 oder 36–39.
Andrea Schmidt-Rösler *
Prälimarfriedensverträge als Friedensinstrumente der Frühen Neuzeit
Gliederung:
Text:
Hinter dieser Entwicklung steht – neben der politischen Realität einer komplexeren bündnispolitischen und außenpolitischen Vernetzung der europäischen Staatenwelt – auch der sich wandelnde Friedensbegriff, der mehr und mehr an den Vertragsgedanken geknüpft wurde. Das mittelalterliche Verständnis einer pax universalis und naturalis wurde abgelöst durch die Vorstellung eines zwischenstaatlichen Staatsfriedens, der nur auf der Basis eines Vertrages denkbar war – eine ideengeschichtliche Entwicklung, die die Ausdifferenzierung des Instruments des »Präliminarfriedensvertrags« mit beeinflusste.[2]
Im Mittelpunkt der Analyse stehen weder die Vor- und Wirkungsgeschichte der einzelnen Verträge, noch die Vertragsinhalte oder die Betrachtung des diplomatischen Prozesses, sondern das Instrument des »Präliminarfriedens« an sich. Durch einen Vergleich möglichst vieler in der Frühen Neuzeit abgeschlossener Verträge, die bis auf wenige Ausnahmen in der Datenbank des Projekts »Europäische Friedensverträge der Vormoderne – Online« (Institut für Europäische Geschichte, Mainz) enthalten sind, sollen die Elemente, die einen Präliminarvertrag kennzeichnen, der Chronologie folgend herausgearbeitet werden.
56
Der Begriff wird erstmals[3] im Jahr 1558 im zwischen Frankreich und Großbritannien geschlossenen Traité Préliminaire de Paix et de bonne Intelligence von Câteau Cambrésis[4] (12. März 1558) verwendet. Er regelte die Calais-Frage provisorisch und bereitete den Weg zum ein Jahr später geschlossenen Frieden von Câteau Cambrésis (2. April 1559). Nach DuMont beginnt der Text ohne Präambel direkt mit dem Vertragsziel: »Premierement, qu´il y aura […] bonne, parfaite et inviolable Paix, Amitié et Intelligence. Pour à laquelle parvenir […] a esté accordé: […].« Es folgen Bestimmungen über die Calais-Frage, die bis zu einem endgültigen Vertrag (»Traité de Paix«) oder aber acht Jahre lang gelten sollen. Der Vorfrieden legte keine Waffenruhe fest. Der Kriegszustand und die Auseinandersetzungen dauerten noch über ein Jahr bis zum Friedensvertrag, der die strittige Calais-Frage im Sinne des Präliminarvertrags en détail und in feierlicherer Form regelte.
Die frühen Verträge, die die Bezeichnung »Präliminarartikel« usw. trugen, waren eher Absprachen über Verfahren, die zu einem Frieden führen sollten. Sie enthielten kaum materielle Regelungen, sondern beschränkten sich darauf, ein Verfahren zur Erlangung eines Friedensvertrages festzulegen. In Abgrenzung zu den späteren, auch materielle Bestimmungen enthaltenden Verträgen wird als völkerrechtliche Unterscheidung für diese frühen Verträge der Begriff Präliminarkonvention gebraucht.[5] Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem pactum de negotiando, in Zukunft einen Vertrag zu schliessen, um den Krieg zu beenden.
Das prominenteste Beispiel dieser frühen Präliminarabkommen ist der Vorfrieden von Hamburg (25. Dezember 1641),[6] der explizit als Préliminaires de la Paix bezeichnet wurde. Wie Anja Victorine Hartmann gezeigt hat, stand er am Ende zäher Verhandlungen nicht so sehr um Inhalte, sondern um die seit 1637 zwischen Ludwig XIII. und Ferdinand III. umstrittene Kaiser-Titulatur für Ferdinand III. Der Vertrag traf technische Vorbereitungen für einen Friedenskongress, bestimmte den Beginn der Verhandlungen, legte Münster und Osnabrück als Kongressorte mit neutralem Status fest und regelte Passfragen, Passierwege und Immunität für die Unterhändler[7] und ihre Delegationen. Auf den Fortgang des Krieges hatte er keinen Einfluss, und bis zu den Friedensverträgen von Münster und Osnabrück verstrichen noch gut sieben Jahre.
57
Katalysierend für den Friedensprozess war hingegen der Article Préliminaire von Elbing, unterzeichnet von Schweden, Brandenburg, Polen und dem Kaiser (27. November 1659). Er legte Oliva als Verhandlungsort fest, gab den schwedischen Delegierten Sicherheitsgarantien und führte am 3. Mai 1660 zum Frieden von Oliva.
Zu den frühen Präliminarkonventionen gehörte des weiteren der Tractatus praeliminaris von Ängelholm zwischen Schweden und Dänemark (29. Oktober 1644).[8] Einleitend wird, einer Präambel angelehnt, der aktuelle Krieg als Vertragsgrund genannt und der Friedenswillen beider Parteien bekräftigt. Auf der Basis dieses Fundaments legten die Unterhändler fest, dass am 15./25. Dezember »in nomine Sancto-Sanctae Trinitatis Tractatus futurae Pacis« verhandelt werden solle. Als Vertragsort wurde Brömsebro bestimmt; ähnlich wie im Hamburger Vorfrieden wurden die Rechte der Unterhändler festgelegt. Materielle Bestimmungen über die Beilegung des Krieges (v.a. die Zukunft Schonens betreffend) finden sich erst im auf der Basis der Präliminarien verhandelten und am 13. August 1645 unterzeichneten Frieden von Brömsebro.
Ein weiteres Beispiel ist der Vorvertrag vom 16. Juni 1679 zum Frieden von Lund (26. September 1679). In diesem Vertrag vereinbarten Dänemark und Schweden die Eröffnung von Friedensverhandlungen in Lund und legten das Verfahren für den Friedenskongress (Tagungsort, und -zeit, Unterbringung und Sicherheit der Delegationen) fest. Weder formal noch inhaltlich gibt es Anlehnungen an einen Friedensvertrag; lediglich die Formeln »de traiter la paix icy en Schone« und »y rétablissant une bonne paix«[9] in der Präambel stellen den Zusammenhang her. Einigkeit über inhaltliche Fragen scheint zu Beginn der Verhandlungen noch nicht bestanden zu haben. Erst ein am 30. August 1679 geschlossener Waffenstillstand zeigt einen Verhandlungsfortschritt: »Demnach durch Göttlichen Segen der Friede zwischen beyden Königlichen Majestäten zu Dännemarck und Schweden etc. bereit so weit gebracht worden, dass an einem glücklichen Schluß nicht zu zweifeln« – heißt es in der Präambel, habe man sich auf einen Stillstand der Waffen, der währen solle bis »dass der Friede vollkommen exequirt wird« (Artikel 8).[10] Der Kriegszustand endete jedoch erst mit dem – den territorialen Status quo ante wiederherstellenden – Frieden von Lund: »Il sera rétabli une Paix assurée et éternelle« (Artikel 1).[11] Als der letzte dieser auf technische Fragen beschränkten Präliminarkonventionen ist ein Vertrag zwischen Dänemark und Holstein-Gottorf vom 18. Juli 1700 zu nennen,[12] der die Verhandlungsaufnahme in Hamburg stipulierte und die Parteien zur Einreichung ihrer Postulata aufforderte, mit der Vereinbarung einer Waffenruhe (Artikel 4) allerdings bereits über die übrigen Verträge hinausging.
58
Die Präliminarkonventionen des 17. Jahrhunderts bildeten den kleinsten gemeinsamen Nenner, den die Unterzeichner zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zum Frieden verankern konnten. Um inhaltliche Fragen zu regeln, oder gar die causa belli zu beseitigen, war die Interessenskonvergenz noch zu unüberwindbar. Die Methode, einen Friedensprozess mit einem Vorvertrag einzuleiten, kam jedoch der Diplomatie des ausgehenden 17. und vor allem des 18. Jahrhunderts entgegen. So wurde das Instrument der Präliminarkonventionen rasch erweitert; materielle Bestimmungen wurden in die Vorabsprachen eingefügt und die Einigung über Friedensbedingungen vorwegnehmend in »Friedenspräliminarien« und »Präliminarfriedensverträgen« kodifiziert.
Ein sehr frühes Beispiel dieser Weiterentwicklung sind die Friedenspräliminarien von Wien, geschlossen zwischen dem Kaiser und dem Fürstentum Siebenbürgen am 9. Februar 1606.[13] Ihnen ging eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Anhängern des siebenbürgischen Fürsten Stephan Bocskay und dem Kaiser voraus, die ihre Wurzeln in der restriktiven Politik der Habsburger im Königreich Ungarn hatte. 1604 begann Bocskay, gestützt auf den Sultan, mit einem Angriff auf die kaiserlichen Truppen, die aus Siebenbürgen sowie aus Teilen des Königlichen Ungarn vertrieben wurden, und ließ sich 1605 zum siebenbürgischen Fürsten wählen. Aus dieser Position der Stärke heraus wurden am 9. Februar 1606 zu Wien die Friedenspräliminarien unterzeichnet. Eine Einigung schien – trotz der günstigen Ausgangsposition Siebenbürgens – für beide Seiten nötig. Das Fürstentum fürchtete die Übermacht des verbündeten Osmanischen Reichs, Habsburg den Verlust des königlichen Ungarn und zugleich eine weitere Schwächung im seit 1593 andauernden »Langen Türkenkrieg«. So hatte der Vorfrieden in erster Linie die Funktion, den am 15. Januar (befristet bis zum 24. Juni 1606) geschlossenen Waffenstillstand zu bestätigen. Warum aber wurde dann nicht nur eine neue Waffenstillstandsurkunde ausgestellt? Man wollte wohl, angesichts der schon eineinhalb Jahren dauernden Verhandlungen, erste Ergebnisse verankern. Damit erfüllt der Wiener Vertrag eindeutig alle Kriterien der Untergruppe der Friedenspräliminarien, die eine Einigung der Kriegsparteien über zentrale Streitfragen und die Verpflichtung, dies in einem Friedensvertrag umzusetzen, enthalten. Sie haben bereits Bindungswirkung, jedoch keine unmittelbare Außenwirkung. Kommt ein Friedensvertrag nicht zustande, fehlt die Rechtswirkung. Der Kriegszustand bleibt bestehen, ein definitiver Friede ist nicht etabliert. Einer endgültigen friedensvertraglichen Einigung standen im Jahr 1606 auf beiden Seiten einige Hindernisse entgegen. So hegte der habsburgische Verhandlungsführer Erzherzog Matthias zum Beispiel Bedenken, die Reputation des Kaisers könne durch die von Siebenbürgen geforderte Übergabe der Stephanskrone leiden. Auch auf die von Bocskay geforderten religiösen Zugeständnisse wollte sich der Kaiser nicht einlassen. Die Friedenspräliminarien gliedern sich in zwei Teile mit je 15 beziehungsweise 16 Artikeln und umfassen insgesamt 15 Seiten; ihre ungewöhnlich detaillierten Bestimmungen regeln sowohl die prinzipiellen Fragen der Beziehungen als auch die sich aus dem Krieg ergebenden privatrechtlichen Probleme. In Religionsangelegenheiten wurde der status quo ante bestätigt (Artikel I,1), der Waffenstillstand wurde verlängert und ein gemeinsamer Frieden mit dem Osmanischen Reich angestrebt (Artikel I,2). Artikel I,13 gibt den ersten Hinweis auf den vorläufigen Charakter des Friedens: Eine Amnestie wird angekündigt, die automatisch ablaufen soll, sobald »der Friede perfekt geworden ist« (allerdings könnte sich dies auch auf die Ratifikation beziehen). Auch solle dann die Restitution der Güter erfolgen. Bocskay wurde in seinem Besitzstand bestätigt (Artikel II,1) und Siebenbürgen ausdrücklich als Teil Ungarns benannt. Allerdings musste der siebenbürgische Fürst seinem Anspruch auf den ungarischen Königstitel (Artikel II,14) und einem gegen Habsburg gerichteten Bündnis mit den Türken entsagen (Artikel II,15). Als Garantiemächte waren allerdings nur Habsburger Länder, nicht, wie von Siebenbürgen gewünscht, auch Polen oder die deutschen Reichsfürsten vorgesehen.
59
Auch Friedenspräliminarien unterliegen dem Ratifikationsverfahren (Artikel II,16). Obwohl sie am Wiener Kaiserhof zunächst auf Widerstand stießen, bestätigte Kaiser Rudolf II. sie am 21. März 1606.[14] Das Fürstentum Siebenbürgen verweigerte jedoch die Ratifikation. Offenbar verstand Bocskay – im Gegensatz zum Kaiser – das Instrument nur als weitere Verhandlungsgrundlage, denn noch vor der siebenbürgischen Ständeversammlung signalisierte er am 16. März der kaiserlichen Gesandtschaft seine Ablehnung. Auf dem Reichstag in Kaschau (14. April 1606) zeigte sich v.a. in kirchenpolitischen Fragen eine Opposition der Stände, aber auch bei staatsrechtlichen Fragen. Da die Präliminarien jedoch ausdrücklich eine beidseitige Ratifikation vorsahen, erlangte der Vertrag keine Rechtsgültigkeit. Statt einer Ratifikation stellte man neue Friedenspunkte auf, die eine Delegation dem Kaiser unterbreiten sollte. Sie traf am 4. Juni 1606 in Wien ein.
In der Detailtreue, in der der Vorvertrag unterzeichnet wurde, unterscheidet ihn nichts von einem Definitivfrieden. Warum aber trägt er den Titel »Friedenspräliminaren«? Im Text selbst findet sich nur die Bezeichnung tractatus oder in der Präambel neutral sequentes articulos. Schließlich ist er genauso aufgebaut wie ein förmlicher Friedensvertrag. Er beginnt mit einer Präambel mit Titulatur, gefolgt von der Aufzählung der Bevollmächtigten. In der Präambel wird jedoch kein Recurs auf einen Frieden genommen: es findet sich nur eine Umschreibung des Zustandes ad exortos nuper in inclyto regno Hungariae eiusque partibus intestinos motus et tumultus sopiendos. Mitunter wird die nötige Beseitigung der querelae (I, Artikel 12) erwähnt. Der Begriff pax fällt nur im Zusammenhang mit dem zeitgleich angestrebten Frieden der beiden Vertragspartner mit dem Osmanischen Reich (I, Artikel 2).
Flankiert von mehreren Waffenstillständen wurde im Anschluss an Nachverhandlungen und Textänderungen am 23. Juni 1606 der Friede von Wien unterzeichnet, der die Position Bocskays stärkte.[15] In diesem Definitivfrieden taucht nun in der Präambel ausdrücklich der Friedenszweck auf. Auch auf den Vorfrieden wird Bezug genommen, dieser jedoch nur als ex priori tractatu bezeichnet. Der Waffenstillstand findet keine Erwähnung mehr. Erst jetzt ist also der Kriegszustand beendet.
60
Der erste Präliminarfriedensvertrag im engsten Sinne ist der Vertrag von Tåstrup, unterzeichnet am 18. Februar 1658 zwischen Dänemark und Schweden,[16] der das Ende des 1657 begonnenen dänischen Krieges gegen Schweden einleitete. In dem in dänischer und schwedischer Sprache abgefassten Vertrag kamen die Vertragsparteien überein, die Streitigkeiten beizulegen (Präambel, Artikel 1) und vereinbarten, dass »hiernach ewiger Frieden sein und bleiben« solle (Artikel 1). Eine Amnestie (Artikel 1) und ein Gefangenenaustausch (Artikel 11) wurden angekündigt. Damit enthält der Vorfrieden – wenn auch nur in Ankündigung – ein wichtiges Merkmal eines Definitivvertrages. Dazu kamen Absprachen, die bereits deutlich eine Nachkriegsordnung skizzieren, so z.B. der Verzicht auf Bündnisse zum Schaden des anderen (Artikel 2, 3), die Garantie der bestehenden Brömsebro-Verträge (vom 13. August 1645, Artikel 5) oder Regelungen über die Zollfreiheit für schwedische Schiffe (Artikel 7). Auch die territoriale Nachkriegsordnung wurde bereits angelegt, indem der Vertrag Schweden Satisfaktion zusicherte (Artikel 8) und die Inkorporation der schonischen Landschaften sowie der norwegischen Provinzen Bohuslän und Trondheim (Artikel 8, 9) ankündigte. Schweden hingegen musste sich verpflichten, die im Krieg eroberten Festungen zu restituieren (Artikel 10) und die Armee aus Dänemark zurückzuziehen (Artikel 12). Im Eschatokoll verweist der Vertrag auf die Unterschriften und Besiegelungen sowohl der Unterhändler als auch der Vermittler, »damit das Vorgeschriebene unverbrüchlich gehalten wird«. Die Ratifikation des Vertrages durch den schwedischen König bekräftigte schließlich den implizit enthaltenen Waffenstillstand: »ut armorum cessatio immediate hoc ipsum sequi et publicari debeat.«[17] Der Vorfrieden führte binnen kurzer Zeit zum Frieden von Roskilde (26. Februar 1658), der die Festlegungen präzisierte, und durch den Dänemark seine Besitzungen auf der skandinavischen Halbinsel (Schonen, Halland, Blekinge, Ostseeinsel Bornholm) sowie die norwegischen Provinzen Bohuslän und Trondheim abtreten mußte. Nun wurde auch der Austausch der Kriegsgefangenen vollzogen.
61
Die Wiener Präliminarien und in noch höherem Maße der Präliminarfrieden von Tåstrup waren Vorboten einer völkerrechtlichen Kodifizierung, die im 18. Jahrhundert einen Höhepunkt erreichte. Das Beispiel des Haager Präliminarabkommens vom 28. Mai 1709 zeigt jedoch, wie ungewohnt dieses Instrument zunächst noch war. Während des Spanischen Erbfolgekrieges nahm Frankreich mit Österreich, Großbritannien und den Generalstaaten Verhandlungen über einen möglichen Friedensschluss auf. Im Frühjahr 1709 wurde ein 40 Artikel umfassender Präliminarfriedensentwurf mit dem Titel »Articles preliminaires pour servir aux Traittés de la paix generale« erstellt. Der in französischer Sprache abgefasste Vertrag beginnt ohne Einleitung und Präambel. Artikel 1 verkündete die Absicht »On procedera incessament, à faire une bonne, ferme et durable paix, confoederation et perpetuelle alliance et amitié«. Artikel 2 legte fest, dass die Präliminarien dem späteren Friedenvertrag zugrunde liegen sollten: »[…] des articles preliminaires, qui doivent servir de fondement aux traittéz de la paix generale«. Zentraler Punkt war die Anerkennung Erzherzog Karls als spanischer König (Artikel 3). Artikel 5 sah vor, dass Frankreich seine Truppen zwei Monate nach Abschluss des Vertrags aus den spanischen Ländern und Besitzungen abziehen sollte. Gebietsabtretungen wurden festgelegt; so sollte Frankreich beispielsweise Strassburg an den Kaiser retournieren, um »donner des marques certaines du dessein, qu´elle a, de maintenir une paix ferme et stable« (Artikel 8). Innerhalb von zwei Monaten sollte der Friedensvertrag geschlossen werden (Artikel 33). Artikel 24 enthielt einen Waffenstillstand, der in Kraft treten sollte, sobald Frankreich die spanischen Länder abgetreten hatte (Artikel 37). Österreich, Großbritannien und die Generalstaaten unterzeichneten das Instrument am 28. Mai 1709 in Den Haag.[18] Für Frankreich jedoch war Artikel 37, d.h. die Verknüpfung von Waffenstillstand und Gebietsabtretungen, inakzeptabel. Der französische Bevollmächtigte lehnte eine Unterschrift ab, und Ludwig XIV. verweigerte die Ratifikation.[19] Dies war natürlich diplomatisches Kalkül und hatte handfeste politische Gründe.[20] Interessant ist in diesem Zusammenhang jedoch die offizielle diplomatische Argumentation. Wie Schmauß berichtet, fand der französische König es
»seiner Ehre gar zu nachtheilig […], einen Frieden in der Form von Präliminarien zu tractiren; er seye geneigt den Innhalt der Präliminarien […] anzunehmen, wann es nur durch einen rechten Friedens-Tractat geschehe, nach welchem die Execution der verglichenen Artickel folgen müste. […] weilen der Winter dermaßen natürlicher Weise einen Waffen-Stillstand mit sich führe, so brauche es der Behutsamkeit, welche zu besagtem Artikel 37 Anlaß gegeben, nicht, sondern man könne ohne weitere Präliminarien also gleich zur Friedens-Handlung selbst schreiten, und solchen auf das Fundament der in den Präliminar-Artickeln enthaltenen Conditionen richtig machen«.[21]
Dies zeigt, dass der Präliminarfrieden als Form der Kriegsbeendigung noch nicht zum diplomatischen Usus zählte und in seiner Form von Ludwig als »unehrenhaft« empfunden wurde. Dem hielten die Alliierten entgegen: »Dann wann es ihm Ernst seye, alles was in den Präliminar-Artickeln enthalten, nur allein mit Ausnahm des 37 Artickles zu verwilligen, so hätte er keine Ursache, die Execution derselben aufzuhalten, noch von der Form der Präliminarien abzugehen, weilen ohne diese die Negociationes in die Länge hinaus verzogen, und vielleicht gar nichts geschlossen würde«.[22] Der Präliminarvertrag kam nicht zustande, und der Krieg endete ohne Vorverträge mit den Friedensverträgen von Utrecht, Rastatt und Baden (1712–1714).[23]
62
Am 21. Juli 1711 beendeten Russland und das Osmanische Reich den 1710 begonnen Krieg mit einem »am Fluß Pruth« geschlossenen Präliminarfrieden, dem am 5./15. April 1712 der Friede von Konstantinopel folgte.[24] Der in italienischer Sprache abgefasste Vorvertrag zeigt einen seltenen und dem Charakter eines Präliminarfriedensvertrags eigentlich widersprechenden Aspekt: das Diktat der Friedensbedingungen aus der Position der Stärke. So gibt hier die Präambel an, der Zar hätte angesichts der siegreichen osmanischen Streitmacht um Frieden nachgesucht, weswegen »diese Artikel geschlossen« wurden. Demzufolge legte der Vertrag Gebietsabtretungen (Azov) fest und sicherte dem Osmanischen Reich Handelsprivilegien. Die Ausstellung und Unterzeichnung einer Kapitulationsurkunde wurde verfügt, und erst nachdem dies geschehen war, wollte der Sultan zwei hochrangige russische Geiseln freilassen. Der Vertrag beginnt ohne Präambel. Er trägt keinen zeitgenössischen Titel, wird jedoch zu Textende als »Paix« bezeichnet. Auch in der von Dumont wiedergegebenen Ausfertigung, die nur von den russischen Unterhändlern unterzeichnet wurde, findet sich in Artikel 1 die Bezeichnung »Pax«. Die Subsumierung unter die Gruppe der Präliminarfriedensverträge hat dieses Abkommen wohl durch seine Wirkungsgeschichte erfahren, denn der Friede von Konstantinopel regelte – wie in der Präambel genannt wird – Streitpunkte, die nach dem ersten Abkommen entstanden waren, in detaillierter Form. Dabei wird auf den Vertrag vom 21. Juli 1711 immer wieder Bezug genommen; an mehreren Textstellen wird er als »Article de la Paix«, »Instrument de Paix« bezeichnet, in der Präambel sogar als »Traité d´une Paix perpetuelle«.
63
Deutlicher einzuordnen sind die am 22. Juli 1719 zwischen Schweden und Hannover zu Stockholm geschlossenen »Praeliminar puncta«.[25] Sie beginnen mit einer Präambel, in der der Friedenswille bekundet wird, und – analog zu einem förmlichen Frieden – die Bevollmächtigten aufgezählt werden. Artikel 1 enthält ebenfalls zwei, für förmliche Friedensverträge typische Elemente: Friedensformel und Amnestie. Es heißt: »Wirdt ein ewiger Friede, amnestie und beständige Freundschafft hiemit wiederrumb gestiftet«. In Artikel 2 erklärte Schweden die Abtretung Bremens und Verdens und zwar unmittelbar durch den Präliminarrezess (»hiermit«). Es folgen eine Erklärung über Handelsbeziehungen (Artikel 3), über Freundschaft und künftige Bündnisse (Artikel 4) sowie über Subsidienzahlungen (Artikel 5). Artikel 6 verweist auf einen späteren Frieden, dem diese Bestimmungen des Präliminarabkommens zugrunde liegen sollten: man wolle »nach Braunschweig schicken, umb beÿ dem dortigen Friedens Congress auf dem Fueß dieses jetziges Praeliminair Vergleichs den Frieden förmlich zu schließen«. Der angekündigte Friede wurde am 20. November 1719 in Stockholm unterzeichnet.[26] Die Bestimmungen des Präliminarabkommens wurden bestätigt. In der Form zeigt sich jedoch deutlich der Unterschied zwischen Präliminar- und Definitivfrieden bereits in der Präambel, die nun mit Anrufung der Dreifaltigkeit und mit der Wiedergabe der Herrschertitulatur das Schema eines förmlichen Friedens erfüllt. In der Präambel wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass der Präliminarfrieden die Grundlage für den Friedenschluss ist. Artikel 1 enthält erneut die Friedensformel, nun aber erweitert um einen Waffenstillstand. Artikel 2 führt die bereits im Präliminarrezess angekündigte Amnestie durch, und Artikel 3 bestätigt die bereits vollzogenen territorialen Abtretungen:
»Gleichwie Ihre Königl[iche] Maÿ[estä]t von Schweden, vermöge des mit S[eine]r Königl[ichen] Maÿ[estä]t von Groß-Britannien als Hertzogen und Chur Fürsten zu Braunschweig und Lüneburg unterm 11/22 Julii 1719 errichteten, eingangs berührten Præliminar Friedens Recessus deroselben bereits cediret und abgetreten haben; Also cediren und übertragen Sie kraffts dieses nochmahlen vor Sich, das Reich Schweden und ihre Successoren und Nachkommen , S[eine]r Königl[ichen] Maÿ[estä]t von Groß Britannien als Hertzogen und Chur Fürsten zu Braunschweig und Lüneburg und dero Nachkommen an der Regierung in perpetuum die Hertzogthümer Bremen und Verden, pleno jure, mit allen deren juribus und Zubehörungen«.
Dies zeigt, dass der Präliminarvertrag bereits Regelungen des Friedensvertrages vorweggenommen hatte.
Ein Beispiel für einen Vorvertrag, der zu keinem Definitivfrieden führte, ist der Präliminarartikel von Paris (31. Mai 1727) zwischen dem Kaiser, Frankreich, Großbritannien, Spanien und den Generalstaaten.[27] In dem in der Präambel »Articuli Praeliminares« genannten Abkommen wird der gestörte Frieden in Europa als Anlaß genannt. Es beendete die Kampfhandlungen für 7 Jahre (Artikel 5, 6 ,7) (mit Ausnahme des Kaperkrieges in der Karibik) und kündigte innerhalb von vier Monaten einen Friedenskongress in Aachen an (Artikel 8), auf dem die Gegensätze aller Parteien diplomatisch und ohne vorgegebenes Zeremoniell (Artikel 9, 10) beseitigt werden sollten. Die hier stipulierten Verhandlungen begannen jedoch erst am 14. Juni 1728 in Soissons und führten zu keinem Ergebnis. Ein Generalfrieden zwischen den am Präliminarfrieden beteiligten Mächten kam nicht zustande.
64
Das Paradebeispiel für die Komplexität des Präliminarinstruments ist der Wiener Präliminarfriedensvertrag zwischen Frankreich und Österreich vom 3. Oktober 1735, der den Konflikt des Polnischen Erbfolgekriegs entschärfte.[28] Als Motiv nennen die Vertragspartner in der sehr kurzen Präambel das Ziel »voulant contribuer au plus prompte retablissement de la paix«. Die Präambel ist schmucklos gehalten, die Dreifaltigkeit wird nicht angerufen und eine ausführliche Titulatur der beiden Herrscher findet sich ebenso wenig wie die Auflistung der Unterhändler oder die Friedensformel. Durchweg ist der Text im Futur geschrieben: Artikel 1 legte die Abdankung Stansilaus (Stanisław) Leszczyńskis fest (»Le Roy Beaupere […] abdiquera«) und gestand ihm dennoch den Titel des Königs von Polen (»sera reconnu et conservera«) auf Lebzeiten zu. Kurfürst August von Sachsen blieb polnischer König. Leszczyński wurde mit dem Herzogtum Lothringen und Bar entschädigt (»sera mis en possession«, »soit mis en possession«), das jedoch nach seinem Tod an Frankreich fallen sollte. Spanien erhielt Neapel, Sizilien und die Insel Elba, trat aber Parma und Piacenza an Kaiser Karl VI. ab, der fast alle Besitzungen in Oberitalien zurück erhielt. Frankreich erneuerte außerdem seine Anerkennung der Pragmatischen. Das Großherzogtum Toskana sollte an Herzog Franz I. Stephan von Lothringen fallen. Artikel 1 und 3 sahen eine Amnestie vor (»Il y aura une amnestie pleine et generale«). In Artikel 4 findet sich die ausdrückliche Bezeichnung des Vertrags als articles préliminaires, ebenso im Eschatokoll. Ein Friedenskongress sollte so schnell wie möglich einberufen werden (Separatartikel). Interessant ist der zweite Separatartikel. Er begründet den Gebrauch der französischen Sprache für den Vertragstext, entgegen dem sonst üblichen Usus des Lateinischen zwischen Frankreich und Österreich beziehungsweise dem Reich. Ausdrücklich wird betont, dass es sich um einen Sonderfall handele: »les presens Articles Preliminaires ne laissant pas d’avoir la meme force et vertu, que s’ils etoient en langue Latine«. Einer Interpretation der Sprachverwendung zugunsten Frankreichs wurde damit ein Riegel vorgeschoben.[29] Eine Niederlegung der Waffen enthielten die Präliminarien nicht, dennoch wurden noch vor ihrer Ratifikation die Feindseligkeiten eingestellt. Die Präliminarien wurden von beiden Seiten ratifiziert und die Verbündeten Frankreichs traten dem Abkommen bei. Zu dem geplanten Friedenskongress kam es jedoch nicht. Vielmehr folgten eine Reihe von Sonderabkommen, die die offenen Fragen regelten. Besonders interessant ist die von Frankreich und Österreich unterzeichnete Convention d’Execution (11. April 1736), in der bereits von der Herstellung des Friedenszustandes ausgegangen wird. Auch in der äußeren Form ähnelt sie – stärker als der Präliminarvertrag – einem Friedensvertrag. Sie beginnt mit der religiösen Formel. In der Präambel wird festgehalten, dass die Regelungen über einen Waffenstillstand hinaus gehen, der definitive Frieden aber noch nicht etabliert sei.[30] Der Präliminarfriedensvertrag solle so rasch als möglich umgesetzt werden. Demgemäß enthält der Vertrag detaillierte Ausführungsbestimmungen zum Präliminarabkommen, dessen Gebietsabtretungen nun vollzogen wurden. Zuvor hatte bereits im Januar 1736 Leszczyński abgedankt. In der Deklaration von Aranjuez vom 15. April 1736 erklärte der Kaiser gegenüber Spanien, »qu’il regarde la Paix comme faite avec le Roy d´Espagne, au moyen des Conditions portées par les Articles Préliminaires«.[31]
65
Am 2. Mai 1737 einigte man sich in Wien auf einen Definitivfrieden; mit der Verkündung wartete man aber bis nach dem Tode des letzten in der Toskana regierenden Medici, so dass der 18. November 1738 als Tag des offiziellen Abschlusses des – übrigens nun wieder in lateinischer Sprachen abgefassten – Friedens von Wien gilt.[32] Zu diesem Zeitpunkt war die durch die Präliminarien geschaffene Friedensordnung faktisch schon vollzogen; dies drückt die Präambel aus: »Alma pace per Articulos Prælimi-/nares tertia Octobris die Anni 1735. […] Viennæ conclusos ritèq[ue] posthæc ratihabitos feliciter restaurata«. Zur Abgrenzung ist in der Präambel auch vom jetzigen solemnis pacis tractatus die Rede. In Artikel 1 wird betätigt:
»Pax Christiana Viennæ tertiâ Octobris die Anni 1735. conclusa, et posthæc reliquorum quoque Principum, qui belli erant participes, consensu, solennibus Declarationum Instrumentis edito, corroborata, sit maneatque perpetua et universalis, propagetque veram amicitiam«.
Im weiteren Verlauf wurden alle Punkte der Präliminarien bestätigt, ebenso die seit 1735 geschlossenen Zusatzabkommen (Artikel 3, 6, 7, 8, Anhang) sowie die Vertragsbeitritte der anderen europäischen Mächte. Dies zeigt, dass der Präliminarfriedensvertrag auch ein diplomatisches Mittel war, zwischen zwei Kriegsparteien eine Friedensordnung auszuarbeiten, ohne die Verbündeten von Anfang an einzubeziehen. Der Sachverhalt war hier so komplex, dass die Verbündeten erst nach und nach – zum Teil mit Nachverhandlungen – beitraten. Die Verträge am Ende des Polnischen Erbfolgekriegs zeigen eine Schwierigkeit besonders deutlich: Hat der Präliminarfrieden bereits den Friedenszustand hergestellt? De jure gilt dies nicht, dennoch schreibt der Friede von Wien 1738 dies dem Präliminarvertrag zu. Bei einer genauern Analyse kann man den Text jedoch auch so interpretierten, dass der Friede auf der Basis der Bestimmungen hergestellt wurde, nicht jedoch durch die Bestimmungen des Präliminarvertrages selbst. Dafür spricht auch, dass erst der Endvertrag »oblivio […] seu perpetua amnestia« (Artikel 2) enthielt.
Ein ebenso deutliches Beispiel für die völkerrechtliche Verfestigung des Instruments ist der Präliminarfriedensvertrag von Belgrad vom 1. September 1739, geschlossen zwischen dem Kaiser und dem Osmanischen Reich.[33] In der Präambel findet sich als Vertragsmotivation der zerrüttete Frieden zwischen den Vertragsparteien und der Wille, weiteres Blutvergießen zu verhindern. Als das türkische Heer bereits Belgrad belagerte, musste der Kaiser unter französischer Vermittlung Verhandlungen aufnehmen – dies ist auch in der Präambel beschrieben. Im türkischen Lager – diplomatisch verbrämt zeigt dies deutlich die Lage des kaiserlichen Heeres – hat man sich schließlich auf »Articles Préliminaires« geeinigt. Bis auf das Banat musste der Kaiser alle eroberten Gebiete wieder an die Pforte abtreten (Artikel 1–5); der Vorvertrag enthielt damit weitreichende territoriale Regelungen. In einer zwischen die Vertragsartikel und die Unterschriften geschobenen »Conclusion« musste der Kaiser zudem die Schleifung der Festung Belgrad – unter Stellung von Geiseln – akzeptieren. Die Einstellung der Kämpfe wurde festgelegt, eine Amnestie verkündet und unmittelbar nach der Unterzeichnung sollte eine Kommission zur Erarbeitung des Definitivfriedens zusammentreten. Dieser wurde am 18. September 1739 ebenfalls zu Belgrad geschlossen und bestätigte die Inhalte der Präliminarien. Er wurde vom Kaiser übrigens zeitgleich mit dem Präliminarfrieden ratifiziert.
66
Ein weiteres Beispiel sind die am 11. Juni 1742 von Preußen und Österreich unterzeichneten Friedenspräliminarien von Breslau.[34] Hier, am Ende des Schlesischen Krieges, war die Einigkeit der Kriegsparteien bereits so weit gediehen, dass der Präliminarvertrag die causa belli beseitigte. Der Vertrag beginnt mit der Anrufung der Dreifaltigkeit, ein Indiz dafür, dass die Vertragspartner ihn als ernst zu nehmend betrachteten. Artikel 1 enthielt bereits die Friedensklausel: »Il y aura desormais, et à perpetuité, une Paix inviolable«. Der Gebrauch des Futur hat hier nicht den Zweck einer künftigen Ordnung, sondern entspricht der allgemeinen in den Friedensklauseln üblichen Formulierungen. Alle weiteren Artikel, auch der der weitgehenden Gebietsabtretungen, sind im Präsens gehalten. Artikel 3 enthält eine Generalamnestie, und Artikel 4 verfügt eine Einstellung der Waffen mit der Unterzeichnung der Präliminarien. Artikel 8 sieht die Freilassung der Kriegsgefangenen und die Einstellung aller Kontributionen mit der Unterzeichnung der Präliminarien vor. Artikel 5 nimmt gravierende territoriale Veränderungen vor: Österreich trat Nieder- und Oberschlesien sowie die Grafschaft Glatz an Preußen ab.[35] Laut Artikel 10 sollte innerhalb vier Wochen ein förmlicher Frieden folgen, um die noch offenen Fragen zu regeln. Über die Präliminarartikel wird folgendes in Artikel 10 gesagt: »[…] auront en attendant la même force et le même effet, que si un Traité formel de Paix avoit été conclu et signé d´abord«. Im Grunde genommen weist nur dieser Artikel den Vertrag als Präliminarvertrag aus. Alle anderen materiellen Bestimmungen und Formalia entsprechen einem Definitivfrieden. Rasch folgte deswegen am 28. Juli 1742 der förmliche Friedensschluß zu Berlin, der die Bestimmungen nur noch präzisierte.[36] In der Präambel nimmt er ausdrücklich Bezug auf den Vorfrieden: »La guerre […] ayant été heureusemsent terminée […] par les Articles Préliminaires signés à Breslau«. Passagen aus dem Vorfrieden sind wörtlich übernommen, darunter auch die Friedensformel in Artikel 1. Auch der durch die Präliminarien vollzogene Waffenstillstand wird erwähnt. Lediglich in territorialen Grenzziehungsangelegenheiten enthält der Definitivfrieden über den Präliminarfrieden hinausgehende Bestimmungen.
Die Präliminarartikel von Åbo (16. Juni 1743)[37] leiteten das Ende des russisch-schwedischen Krieges 1741–1743 ein. In der Einleitung bekunden die Vertragspartner, dass sie die folgenden Artikel bis zu einem förmlichen Friedensvertrag durch die vorliegende »Versicherungsakte«, festhalten wollen. In Artikel 1 findet sich die Friedenformel (»Soll ewig währender Frieden sein«), verbunden mit der Einstellung der Feindseligkeiten. Artikel 2 proklamiert (auf Druck der Zarin) die Wahl Adolf Friedrichs von Holstein-Gottorf zum schwedischen Thronfolger, sobald es »nach Ankunft dieser Akte in Stockholm machbar sein kann«. Dies geschah bereits am 23. Juni. Desweiteren wurden Gebietsabtretungen Schwedens an Russland vorgenommen (Südkarelien). Dafür kündigte die Zarin an, sobald möglich nach Königswahl und Ratifikation eine Reihe von Provinzen an Schweden zurückzugeben, und Thronansprüche aufzugeben (Artikel 3). Artikel 4 stipulierte die Fortsetzung der Friedensverhandlungen zu einem förmlichen Frieden an. Dieser wurde zu Åbo am 7. August 1743 unterzeichnet. Er wurde als »ewiger Friede« bezeichnet, enthielt eine Amnestie, bestätigte die politischen, wirtschaftlichen und territorialen Regelungen en détail. Artikel 3 erklärte den Waffengang für beendet.[38]
67
Mit den Füssener Friedenspräliminarien zwischen Bayern und Österreich vom 22. April 1745 schied Bayern aus dem Österreichischen Erbfolgekrieg aus.[39] Der in deutscher Sprache abgefasste Vertrag umfasst 17 Artikel, zwei Separat- und einen Geheimartikel. In der Präambel heißt es, nachdem die Vertragspartner »in betracht der allgemeinen wohlfarth des Teutschen Vatterlands zur soliden Wiederherstellung der alten Freundschafft ganz geneigt seind; als seind Sie folgender Præliminar Articlen unter sich eins worden«. Bayern akzeptierte die Pragmatische Sanktion und gab damit alle Ansprüche auf das österreichische Erbe (Artikel 1, 4, 5) auf. Österreich verzichtete auf Kriegsentschädigungen (Artikel 2, 3) und erkannte rückwirkend die Kaiserwürde Karls VII. an. Außerdem versprach Maria Theresia, zugunsten Bayerns bei den Seemächten wegen der Zahlung von Subsidien zu intervenieren (im Separatartikel). Kurfürst Max III. Joseph versprach seinerseits, die Kaiserwahl des Franz von Lothringen zu unterstützen und auch Kurpfalz und Kurköln dafür zu gewinnen (Artikel 6, 7, Separatartikel). Artikel 10 sieht die Freilassung der Kriegsgefangenen vor, Artikel 13 den Abzug der Bayerischen Auxiliartruppen. Artikel 14 verfügt die Einstellung der Feindseligkeiten und den Abzug der Truppen unmittelbar nach der Ratifikation. Artikel 15 verweist darauf, dass die Regelungen bis zum »Schluß des Definitiv Friedens Tractats, an welchen man[n] alsogleich hand anzulegen sich erbiethet, und wegen des orths und Zeit übereins kom[m]en wird«, gelten sollen. Die Bestimmungen des Friedens waren für Bayern sehr ungünstig; so wundert es nicht, dass vor allem Kurfürst Max III. Joseph auf einen späteren Frieden unter – angesichts der späteren Erfolge der anti-österreichischen Allianz – günstigeren Bedingungen hoffte. Ein größerer Friedenskongress trat jedoch nie zusammen. Ob er, wenn er getagt hätte, die Konditionen für Bayern verbessert hätte, sei dahin gestellt, waren doch die Füssener Artikel bereits definitiv angelegt, und alle Bestimmungen wurden unmittelbar nach der Ratifikation des Präliminarfriedens vollzogen. Der Präliminarfrieden regelte alle offenen Fragen und legte die causa belli endgültig bei. Ein Definitivfrieden schien also überflüssig. So heißt es in der Präambel der am 17. Juni 1746 zu München unterzeichneten, die Subsidienzahlung regelnden Interimskonvention:
»Nachdeme vermög deren den 22.ten April/ Anno 1745 zu Füessen geschlossener Friedens Præliminarien die vollständige Aussöhnung zwischen Ihro Maÿ[estät] der Königin von Hungar/ undt Böheimb, Ertzherzogin zu Österreich einer dann S[eine]r Churfürstl[ichen] Durchl[aucht] in Baÿern anderer Seits glücklich erfolget ist«.
Und Artikel 1 bestätigt die Präliminarien:
»Erstlichen ist gegenwärtige Convention durchaus ohne abbruch derer füessener Friedens-Præliminarien undt alles dessen, was dabeÿ ausbedungen worden, zu verstehen, alß welches alles beÿ seiner vollkommenen Krafft undt Würckung forthin zu verbleiben hat«.
Mit den gleichen Worten werden die Präliminarien in der Konvention vom 21. Juli 1746 bestätigt.[40] Beide Konventionen bekräftigten, dass die Präliminarien die Aufgabe eines Friedensvertrags erfüllen. Eine förmliche Bestätigung, etwa in einer Zusammenfassung wie für den Friedensprozess von Wien 1735–1738, schien diplomatisch nicht nötig. Die Füssener Präliminarien werden deswegen mitunter auch als »Friede von Füssen« bezeichnet.
68
Die Friedenspräliminarien von Aachen stehen 1748 am Beginn eines halbjährigen Übergangs vom Österreichischen Erbfolgekrieg zum Frieden von Aachen. In den Verhandlungen, die am 24. April in Aachen begannen, traten Frankreich und England als führende Mächte auf, ihre Verbündeten schlossen sich ihnen an. Bereits am 30. April unterzeichneten Frankreich, Großbritannien und die Generalstaaten einen Vertrag,[41] dem die anderen Kriegsteilnehmer, z.B. Österreich (25. Mai 1748) oder Spanien (28. Juni 1748),[42] beitraten. Die Präliminarien beginnen mit der Anrufung der Dreifaltigkeit und stellen eine Absichtserklärung mit dem Ziel eines allgemeinen Friedens in Europa (»egalement animés du desir sincère de se reconcilier, et de contribuer au prompt retablissement de la Paix generale en Europe«) an den Anfang des Textes. Der Präambel folgt jedoch keine Friedensformel. Es wurden bestehende Verträge erneuert und territoriale und politische Bestimmungen aufgeführt. Der Übergangscharakter wird durch die durchgehende Verwendung des Futurs bekräftigt. Das Präsens wird nur an drei Stellen verwendet, als es um die Bestätigung bereits bestehender Verträge (Artikel 1, 11) und um den weiteren Verlauf zum Friedensvertrag geht. Artikel 15 des Vorvertrags enthält eine Auflistung der Streitpunkte ohne einen Lösungsansatz und mit Verweis auf einen noch abzuhaltenden Friedenskongress. Trotz Amnestieklausel (Artikel 21) enthält der Vertrag nichts über einen Austausch von Kriegsgefangenen, ein Indiz dafür, dass der Kriegszustand noch nicht als beendet betrachtet wurde. Artikel 16 verfügt eine Waffenruhe, die sechs Wochen nach der Unterzeichnung in Kraft treten sollte, und am gleichen Tag wurde in einem gesonderten Akt der Waffenstillstand (für das Gebiet der Niederlande) bekräftigt. (Acte Séparé de Suspension d´Armes).[43] Artikel 1 des Aachener Friedens (18. Oktober 1748) macht deutlich, dass der Kriegszustand erst jetzt als beendet betrachtet wurde: »Une Paix générale succède à la longue et saglante Guerre«, ergänzt durch Artikel 2: »La guerre vient de finir«. Auch finden sich im Definitivfrieden Bestimmungen über den Austausch der Kriegsgefangenen und über die Umsetzung der materiellen Bestimmungen. Der Frieden von Aachen stellt den territorialen Status quo ante in Europa und in den Kolonien wieder her; die politischen und territorialen Bestimmungen des Präliminarfriedens werden weitestgehend bestätigt.[44] So stellt der Präliminarfrieden den für dieses Völkerrechtsinstrument typischen Zwischenzustand her: Die causa belli ist nur »aufschiebend«[45] beseitigt; es ist mehr als Waffenstillstand, jedoch noch nicht Frieden.
69
Im Zuge des Kolonialkonflikts innerhalb des Siebenjährigen Krieges (1756–63) wurde am 3. November 1762 zu Fontainebleau zwischen Großbritannien und Spanien sowie Frankreich ein Präliminarfrieden geschlossen.[46] Nach der Anrufung der Dreifaltigkeit enthält die Präambel die Vertragsmotivation der Wiederherstellung von »union et bonne intelligence« sowie der Festhaltung des in den Verhandlungen gemeinsam erreichten als Basis für einen künftigen »Traité de paix«. Artikel 1 lehnt sich an die Friedensklausel an, enthält jedoch keine definitive Aussage, sondern zieht sich auf den Begriff der amitié zurück und vermeidet paix. Auch das Gebot des Waffenstillstandes und die Amnestie wurden nur verklausuliert ausgedrückt, die Ausdrücke selbst wurden vermieden (Artikel 1).[47] Die Friedensdeklaration folgte erst im Frieden von Paris vom 10. Februar 1763,[48] Artikel 1: »Il y aura une Paix chrétienne, universelle et perpétuelle«; ebenso die Vergessenheit (Artikel 1: »oubli général«) und die Freilassung der Kriegsgefangenen (Artikel 3). Dennoch nimmt auch hier der Präliminarvertrag (neben wirtschaftlichen Bestimmungen) die territoriale Nachkriegsordnung vorweg: Artikel 2, 4, 12, 13, 14 und 17 nahmen bereits Gebietsabtretungen vor; die Abtretung soll – genau wie der Austausch der Kriegsgefangenen (Artikel 23) – jedoch erst nach dem Definitivfrieden erfolgen (Artikel 22). Grenzen in Übersee wurden ebenfalls definiert, um »fondemens solides et durables« für die Wiederherstellung des Friedens zu schaffen (Artikel 6–11, 18). Der Definitivfrieden von Paris nimmt in der Präambel Bezug auf die Präliminarien und erklärte sie zur Grundlage der endgültigen Vereinbarungen. So findet sich besonders im Bereich der Grenzfestlegungen und Gebietsabtretungen eine inhaltlich sehr hohe Übereinstimmung.
1783/84 folgen im Zusammenhang mit der amerikanischen Unabhängigkeit eine Reihe von Präliminarien, in den Verträgen als »Articles préliminaires« bezeichnet, so am 20. Januar 1783 zu Versailles zwischen Großbritannien, den Generalstaaten und Frankreich, am 25. Januar zwischen Spanien und Großbritannien sowie am 2. September 1783 zwischen Großbritannien und den Generalstaaten.[49] Diese späten Präliminarverträge haben sich in Form und Inhalt dem Definitivfrieden angenähert. Sie beginnen mit der Anrufung der Dreifaltigkeit, begründen in der Präambel den Vertrag mit dem Wunsch der Wiederherstellung des Friedens und enthalten in Artikel 1 eine modifizierte Friedensklausel und das Gebot, die Waffen ruhen zu lassen. Territoriale Fragen werden im Vorgriff auf den Definitivfrieden bereits geregelt; für sie ist in Artikel 18 festgehalten, dass sie – ebenso wie andere bestehende Verträge – durch einen »Traité définitif« bestätigt und zum Teil dann vollzogen werden sollen (20. Januar 1783, Frankreich und Großbritannien). Auch ein Kriegsgefangenenaustausch wurde vereinbart, er sollte jedoch erst nach Unterzeichnung des endgültigen Friedens vollzogen werden (25. Januar 1783, Spanien und Großbritannien, Artikel 9). An ihrem Ende standen am 3. September 1783 die Friedensverträge von Paris,[50] in denen auf die Präliminarverträge in der Präambel als grundlegend Bezug genommen wird. Sie beendeten formal den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
Der letzte Präliminarvertrag der Vormoderne wurde am 20. September 1785 zwischen den Generalstaaten und dem Kaiser geschlossen.[51] Auch hier bestand Einigkeit über die Wiederherstellung des Friedens. Nach Anrufung der Dreifaltigkeit folgt eine lange Präambel, in der Motive und Notwendigkeit des Friedensprozesses erläutert werden und ein Definitivfrieden angekündigt wird. Artikel 1 stellt »paix perpetuelle« her. Dieser förmliche Friedensschluß folgte, in inhaltlicher Übereinstimmung mit den Präliminarien, am 8. November 1785 zu Fontainebleau.
70
Trotz ihrer diplomatischen und politischen Bedeutung im 18. und 19. Jahrhundert sind die Präliminarverträge bislang eher unbeachtet geblieben, so dass das von Heinz Duchhardt schon 1979 festgestellte Desiderat »(längsschnittartiger) Untersuchungen der Genesis und der Modifikationen bestimmter völkerrechtlicher Institute im Laufe der Jahrhunderte bis hin zu ihrer Verfestigung oder ihrem Verschwinden im 19. Jahrhundert« unverändert weiter gilt.[52] Der Begriff des Präliminarvertrags wurde im 17. und 18. Jahrhundert zeitgenössisch wenig rezipiert. In den umfangreichen Werken Imanuel Kants, Johann Christian Wolffs oder Emer de Vattels spielt er keine Rolle. Hier bleibt die Prämisse von Hugo Grotius »Inter bellum et pacem nihil est medium« weitgehend grundlegend. Aufmerksamkeit erhält der Begriff höchstens in kleineren Werken, vorwiegend Dissertationen, die zeigen, dass sich die völkerrechtliche Literatur zumindest ab Mitte des 18. Jahrhunderts um Definitionen bemühte. Zu nennen sind hier vier Dissertationen; die früheste erschien 1672 unter dem Titel »De praeliminaribus tractatuum pacis« und stammt aus der Feder von Christian Henelius. Mit der Definition – »tractatio & conventio super iis, quæ expedienda sunt, antequam ad limina Tractatuum de conditionibus Pacis ipsi Legati accedant« geht er nur auf Verträge mit ausschließlich technischen Bestimmungen ein.[53] In der 1708 veröffentlichten »Dissertatio inauguralis de Praeliminaribus Pacis« analysiert Johann Heinrich Schoell, überwiegend mit Bezug zum Hamburger Präliminarvertrag von 1641, die Elemente des Präliminarvertrages, den er in Gegensatz zur Pax universalis stellt. Den Präliminarien spricht er die Aufgabe zu, diese vorzubereiten. Er schreibt: »Consilio igitur admodum salutari Summæ Potestates […] quædam Præliminariter, & ante pacem decidere solent, quo postea ipsi tractatus faciliori cum negotio institui possint« und »Merito haec Præliminaria quasi basin et fundamentum futuræ transactionis possumus appellare«.[54] Zu einer ähnlichen Beurteilung kommen 1736 Christian Johann Feustel in seiner Schrift »Die bisherigen Friedenspräliminarien nach dem Interesse der Staaten von Europa beurteilt«[55] und Johannes Wilhelm Hoffmann in seiner ebenfalls 1736 publizierten Arbeit »De Observantia Gentium Circa Praeliminaria Pacis«,[56] der erstmals eine Unterscheidung in Präliminarfriedensbedingungen und Präliminarverträge vornimmt. Im 19. Jahrhundert begann die Rezeption des Begriffs im Völkerrecht.[57]
71
Aus der Analyse der aufgeführten Präliminarabkommen lassen sich Gestaltungs- und Inhaltsmerkmale ableiten. Präliminarfriedensverträge wurden stets schriftlich fixiert. Eine einheitliche Terminologie der Vertragsbezeichnung entwickelte sich nicht. Es wurden die Begriffe »Articles Préliminaires de Paix«, »Préliminaires de Paix« (1641), »Traité Préliminaire«, »Articles Préliminaires« (1748, 1762, 1783) oder nur »Préliminaires« (1679) parallel benutzt. Analog dazu wurden die lateinischen Begriffe »Præliminaria« oder auch einfach nur »Praedicta Puncta« verwendet. In deutschen Texten des 18. Jahrhundert wurden sie als Friedenspräliminarien oder Präliminarartikel beschrieben. Ihnen wohnt jedoch eine inhaltliche Abstufung inne, wie unten noch zu zeigen sein wird.
Allgemeingültige Formalia – analog zu Friedensverträgen –[58] sind für die Präliminarfriedensverträge nicht herauszustellen. Der Beginn des Vertrags mit einer Intitulatio war im 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts nicht üblich. Ebenso wurde anfangs auf die Anrufung der Dreifaltigkeit verzichtet. Erst mit zunehmendem Gewicht der Verträge wurde dies zu einem festen Bestandteil der Präliminarfriedensverträge, und ab 1736 ist sie bis zur Französischen Revolution allen Verträgen an den Anfang gestellt. Die Präliminarverträge sind nun mehr schlichte Arbeitsinstrumente, ihr Rahmen wird der ihnen zugemessenen Bedeutung nach feierlicher.
Interessant ist bei der Analyse eines Präliminarfriedensvertrags der Blick auf die sprachliche Ausgestaltung. Welche Sprache wurde gewählt? Gibt es Abweichungen von den diplomatischen Gepflogenheiten? Im Allgemeinen blieb die Sprachwahl beim Lateinischen, zunehmend abgelöst und schließlich ersetzt durch das Französische im üblichen diplomatischen Rahmen. Ausnahmen bilden die Verträge der skandinavischen Länder und der deutschen Reichsstände (mit Ausnahme des friderizianischen Preußen) untereinander; hier verwendete man das vertraute Idiom. Auf die Besonderheit des Wiener Präliminarfriedens von 1735 wurde bereits verwiesen. Dies ist jedoch der einzige Beleg für eine politische Funktion der Sprachwahl. Die Betrachtung des in den einzelnen Verträgen verwendeten Tempus führt zu keiner eindeutigen Aussage. Es scheint jedoch vertretbar zu sein, darauf hinzuweisen, dass häufig das Futurum, mitunter sogar der Konjunktiv gebraucht wurde. Dieser Umstand ist besonders relevant und aussagekräftig für den Friedensprozess in der Verwendung innerhalb der Friedensklausel, auf die noch zurückzukommen sein wird.
72
Die inhaltliche Betrachtung der Präliminarfriedensverträge führt zur Unterscheidung von drei Entwicklungsstufen, die Stiens (1968) unter Rückgriff auf die ältere Völkerrechtsliteratur (unter anderem Martens) vorgenommen hat. Allen ist gemeinsam, dass sie während des Krieges geschlossen wurden und sich nicht nur auf die Einstellung von Feindseligkeiten beziehen. Sie dienen der Einleitung eines Friedensprozesses und der Vorbereitung auf einen Friedensvertrag – wenn auch in sehr unterschiedlicher Nuancierung. Besonders die frühen Verträge des 17. Jahrhunderts enthalten – wie gezeigt – überwiegend technische Bestimmungen und werden deshalb als Präliminarkonventionen bezeichnet. Ihr Gegenstand ist noch nicht der Frieden selbst, sondern vielmehr dessen Vorbereitung durch die Festlegung des Rahmens für die künftigen Verhandlungen (Ort und Zeitpunkt, Teilnehmer, mögliche Vermittler, Garantien für die Delegationen). Auf das Ende des Kriegsgeschehens haben sie in der Regel keinen Einfluss. Regelungen bezüglich einer Waffenruhe / einem Waffenstillstand waren (selten) enthalten. Es handelt sich um eine diplomatische Willenskundgebung, die implizit die Verpflichtung der Vertragspartner enthält, in einen Friedensprozess einzutreten. Sie sind daher als pactum de negotiandum, möglicherweise auch bereits als pactum de contrahendo einzustufen.
Davon abzugrenzen sind Präliminarverträge, die materielle Bestimmungen enthalten. Völkerrechtlich wird hier unterschieden zwischen Friedenspräliminarien und Präliminarfriedensverträgen, wobei die Grenzen jedoch fließend scheinen. Der wesentliche Unterschied liegt in ihrem Verhältnis zum späteren Friedensvertrag und zum Fortgang der Kriegshandlungen. Den Friedenspräliminarien wird noch keine bindende Außenwirkung zugesprochen, die Umsetzung ihrer Bestimmungen ist in der Regel vom Abschluss eines Definitivfriedens abhängig. Als Beispiele sind die Verträge von 1558, 1658, 1741 und 1782 anzuführen.[59] Präliminarfriedensverträge verwirklichen im Vorgriff auf einen Friedensvertrag die (oder zumindest einen wesentlichen Teil der) Friedensordnung, die nur in einem Definitivfrieden lediglich einer möglicherweise detaillierteren Bestätigung bedarf.
73
Welches sind nun – neben der o.g. Intitulatio und Präambel – die Merkmale eines Präliminarfriedensvertrages, vor allem verglichen mit einem definitiven Friedensvertrag? Analog zu »echten« Friedensverträgen enthalten fast alle Präliminarfriedensverträge in Artikel 1 die Friedensklausel: »Il y aura paix / Sit et manest pax«. Verwendet wird Futur beziehungsweise auch der Konjunktiv Präsens, der nicht nur – wie in Friedensverträgen – einen beginnenden, in die Zukunft weisenden Prozess, sondern auch eine Begrenztheit ausdrückt. In Abstufung zu dieser eindeutigen Manifestation des Friedenswillens wird mitunter lediglich die Freundschaftsklausel (»amitié« statt »paix«) verwendet, was durchaus als bewusstes Umgehen und Ausdruck des noch nicht vollendeten Friedensprozesses zu verstehen ist, ein »von den Parteien gewolltes Minus gegenüber der Friedensklausel«.[60]
Auch Vergessenheit und Amnestie, die seit dem 16. Jahrhundert Element jedes Friedensvertrages sind, sind häufig in Präliminarfriedensverträgen enthalten (1658, 1748, 1783, 1742, 1745).[61] Seit dem 15. Jahrhundert war die Amnestie fester Bestandteil der Friedensverträge. Sie umfasst nicht nur die Vergessenheit (»oblivio« beziehungsweise »oubli«), sondern auch den Verzicht, im Rahmen der Kriegshandlungen begangene Taten zu verfolgen, sowie die Restitution und Wiedererstattung von Kriegsbeutegut. In der Regel wird Amnestie als Ausdruck der Versöhnung im Anschluß an die Friedensklausel aufgeführt und steht im Gegensatz zum Vae Victis einer Kapitulation. In den Präliminarverträgen findet sie sich mitunter in höheren Artikeln oder verklausuliert unter Umgehung des seit dem 17. Jahrhundert als Terminus technicus gebrauchten Begriffs »Amnestie«. Auch die Freilassung von Kriegsgefangenen kann bereits in Vorverträgen enthalten sein, sie drückt dann bereits einen sehr weit fortgeschrittenen Friedensprozess aus. Gleiches gilt für die Verträge, die bereits territoriale Regelungen postulieren oder gar vollziehend festschreiben.
Das Element der Beendigung des Waffengangs ist naturgemäß ein besonders wichtiges Thema jedes friedenstiftenden Vertrages. Die prinzipielle Unterscheidung zwischen Präliminarfriedensvertag und Waffenstillstand liegt darin, dass ersterer einen Lösungsansatz bietet, der dauerhafter und zielgerichtet angelegt ist.[62] Im Gegensatz zum Waffenstillstand beseitigen Präliminarfriedensverträge bereits die causa belli in Gänze oder zumindest teilweise. In der Regel drückt eine Friedensklausel das Ende des Kriegszustandes aus.
74
Einige Präliminarien haben keinen Einfluss auf den Fortgang des Krieges. So ruhten die Waffen zwischen Großbritannien und Frankreich erst mit dem Frieden von Câteau Cambrésis (2. April 1559), obwohl bereits ein Jahr zuvor ein Vorvertrag unterzeichnet worden war. Auch die Präliminarien von Hamburg (1641) hatten keinen Einfluss auf den Waffengang. Im Allgemeinen ist zu konstatieren, dass Präliminarkonventionen keine Auswirkung auf das Kriegsgeschehen hatten.[63] Friedenspräliminarien sind auch unter diesem Aspekt typische Pacta de contrahendo, d.h. ohne Frieden zu schaffen, legte man die Grundlagen des Friedens fest. Je detaillierter und »definitiver« die Präliminarfriedensverträge wurden, desto selbstverständlicher wurde die Verankerung der Waffenruhe, etwa im Falle der Verträge von Breslau 1742, Füssen 1745 oder Aachen 1748; letzterem Vertrag wurde eine separate »Acte de suspension d´Armes« beigestellt. Eine Ausnahme bilden die Vorverträge 1783; hier enden die Kampfhandlungen erst mit dem Frieden von Versailles vom 3. September 1783. Oft wird von einer Einstellung des Waffengangs als natürliche Folge der Präliminarien ausgegangen. So ist festzuhalten, dass Kriegszustand via pacti in der Regel als beendet betrachtet werden kann, auch wenn de jure noch kein Friedenzustand hergestellt ist. Im jüngeren Völkerrecht wird dies als »Status mixtus« bezeichnet.[64]
Mit Ausnahme der Präliminarkonventionen enthalten die Präliminarien materielle Bestimmungen in unterschiedlicher Ausprägung und Detailtreue. Sind Regelungen wie z.B. Gebietsabtretungen (Breslau 1742, Füssen 1745) oder dynastische Anerkennungen (Wien 1735, Füssen 1745) enthalten, wird deutlich, dass der Friedensprozess schon weit fortgeschritten war. Der Definitivfrieden war dann eine Sache der völkerrechtlichen Vollständigkeit und der detaillierteren Ausgestaltung, deutlich im Falle Breslaus und Berlins 1742 mit beinahe identischen Texten und lediglich präzisierten Artikeln in der genauen Grenzfestlegung. Im Falle Füssens unterblieb sogar der angekündigte Definitivvertrag, der Präliminarfrieden hat hier den »Rang eines Friedensvertrages«.[65]
75
Ihrem Charakter entsprechend enthalten die Präliminarfriedensverträge gegen Ende des Vertragstextes den Vorbehalt des Definitivvertrages. Meist wird die Gültigkeit bis zu dessen Abschluss begrenzt und der Definitivfrieden als Endziel fast immer mit Nennung eines konkreten Zeitraumes genannt. Gerade in den späteren Verträgen ab Mitte des 18. Jahrhunderts fehlt jedoch die zeitliche Begrenzung. Der Bezug zum noch auszuhandelnden Definitivfrieden versteckt sich in einzelnen Artikeln, die die Probleme ansprechen, die noch zu lösen sind, oder die den Vollzug einiger Bestimmungen in der Zukunft ankündigen. So steht am Höhepunkt der Entwicklung des Präliminarfriedens im 18 Jahrhundert implizit oder explizit die Ewigkeit, die einen definitiven Friedensschluß kennzeichnet. Klauseln, durch die sich die Partner für ein Scheitern weiterer Verhandlungen eine Wiederaufnahme der Waffen vorbehalten, fanden sich erstaunlicherweise in keinem der herangezogenen Quellen. Ein Scheitern der Friedensverhandlungen auf der Basis der Präliminarien war eher eine Ausnahme (z.B. Präliminarartikel von Paris, 31. Mai 1727). Auch die Frage, inwieweit die Bestimmungen der Präliminarien für den Definitivvertrag bindend waren, erwies sich als müßig. Gegenteilige Regelungen fanden sich (abgesehen von den Modifikationen der Wiener Präliminairen von 1606) in keinem Fall. Offenbar galt auch für die Präliminarverträge das Motto »Pacta sunt servanda«. Einer der letzten Artikel sieht in der Regel die Ratifikation des Vorvertrages durch den Monarchen vor (Ausnahmen sind die Verträge von 1558 und 1782). Damit ist ein zusammengesetztes Verfahren beschrieben, analog zu Friedens- und anderen völkerrechtlichen Verträgen der Frühen Neuzeit. Am Textende unterzeichnen und siegeln die Bevollmächtigten, die diplomatische, nicht militärische Vertreter ihres Monarchen sind.
Offenbar entsprach der Präliminarvertrag den diplomatischen Erfordernissen der frühneuzeitlichen Staatenwelt, entwickelte er sich doch innerhalb von 50 Jahren zu einem völkerrechtlich üblichen Instrument, das zunehmend inhaltlich differenziert wurde und sich auch in der äußeren Form mehr und mehr einem förmlichen Friedensvertrag annäherte. Besondere Bedeutung erlangte er im 19. Jahrhundert, ehe er im 20. Jahrhundert wieder durch Waffenstillstandsabkommen ersetzt wurde.[66] Die Präliminarverträge beruhen auf der Prämisse eines Verständigungsfriedens zwischen Partnern. Sie passen damit in das diplomatische und politische Inventar der Kabinettskriege, in deren Interesse es stets war, frühzeitig in Verhandlungen einzutreten. Sie stehen in deutlichem Gegensatz zu allen Kriegsbeendigungen, die keinen Spielraum für diplomatische Verhandlungen ließen.
76
Anderson, Matthew Smith: The War of the Austrian Succession 1740–1748, London u.a. 1995.
Arens, Meinolf: Habsburg und Siebenbürgen 1600–1605. Gewaltsame Eingliederungsversuche eines ostmitteleuropäischen Fürstentums in einen frühabsolutistischen Reichsverband, Köln 2001 (Studia Transylvanica 27).
Burkhardt, Johannes: Sprachen des Friedens und was sie verraten. Neue Fragen und Einsichten zu Karlowitz, Baden und »Neustadt«, in: Stefan Ehrenpreis u.a. (Hg.), Wege der Neuzeit. Festschrift für Heinz Schilling zum 65. Geburtstag, Berlin 2007 (Historische Forschungen 85), S. 503–519.
CTS siehe Parry, Clive
Duchhardt, Heinz: Studien zur Friedensvermittlung in der frühen Neuzeit, Wiesbaden 1979 (Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft 6).
Ders. (Hg.): Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und Früher Neuzeit, Köln u.a. 1991.
Ders. u.a. (Hg.): Krieg und Frieden im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Theorie – Praxis – Bilder. Guerre et Paix du Moyen Age aux Temps Modernes Théorie – Pratiques – Représentations, Mainz 2000 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte 52).
Ders.: Peace Treaties from Westphalia to the Revolutionary Era, in: Randall Lesaffer (Hg.), Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One, Cambridge 2004, S. 45–58.
Dumont, Jean (Hg.): Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un Recueil des Traitez d’Alliance, de Paix, de trève, de neutralité, de commerce, etc., qui ont été faits en Europe, depuis le règne de l’empereur Charlemagne jusques à present, Amsterdam 1726–1731, Bd. 1–8.
Feustel, Christian Johann: Die bisherigen Friedens – Praeliminarien nach dem Interesse der Staaten von Europa beurtheilet, Leipzig 1736.
Fisch, Jörg: Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses, Stuttgart 1979 (Sprache und Geschichte 3).
Frey, Linda S. / Frey, Marsha L.: The History of the Diplomatic Immunity, Columbus 1999.
Gooss, Roderich (Bearb.): Österreichische Staatsverträge. Das Fürstentum Siebenbürgen (1526–1690), Wien 1911 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs 9).
Hartmann, Anja Victorine: Von Hamburg nach Regensburg. Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser vom Regensburger Vertrag (13. Oktober 1630) bis zum Hamburger Präliminarfrieden (25. Dezember 1641), Münster 1998 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 27).
Hausmann, Paulus Andreas: Friedenspräliminarien in der Völkerrechtsgeschichte, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 25 (1965), S. 657–692.
Henelius, Christian: De praeliminaribus tractatuum pacis, [Frankfurt/Oder 1672].
Hoffmann, Johann Wilhelm: De Observantia Gentium Circa Praeliminaria Pacis. Frankfurt/Oder 1736.
Janssen, Wilhelm: Art. »Friede«, in: Geschichtliche Grundbegriffe 2 (1975), S. 543–591.
Kraus, Thomas R.: »Europa sieht den Tag leuchten …« Der Aachener Friede von 1748, Aachen 1998 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Aachen 10).
Lesaffer, Randall (Hg.): Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One, Cambridge 2004.
Ders.: Peace Treaties from Lodi to Westphalia, in: ders. (Hg.), Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One, Cambridge 2004, S. 9–44.
Parry, Clive (Hg.): The Consolidated Treaty Series, New York 1969–1981, Bd. 1–231.
Reinhardt, Wolfgang: Kriegsstaat und Friedensschluß, in: Ronald G. Asch u.a. (Hg.), Frieden und Krieg in der Frühen Neuzeit. Die europäische Staatenordnung und die außereuropäische Welt, München 2001 (Der Frieden: Rekonstruktion einer europäischen Vision 2), S. 47–59.
Scharbatke, Hermann: Die Generalamnestie im Friedensvertrag mit besonderer Berücksichtigung des Westfälischen Friedens, Würzburg 1974.
Scheuner, Ulrich: »Friedensvertrag«, in: Wörterbuch des Völkerrechts 1 (1960), Sp. 590–594.
Schmauß, Johann Jacob: Einleitung zu der Staats-Wissenschafft, und Erleuterung des von ihm herausgegebenen Corporis Juris Gentium Academici und aller andern seit mehr als zweyen Seculis her geschlossenen Bündnisse, Friedens- und Commercien-Tractaten, Leipzig 1741–1747, Theil 1–2.
Schoell, Johann Heinrich: Dissertatio inauguralis De Praeliminaribus Pacis, Straßburg 1708.
Stiens, Heinrich: Der Begriff des Präliminarfriedens im Völkerrecht, München 1968.
Vogl, Markus: Friedensvision und Friedenspraxis in der Frühen Neuzeit, Augsburg 1996.
Wellenreuther, Hermann: Der Vertrag zu Paris (1763) in der atlantischen Geschichte, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 71 (1999), S. 81–110.
Ziemann, Benjamin (Hg.): Perspektiven der Historischen Friedensforschung, Essen 2002 (Frieden und Krieg 1).
77
[*] Andrea Schmidt-Rösler, Dr., Institut für Europäische Geschichte Mainz, Wiss. Mitarbeiterin im DFG-Projekt »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
[1] Dt. »Vorfrieden«, Präliminarvertrag usw.; lat. Tractatus praeliminaris, Praeliminaria; frz. Traité préliminaire, Préliminaires de (la) Paix, Articles Préliminaires (de Paix), Préliminaires. Grundlegende Literatur: Stiens, Begriff des Präliminarfriedens 1968; Hausmann, Friedenspräliminarien 1965; Scheuner, Friedensvertrag 1960; allg. zum Hintergrund Lesaffer, Peace Treaties 2004, darin besonders Heinz Duchhardt, Peace Treaties 2004; Heinz Duchhardt, Zwischenstaatliche Friedenswahrung 1991; Ders., Studien zur Friedensvermittlung 1979, besonders S. 89–117; Ders., Krieg und Frieden 2000; Ziemann, Perspektiven 2002; Vogl, Friedensvision 1996; Fisch, Krieg und Frieden 1979; Reinhardt, Kriegsstaat und Friedensschluß 2001.
[2] Vgl. dazu Janssen, Friede 1975, S. 565 f.
[3] Die Präliminarverträge von Krakau 1523 II 22 und 1527 II 28 können aus sprachlichen Gründen hier nicht in die Analyse einbezogen werden. Siehe den Präliminarvertrag von Krakau 1532 II 28 in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007); Hausmann, Friedenspräliminarien, S. 659 f., geht davon aus, dass der erste Präliminartraktat am 6. Juli 1688 in Berlin zwischen Dänemark und den Generalstaaten geschlossen wurde.
[4] Dumont, Recueil des Traitez 1726–1731, Bd. V,1, S. 28, 31–34.
[5] Vgl. Stiens, Begriff des Präliminarfriedens, S. 54 f. Wegen der materiellen Bestimmungen gelten jedoch Einschränkungen für den Präliminarvertrag von Câteau Cambrésis.
[6] Es handelt sich um ein Doppelinstrument: 1. zwischen dem Kaiser, Schweden (und Spanien) und 2. zwischen dem Kaiser, Frankreich (und Spanien). Texte in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen 16. November 2007). Dazu Hartmann, Von Hamburg nach Regensburg 1998, bes. S. 479–495.
[7] Vgl. dazu Frey / Frey, Diplomatic Immunity 1999.
[8] Präliminarvertrag von Ängelholm 1644 X 29 in: Dumont, Recueil des Traitez, Bd. VI,1, S. 304–306.
[9] Vertrag über die Aufnahme von Friedensverhandlungen in Lund 1679 VI 16, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 27 Februar 2008). Zitiert nach der französischen Übersetzung in CTS 15, S. 173–177, hier S. 175.
[10] Waffenstillstand von Lund 1679 VIII 30, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 27. Februar 2008). Zitiert nach der deutschen Übersetzung in CTS 15, S. 213–217, hier S. 215 (Präambel), 217 (Artikel 8).
[11] Friedensvertrag von Lund 1679 IX 26, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007). Zitiert nach der französischen Übersetzung in CTS 15, S. 264–274, hier S. 267.
[12] Präliminarartikel von Oldesloh 1700 VII 18, in französischer Übersetzung in Dumont, Recueil des Traitez, Bd. VII,2, S. 479 f.
[13] Friedenspräliminarien von Wien 1606 II 9, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007). Zum Hintergrund der Vertragsgeschichte vgl. Arens, Habsburg und Siebenbürgen 2001 sowie Gooss, Österreichische Staatsverträge 1911.
[14] Allg. zum Hintergrund und den Details in der Verhandlungsführung Gooss, Österreichische Staatsverträge.
[15] Frieden von Wien 1606 VI 23, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007). Zu den Modifikationen vgl. Gooss, Österreichische Staatsverträge, S. 332–335.
[16] Friedenspräliminarien von Tåstrup/Kopenhagen 1658 II 18, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007). In lateinischer Übersetzung gedruckt in CTS 4, S. 513–518. Für die Übersetzung des dänischen Textes einen Dank an Dr. Bengt Büttner.
[17] Die Ratifikation der Präliminarien durch den schwedischen König 1658 II 19 in lateinischer Fassung gedruckt in CTS 4, S. 519 f.
[18] Präliminarartikel von Den Haag 1709 V 28, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007).
[19] Stiens, Begriff des Präliminarfriedens, S. 9.
[20] Dazu unter anderem Hausmann, Friedenspräliminarien, S. 661.
[21] Schmauß, Einleitung zu der Staats-Wissenschafft 1741–1747, Teil 1, S. 330 f.
[22] Ebd., S. 332.
[23] Zuvor hatten Großbritannien und Frankreich in London eine geheime Vereinbarung getroffen, den Präliminarfrieden von London 1711 X 8, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. Dezember 2007). In einer einseitigen Erklärung hatte Frankreich vorab einigen Friedensprämissen (wie der Anerkennung des Hauses Hannover auf dem englischen Thron oder dem Verzicht auf eine Vereinigung der französischen und spanischen Krone) zugestimmt.
[24] Friedensvertrag, geschlossen am Pruth 1711 VII 21 / 1123 AH. Gedruckter Text (auf türkisch) in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007). In französischer, lateinischer und italienischer Fassung gedruckt in CTS 27, S. 149–155. Bei Dumont, Recueil des Traitez, Bd. VIII,1, S. 275 und S. 297 f. Frieden von Konstantinopel 1712 IV 5_16, in französischer Übersetzung gedruckt in CTS 27, S. 231–237.
[25] Präliminarfriedensrezess von Stockholm 1719 VII 11_22, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007).
[26] Friedensvertrag von Stockholm 1719 XI 9_20, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007).
[27] Präliminarfrieden von Paris 1727 V 31, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 27. Februar 2008).
[28] Präliminarfrieden von Wien 1735 X 3, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 27. Februar 2008). Gedruckt in CTS 34, S. 283–292.
[29] Präliminarfrieden von Wien 1735 X 3, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 27. Februar 2008). Zitat S. 7. Vgl. allgemein dazu jüngst Burkhardt, Sprachen des Friedens 2007.
[30] Ausführungskonvention von Wien 1736 IV 11 in: CTS 34, S. 297–306. In der Präambel heißt es wörtlich: »Sa Majesté Imperiale et Sa Majesté Tres Chret[ienn]e animées d´un desir egal d´affermir de plus en plus la bonne intelligence et amitié, retablies entre Elles et si necessaire pour le bien de la Chretienté, et d´assurer solidement un parfait repos en Europe, loin de se borner à la cessation des hostilitez etablie, declarent, qu Elle veulent proceder aussy promptement qu´il sera possible à l´effectuation des conditions de paix stipulées par les Articles Preliminaires signez et ratifiez de part et d´ autre et voulant à cet effet agir dans un concert par fait, Elles sont convenues des Articles suivants«. Ebd. S. 299. Die Vertragssprache ist erneut das Französische. Auch hier wird in einem Separatartikel der Ausnahmecharakter dieser Sprachgebung betont.
[31] Deklaration von Aranjuez 1736 IV 15, in: CTS 34, S. 307–309 (frz. Übersetzung).
[32] Friedensvertrag von Wien 1738 XI 18, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 27. Februar 2008).
[33] Präliminarvertrag von Belgrad 1739 IX 1, in: CTS 35, S. 359–368.
[34] Friedenspräliminarien von Breslau 1742 VI 11, in: CTS 36, S. 275–283.
[35] Ebd., S. 279. Österreich behielt lediglich Teschen, Troppau, kleinere Teile des oberschlesischen Berglandes sowie die Herrschaft Hennersdorf.
[36] Frieden von Berlin 1742 VII 28, in: CTS 36, S. 409–420.
[37] Siehe Präliminarartikel von Åbo 1743 VI 16, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007). Für die Übersetzung des schwedischen Urkundentextes abermals einen Dank an Bengt Büttner.
[38] Friedensvertrag von Åbo 1743 VIII 7, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007).
[39] Friedenspräliminarien von Füssen 1745 IV 22, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 27. Februar 2008).
[40] Interimskonvention von München 1746 VI 17, Subsidien- und Freundschaftsbündnis von München 1746 VII 21, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (beide eingesehen am 27. Februar 2008).
[41] Präliminarfrieden von Aachen 1748 IV 30, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 27. Februar 2008). Allgemein zum Hintergrund z.B. Anderson, War of Austrian Succession 1995.
[42] Vgl. die Beitritte zum Präliminarfrieden von Aachen 1748 V 25 bis VII 10, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[43] Separater Waffenstillstandsakt in: Präliminarfrieden von Aachen 1748 IV 30, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 27. Februar 2008), S. 24 f. (2 Exemplare).
[44] Friedensvertrag von Aachen 1748 X 18, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 16. November 2007), vgl. Kraus, Aachener Friede 1998.
[45] Hausmann, Friedenspräliminarien, S. 676.
[46] Präliminarfrieden von Fontainebleau 1762 XI 3, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 16. November 2007).
[47] In Artikel XX, 1 wird jedoch zwischen Frankreich und Portugal »une cessation totale d´hostilités« verfügt.
[48] Friedensvertrag von Paris 1763 II 10, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 27. November 2007) vgl. Wellenreuther, Vertrag zu Paris 1999.
[49] Friedenspräliminarien von Versailles 1783 I 20, I 25 und Friedenspräliminarien von Paris 1783 IX 2. Die Verträge 1783 I 20 und IX 2 in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/, davon der Vertrag 1783 I 20 mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 27. November 2007). Den Vertrag 1783 I 25 druckt CTS 48, S. 249–252.
[50] Friedensverträge von Versailles 1783 IX 3 in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/, davon der Vertrag zwischen Frankreich, Großbritannien und Russland mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (beide eingesehen am 27. November 2007). Der Vorfrieden mit den Niederlanden mündete am 30. Mai 1784 in den Friedensvertrag von Paris 1784 V 20, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 27. November 2007).
[51] Friedenspräliminarien von Fontainebleau 1785 IX 20 in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de/ (eingesehen am 27. November 2007).
[52] Duchhardt, Zwischenstaatliche Friedenswahrung 1991, S. 89.
[53] Henelius, De praeliminaribus tractatuum pacis 1674, Zitat S. 3.
[54] Schoell, De Praeliminaribus Pacis 1708, Zitate S. 3, 5.
[55] Feustel, Friedens-Praeliminarien 1736.
[56] Hoffmann, De Observantia Gentium 1736.
[57] Vgl. dazu Stiens, Begriff des Präliminarfriedens, S. 43–49.
[58] Vgl. z.B. Fachportal historicum.net, http://www.historicum.net/themen/friedensvertraege-der-vormoderne.
[59] Ebd. Ob die Unterscheidung zu Präliminarfriedensverträgen jenseits der völkerrechtlichen Theorie sinnvoll ist, bedarf einer Diskussion. Alleine schon die Titulatur »Friedenspräliminarien von Füssen« zeigt die Problematik dieser Unterscheidung in der politisch-historischen Praxis. Schließlich enthalten sie – trotz des Friedensvertragsvorbehalts – sämtliche definitive Regelungen und erfüllen alle Kriterien eines Präliminarfriedensvertrages. Ein definitiver Frieden folgte ja bekanntlich nicht.
[60] Stiens, Begriff des Präliminarfriedens, S. 61. Als Beispiele vgl. die Verträge von 1762 und 1783. Für den Friedensprozess von Wien 1735–1738 sei darauf verwiesen, dass die Präliminarien von 1735 keine Friedensklausel enthielten, so dass sich der Verhandlungsfortschritt in der Konvention vom 14. April 1736 in der nunmehrigen Verwendung manifestiert.
[61] Vgl. dazu Scharbatke, Generalamnestie 1974.
[62] Lesaffer, Peace Treaties from Lodi to Westphalia 2004, S. 37 f., weist jedoch darauf hin, dass es auch auf Dauer angelegte Waffenstillstandsabkommen gibt, die politische Regelungen enthalten: 16. Februar 1471 London für 5 Jahre, 9. April 1609 Antwerpen für 12 Jahre oder 13. Februar 1478 London für 100 Jahre. Als Beispiel für einen inhaltlich weitgehenden Waffenstillstand sei auf den Waffenstillstand von Thorn (5. April 1521) verwiesen.
[63] Eine Ausnahme bildet der Vertrag von Oldesloe vom 18. Juli 1700, der in Artikel 4 eine Waffenruhe verkündete. Text: Dumont, Recueil des Traitez, Bd. VII,2, S. 479.
[64] Zur komplexen völkerrechtlichen Debatte Stiens, Begriff des Präliminarfriedens, S. 64–90.
[65] Hausmann, Friedenspräliminarien, S. 661.
[66] Zu diesem späteren Zeitraum vgl. vor allem Stiens, Begriff des Präliminarfriedens, besonders S. 42–53.
Andrea Schmidt-Rösler, Prälimarfriedensverträge als Friedensinstrumente der Frühen Neuzeit, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 56–77.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008062408>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 57 oder 56–59.
Peter Seelmann *
Aufhebungen und Einschränkungen des Jus albinagii – ein Instrument des Friedens?
Gliederung:
Text:
»La Constitution n’admet point de droit d’aubaine. – Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou Français. – Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois.«[1]
Mit diesen Worten wurde in Frankreich am 3. September 1791 das Droit d’Aubaine verfassungsmäßig aufgehoben, jenes aus dem Mittelalter stammende Recht, welches dem Souverän eines Territoriums gestattete, das Erbe eines in seiner Herrschaft verstorbenen Fremden einzuziehen.[2] Wenngleich auch andere europäische Herrschaften und Gemeinwesen Fremden Restriktionen auferlegten, Eigentum zu besitzen, zu übertragen oder zu vererben, so spielte das Droit d’Aubaine aufgrund seiner Wurzeln und historischen Entwicklung nirgendwo eine so zentrale Rolle wie in Frankreich.
78
Als dieses Recht, das in der deutschen Rechtsterminologie auch als Fremdlingsrecht oder Jus albinagii bezeichnet wird, durch den oben zitierten Verfassungsartikel aus den französischen Gesetzen verbannt wurde, erschien dies verständlicherweise wie ein Meilenstein in der Geschichte des französischen Fremdenrechts. Allerdings war seine Abschaffung zunächst nur vorübergehend, da es unter Napoleon erneut eingeführt wurde und erst 1819 sein endgültiges Ende erfuhr. Zudem war seine Beseitigung die Konsequenz einer Entwicklung, die bereits im Mittelalter begonnen hatte, aber durch Aufklärung und Liberalismus eine eigene Dynamik entwickelte. Eine immer größere Anzahl der in Frankreich lebenden Fremden war nämlich im Laufe der Zeit nicht mehr oder nur noch in geringem Maße von ihm betroffen. Vielfach verzichtete der französische König mittels Privilegien bei bestimmten Personen, Gruppen oder Untertanen anderer Herrschaften auf sein Recht oder forderte nur einen festgesetzten Teil des Erbes ein. Zudem wurden zwischen zahlreichen Souveränen Verträge geschlossen, die in aller Regel dem Prinzip der Reziprozität folgten und in denen die Vertragspartner partiell oder ganz darauf verzichteten, das Jus albinagii auf die Untertanen des jeweiligen Kontrahenten anzuwenden. Vielfach waren diese Abkommen Bestandteil von Friedens-, Bündnis- und Handelsverträgen oder bildeten sogar eigenständige Vertragswerke.
79
Ausgehend von einem erweiterten Begriff des Friedensvertrags nicht nur als Mittel zur Beendigung eines Kriegs oder Waffengangs, sondern auch als Mittel zur Konsolidierung, Ausweitung und Verlängerung des Friedens, stellt sich die Frage, ob diese das Droit d’Aubaine betreffenden Aufhebungs- bzw. Regulierungsakkorde nicht auch als Friedensinstrumente anzusehen sind.[3] Vielmals versicherten sich nämlich die Kontrahenten in den Präambeln ihrer gegenseitigen Bindung und Freundschaft. So nennt beispielsweise der Herzog Carlo Emanuele II. von Savoyen in dem am 8. April 1622 geschlossenen Vertrag mit den katholischen Eidgenossen seine Vertragspartner »amici, colligati et confederati«, und nimmt sie vom Droit d’Aubaine aus, und zwar
»non solo per l’osservanza della lega, quanto per non lasciare alcuna di quelle occasioni, […] che sono in mano n[ost]ra di mostrar a quei SS[ignori] et natione la singolar n[ost]ra affectione verso di loro, et quanto volontieri incontriamo le occasioni di far loro cosa grata«.[4]
Und auch am 24. Juni 1766 schlossen der französische König Ludwig XVI. und Kaiserin Maria Theresia einen solchen Aufhebungsvertrag
»non-seulement de resserrer de plus en plus les liens de l’alliance, de l’union & de l’amitié sincère qui Subsistent entr’Elles, mais encore d’en faire ressentir les effets heureux à leurs Sujets«.[5]
Doch nicht immer waren die Freundschaftsbekundungen so überschwänglich. Wesentlich schlichter heißt es etwa in der am 16. Juni 1766 in Schwetzingen geschlossenen Konvention, deren 2. Separatartikel das Droit d’Aubaine zwischen den Vertragsparteien Frankreich und Kurpfalz aufhebt bzw. einschränkt, dass der Vertrag zustande gekommen sei
»d’affermir leur union réciproque« und »que le meilleur moyen d’y réussir étoit d’encarter tous les sujets de contestation entre Sa Majesté et son Altesse électorale, en faisant un nouvell arrangement définitif qui pût le faire cesser pour toujours«.[6]
Da die angeführten Passagen der Präambeln sich in ihrem Charakter teilweise stark unterscheiden, stellt sich die Frage, inwieweit sich aus ihnen Rückschlüsse auf das Verhältnis der Vertragspartner ableiten lassen. Anhand einschlägiger Exempel aus dem 15. bis 18. Jahrhundert soll deshalb untersucht werden, in welcher Form und in welchem Kontext solche Aufhebungsabkommen des Jus albinagii entstanden sind, welche Motive für deren Abschluss zugrunde lagen, ob sich verschiedene Vertragstypen bestimmen lassen und inwieweit sie Instrumente des Friedens sind. Bevor sich der vorliegende Beitrag jedoch den Aufhebungsverträgen unter diesen genannten Aspekten widmen kann, ist es geboten, vorab einen Überblick über die bisherige Forschung zum Jus albinagii sowie über dessen Entwicklung, Bedeutung, Ausbreitung und Anwendung zu geben, da dieses aus dem Mittelalter stammende Recht in der jüngeren deutschsprachigen Geschichtsschreibung kaum bekannt ist und allenfalls am Rande berührt wurde. Dies ist umso erstaunlicher, als es gerade für Untersuchungen zu aktuellen Themen wie Migration, Fremdheit, überregionalem Handel oder zwischenstaatlichen Beziehungen von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist.[7]
80
Die fehlende Präsenz des Droit d’aubaine als Thema in der deutschsprachigen Forschung spiegelt sich in den knappen und unzureichenden Erklärungen in einschlägigen Nachschlagewerken, wie im Lexikon des Mittelalters, in der Enzyklopädie der Neuzeit oder im Wörterbuch des Völkerrechts.[8] Im Lexikon der europäischen Rechtsgeschichte sucht man gar vergeblich nach einem Eintrag.[9] Etwas ausführlicher stellt sich hingegen der Artikel im Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte dar.[10] Auch deutschsprachige Einzeluntersuchungen berühren das Thema kaum. So wird in dem 1992 erschienenen Sammelband »Deutsche in Frankreich und Franzosen in Deutschland: 1715–1789«[11] das Thema lediglich auf einer knappen Seite angerissen, wenngleich in diesem Zeitraum rund 65[12] das Jus albinagii betreffende Verträge zwischen Frankreich und deutschen Territorien geschlossen wurden. Unter den spärlichen Literaturhinweisen, welche Lexika und Sammelband dem Leser an die Hand geben, ist vor allem der 1958 in den »Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative« erschienene zweiteilige Sammelband »L’étranger« zu erwähnen.[13] In den insgesamt 34 Beiträgen des zweiteiligen Werkes wird die Rechtsstellung von Fremden in europäischen und nicht-europäischen Gesellschaften bzw. Herrschaften thematisiert. Vor allem der zweite Teil liefert wertvolle Einzeluntersuchungen für Frankreich, Spanien, Deutschland, Ungarn, Belgien, Russland, die Schweiz und die Niederlande.
Im Gegensatz zur deutschen thematisiert die französische und angloamerikanische Geschichtswissenschaft das Jus albinagii sehr wohl. So legten Charlotte C. Wells 1995 und Peter Sahlins 2004 je eine Monografie zur Entwicklung der Staatsbürgerschaft in Frankreich vor.[14] Beide Autoren nähern sich dem Staatsbürger- bzw. Untertanenbegriff, indem sie fragen, was einen Fremden kennzeichnet und inwieweit er sich von einem Staatsbürger bzw. Untertanen unterscheidet. Auf diesem Wege setzen sie sich auch intensiv mit dem Droit d’Aubaine auseinander. Wichtige Aspekte zu der Entwicklung und den Ursprüngen des Jus albinagii im Mittelalter sowie zur Befreiung bestimmter Personengruppen von diesem Recht liefern die Untersuchungen von Bernhard d’Alteroche und Werner Paravicini, die beide im Jahr 2002 erschienen sind.[15] Während ersterer das Königreich Frankreich im Blick hat, untersucht letzterer das Herzogtum Burgund. Die Juden des spätmittelalterlichen Frankreich – als eine vom Jus albinagii betroffene Personengruppe – werden in dem 1998 publizierten Aufsatz von William Chester Jordan ins Blickfeld genommen. Thematisch im gleichen Zusammenhang, jedoch auf das 18. Jahrhundert bezogen, steht die bereits 1957 entstandene Arbeit von Zosa Szajkowski.[16] Auch sei an dieser Stelle noch einmal Peter Sahlins genannt, der in »Fiction of a Catholic France« auf verschiedene religiöse Minderheiten eingeht, auch auf die Juden, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts »were not considered ›aliens‹ […] nor […] ›citizens‹ or ›natural Frenchmen‹«.[17] Allerdings dient Sahlins das Droit d’Aubaine abermals vor allem als ein Kriterium zur Abgrenzung Fremder von »Staatsbürgern«. Hinzuweisen ist schließlich noch auf die grundlegenden Arbeiten von Elizabeth Bonner und Mikel Rapport aus den Jahren 1997 und 2000.[18] Während Bonner die Exemtion schottischer Untertanen vom Droit d’Aubaine bzw. deren Naturalisation in Frankreich des 15. und 16. Jahrhunderts untersucht, widmet sich Rapport der allmählichen Überwindung dieses diskriminierenden Rechts im 18. und 19. Jahrhundert.
Der Zugang zu den das Fremdlingsrecht betreffenden Aufhebungsabkommen ist mühsam, da eine systematische Sammlung ebenso wie eine kritische Edition dieser Quellen fehlt. Die Vertragstexte müssen daher aus den verschiedenen älteren Quellensammlungen von Jean Dumont, Clive Parry oder (für das Gebiet der Eidgenossenschaft) Jakob Kaiser zusammengesucht werden.[19] Die Tatsache, dass auch Friedens-, Bündnis- oder Handelsverträge Artikel zum Thema enthalten können, erschwert die Suche weiter. Eine nicht zu unterschätzende Hilfe für die Zeit zwischen 1753 und 1790 bietet dabei das Verzeichnis der Aufhebungsverträge in Peter Sahlins’ »Unnaturally French«. Erfreulich ist auch die Verfügbarkeit einiger Verträge in digitalisierter Form über die Datenbanken des Instituts für Europäische Geschichte[20] sowie des Archivs des Französischen Außenministeriums.[21]
81
Der Aussage von Eugène Lefèvre de la Planche,[22] das Droit d’Aubaine sei ein so altes Herrschaftsrecht, »qu’on n’en voit point l’origine«, ist im Wesentlichen heute noch richtig, sei es hinsichtlich des Ursprungs dieses Rechts, sei es in Bezug auf die Etymologie der Begriffe aubaine und aubain bzw. ihrer lateinischen Ursprünge albinagium und albanus/albinus. Nachzuweisen ist der Begriff erstmals in einer Urkunde aus dem Jahre 820, in der Ludwig der Fromme dem Pariser Bischof Inchad und dessen Nachfolgern bestätigt, dass kein Graf oder Gerichtsherr Steuern von den Gütern der Bischofskirche erheben darf, weder von der »familia ipsius Ecclesiae, ne que de aliis liberis hominibus, vel incolis, quae rustice Albani appellantur, in ipsa terra sanctae Mariae manentibus«.[23] Der Begriff albani, mit dem die übrigen Bewohner auf dem Lande belegt werden, wird in der modernen Geschichtswissenschaft mehrheitlich vom lateinischen alibi nati (anderswo Geborene) hergeleitet.[24]
Beim Jus Albinagii geht es aber nicht, wie die wörtliche Übersetzung des Wortes vermuten ließe, um das Fremdenrecht im Allgemeinen, sondern lediglich um einen spezifischen Aspekt des Fremdenrechts, nämlich, wie bereits angedeutet, um das Recht des Souveräns, Güter eines auf seinem Territorium verstorbenen Fremden einzuziehen. Nachzuweisen ist es ursprünglich vor allem in den mittleren und nördlichen Gebieten der ehemaligen Francia Occidentalis, d.h. im nördlichen Frankreich und in den weitgehend unabhängigen niederländischen Fürstentümern. In den südlicheren Gebieten, in denen die römische Kultur stärker verwurzelt war, hatte es hingegen keine Tradition und konnte später nur, teilweise gegen massive Widerstände, sukzessive durchgesetzt werden.[25] Dies lässt darauf schließen, dass altes römisches Recht wie beispielsweise die Lex Falcidia, welche gleichfalls Fremden zu testieren verbot und durchaus Parallelen aufweist, für das Jus albinagii weniger eine Rolle gespielt haben dürfte als germanische Rechtsvorstellungen.[26]
So galt bei den in erster Linie personal organisierten germanischen Stämmen der Fremde, der weder durch Geburt noch Schwur an die Gemeinschaft gebunden war, als potentieller Feind und deshalb als rechtlos. Suchte man – aus ökonomischen und politischen Beweggründen – dennoch Kontakt zu anderen Stämmen oder Herrschaftsverbänden, dann gewährte man Fremden besonderen Schutz (Mundium bzw. mundiburdium), der seit karolingischer Zeit dem König oblag. Als Gegenleistung hierfür, aber auch weil der Fremde zu bestimmten gemeinschaftlichen Aufgaben, wie beispielsweise dem Waffendienst, nicht herangezogen wurde, fiel im Todesfall des Mündels dessen Nachlass seinem Schutzherrn zu.[27] Darüber hinaus kann das Fremdlingsrecht als ein Aspekt des Heimfallrechts (jus caducitati) begriffen werden: Da dem Fremden aufgrund seiner Rechtlosigkeit das aktive und passive Erbrecht abgesprochen wurde, fehlten zwangsläufig legitime Erben und das »herrenlose« Vermögen fiel als bona vacantia dem Fiskus zu.[28] In der älteren Literatur und in Quellen werden deshalb die Begriffe Jus albinagii und Heimfallsrecht synonym verwendet, was jedoch missverständlich ist, weil sich letzteres als wesentlich umfassender darstellt.[29]
Seit fränkischer Zeit in der Hand des Königs, gelangte das Jus albinagii wie auch andere Regalien mit der Auflösung des Karolingerreiches und im Zuge der fortschreitenden Feudalisierung an örtliche und regionale Herrschaftsträger wie Fürsten und adelige Lehnsherren, neben die seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert auch Städte traten. Diesen Dezentralisierungstendenzen wirkte im Westen des ehemaligen Frankenreiches das allmählich erstarkende kapetingische Königtum entgegen, das bestrebt war, diese Herrschaftstitel wieder an sich zu bringen. Im Falle des Fremdlingsrechts reichen entsprechende Versuche in die 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts zurück.[30] Die einheitliche Durchsetzung des Droit d’Aubaine als alleiniges, königliches Recht stieß jedoch aus den unterschiedlichsten Motiven auf heftigen Widerstand und gestaltete sich als ein langwieriger Prozess, der weit bis in die Neuzeit hineinreichte.[31]
82
Neben dem Droit d’Aubaine im eigentlichen Sinne, das sich vor allem in Frankreich, Burgund und einigen Gebieten der Niederlande etablierte, finden sich in den östlichen Gebieten des einstigen Karolingerreiches andere Formen dieses Rechts wieder. Dazu gehörten das Wildfang– oder Biesterrecht sowie die gabella hereditaria. Ersteres beschränkte sich lediglich auf den Westen des Heiligen Römischen Reiches und wurde in der Kurpfalz noch bis weit ins 17. Jahrhundert ausgeübt. Nach ihm wurde ein heimatloser Mann (Wildling), der sich in einer unfreien Gemeinde niederließ, nach Jahr und Tag unfrei.[32] Bei der gabella hereditaria handelte es sich hingegen um eine 10- bis 50-prozentige Erbschaftssteuer, die Fremde bei der Ausfuhr von ererbtem Vermögen zu entrichten hatten.[33] Im Zusammenhang mit ihr wird häufig die gabella emigrationis (droit d’issue, Abfahrtsgeld) genannt, eine vergleichbare Abgabe, die Auswanderer auf mitgeführtes Vermögen entrichten mussten. Sie betraf Untertanen, das heißt Nichtfremde ebenso wie wiederauswandernde Fremde, weshalb sie kaum »als Abgeltung für den Ausfall der G[abella] Hereditaria«[34] und damit als eine Form des Jus albinagii verstanden werden kann. Die Unterscheidung dieser beiden wie auch weiterer vergleichbarer Abgaben – genannt sei hier noch die traite foraine als allgemeine Ausfuhrsteuer – ist nicht immer einfach, weil sie in frühneuzeitlichen Quellen teils undifferenziert, teils uneinheitlich mit Begriffen wie Abschoss, Abzug, Jus Detractus oder Nachsteuer bezeichnet werden.[35]
Als Gemeinsamkeit bleibt jedoch festzuhalten, dass Jus albinagii, Gabella Hereditaria und Gabella Emigrationis nicht nur eine Einnahmequelle des Souveräns bildeten, sondern vor allem den Zweck hatten, den Abfluss von Vermögen in andere Herrschaften zu erschweren beziehungsweise zu verhindern. Aus diesem Grund, aber vor allem im Zuge von Retorsionsmaßnahmen gegen Frankreich, fanden das Jus albinagii und seine verwandten Formen auch in anderen Ländern des frühneuzeitlichen Europa und sogar darüber hinaus Verbreitung. Ihr Abbau war Gegenstand und Verhandlungsmasse zahlreicher Übereinkünfte, die zunächst in Form von Privilegien, dann, seit dem 16. Jahrhundert, als Artikel in Friedens-, Bündnis- und Handelsverträgen und schließlich seit Beginn des 18. Jahrhunderts in eigenständigen Aufhebungsverträgen festgeschrieben wurden, wobei die älteren Formen durchaus weiterexistierten.[36] Die Motive für Aufhebungen und Exemtionen des Droit d’Aubaine auf zwischenherrschaftlicher Ebene konnten sehr unterschiedlich sein. Sie reichen von Wirtschaftsförderung über Territorialansprüche und territorialer Integration bis hin zur Festigung von Bündnissen und diplomatischen Beziehungen, wobei es durchaus zu Überschneidungen kommen konnte. Im Folgenden wird die Ausbildung der Vertragsformen anhand von Beispielen in den Blick genommen, die den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch sowie die Festigung zwischenherrschaftlicher Eintracht förderten und von daher als Friedensinstrumente zu bezeichnen sind.
83
Am Anfang standen personell erteilte Einzelprivilegien oder Einbürgerungen, wobei letztere hinsichtlich der Erbberechtigung den gleichen Effekt hatten. In ihren Genuss kamen vor allem solche Fremde, deren Zuzug in besonderem Maße gewünscht war und gefördert werden sollte. In der Regel handelte es sich um Personen, die im Dienste des Souveräns standen, besondere Fähigkeiten besaßen, bestimmten Berufsgruppen angehörten oder Untertanen befreundeter oder verbündeter Herrschaften waren. Dass sich diese Beweggründe überlagern konnten, zeigt folgendes Beispiel:[37]
Am 21. April 1475 verzichtete Ludwig XI. auf die Ausübung des Droit d’Aubaine zugunsten der Mainzer Drucker, Verleger und Buchhändler Peter Schöffer und Konrad Henkis, nachdem deren Pariser Agent Herman de Stathoen verstorben war. Er verspricht, den Gegenwert der bei Stathoen gefundenen Bücher zurückzuerstatten. Als Grund für sein Entgegenkommen nennt er seine Hochachtung für seinen Verbündeten, den Römischen König, der in dieser Angelegenheit geschrieben habe, sowie für den Mainzer Erzbischof, dessen Untertanen eine bevorzugte Behandlung erfahren sollten. Zudem schätzte der französische König die Mühen und Anstrengungen, welche die beiden Mainzer Unternehmer für die Druckkunst auf sich genommen hätten zum allgemeinen Nutzen wie auch zur Mehrung der Wissenschaft.[38]
Bei seinem Verzicht auf das Jus albinagii ging es Ludwig XI. offensichtlich gleichermaßen um die Förderung des wirtschaftlichen und kulturellen Austauschs – nämlich der Druckkunst und der Verbreitung der dadurch entstandenen Produkte – wie um eine Bestätigung seines guten Verhältnisses zu den beiden deutschen Fürsten, mit denen er durch den mit Kaiser Friedrich III. am 25. März 1475 in Köln geschlossenen Allianzvertrag verbündet war. Wenngleich es sich im Falle von Peter Schöffer und Konrad Henkis um eine Einzelexemtion und nicht um einen Vertrag mit zwischenstaatlichem Charakter handelte, bekam sie durch die Intervention des Kaisers und des Mainzer Kurfürsten eine politische wie diplomatische Dimension. Gerade der Verzicht auf das Droit d’Aubaine in Bezug auf bestimmte Berufsgruppen aus bestimmten Herkunftsländern durch ein Privileg konnte Ausdruck oder Beginn eines engeren intersouveränen Verhältnisses sein, das in späterer Zeit zum Teil auf eine vertragliche Ebene gehoben wurde, wie sich im Falle der Schweizer Eidgenossen demonstrieren lässt.
Noch als Dauphin hatte der spätere französische König Ludwig XI. 1444 während der Schlacht bei St. Jakob an der Birs unweit von Basel die Schlagkraft eidgenössischer Soldaten kennengelernt. Beeindruckt hiervon war er seit dem im selben Jahr geschlossenen Frieden von Ensisheim bestrebt, den einstigen Gegner durch Bündnis- und später Freundschaftsverträge mit weitgehenden Handelsprivilegien an sich zu binden und eidgenössische Söldner in seinen Dienst zu nehmen. Abgesehen von den Auseinandersetzungen um Mailand, die mit dem am 29. November 1516 in Freiburg geschlossenen Ewigen Frieden beendet wurden, sollte das französisch-eidgenössische Bündnis für Jahrhunderte Bestand haben und eidgenössische Söldner für Frankreich kämpfen lassen.[39] Personen, die im Dienst des Königs standen, wurden in aller Regel vom Fremdlingsrecht befreit, so auch die Schweizer Garde.[40] Dies geschah lange Zeit in Form von generellen Patenten[41] zugunsten der Söldner und ihrer Familien.
In einigen dieser Privilegien kommt deutlich zum Ausdruck, dass neben Beruf oder Dienstverpflichtung jener Personen auch das Herkunftsland und das besondere Vertrauen zu diesem von Belang waren. Darüber hinaus spielten auch familiäre Bindungen eine Rolle, die nach und nach zwischen Eidgenossen und Franzosen entstanden waren – eine Entwicklung, welche in den Patenten als ein Grund für die Exemtion angegeben wird, die aber zugleich durch die Befreiung vom Droit d’Aubaine zusätzlich gefördert wurde. Entsprechend heißt es in der Anordnung vom 8. Oktober 1498, die kurz nach der Gründung der königlichen Leibgarde compagnie des Cent-Suisses[42] ausgegeben wurde und sich auf frühere Patentbriefe bezieht: In Anbetracht der Freundschaft und Wertschätzung Ludwigs XII. und seiner Vorgänger für die »très cher et très grands amis les signeurs et communautez des anciennes ligues des Hautes Alemagne« sowie der großen Anzahl von Eidgenossen, die bereits im Dienste Ludwigs XI. gestanden hätten, aber auch weil
»plusieurs desdits Suisses se fussent mariez et habituez en cesluy nostre royaume et y eussent acquis plusieurs biens, meubles, immeubles, héritages et possessions de libertés d’y demeurer et finir leurs jours«,
sei es allen Angehörigen besagter nation erlaubt, bewegliche wie immobile Güter zu erwerben und darüber zu verfügen. Eidgenossen dürften diese Güter vererben, verschenken und an ihre Frauen sowie an ihre in Frankreich geborenen Kinder weitergeben, vorausgesetzt, sie wohnten dauerhaft in Frankreich und wären dort verheiratet oder für einen zeitlich begrenzten Zeitraum gekommen, um dem Königreich zu dienen.[43]
84
Im Gegensatz zu den Erlässen und Patenten finden sich in den französisch-eidgenössischen Bündnis- und Freundschaftsverträgen des 15. bis 17. Jahrhunderts keine ausdrücklichen Regelungen zum Droit d’Aubaine, sondern eher allgemeine Formulierungen wie: »Reservamusque eisdem armatis omnes et singulas emunitates privilegiaque, quibus ceteri a nobis stipendiati gaudent et pociuntur.«[44] Das änderte sich am 9. Mai 1715 mit dem Bündnisvertrag von Solothurn zwischen Frankreich und den katholischen Kantonen: Noch am selben Tag wurde der Vertrag durch ein Geheimabkommen gegen die reformierten Orte ergänzt. In diesem sogenannten »Trücklibund« wird erklärt, das offizielle Bündnis sei geschlossen worden mit dem Hauptziel des »restablissement de la Catholicité et le maintien du Louable Corps Helvetique en general.«[45] Es scheint kein Zufall, dass die Aufhebung des Droit d’Aubaine just in dem Augenblick vertraglich festgehalten wurde, als sich die katholischen Orte – wie durchaus schon zuvor – mit dem katholischen Frankreich verbündeten, aber sich zugleich – und das war neu – mit den protestantischen Eidgenossen außenpolitisch auf einen eindeutigen Konfrontationskurs begaben. Zwar folgt die vertragliche Regelung des Jus albinagii einer allgemeinen, seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zu beobachtenden Tendenz; im hier beschriebenen Fall erscheint sie jedoch zusätzlich als Ausdruck größter politischer Nähe. Mit Artikel 24 des Bündnisvertrages werden alle (katholischen) Eidgenossen rechtlich Franzosen gleichgestellt:
»Les Suisses seront censés Regnicoles [!], et comme tels seront exempts du droit d’aubaine dans les Royaumes & états de l’obéissance du Roi en justifiant de leur naissance, et qu’ils seront sortis de leur pays avec l’agrément de leurs sup[erieu]rs«.[46]
Sie wurden zudem vom Abzug (traite foraine) befreit und erhielten im Hinblick auf die Berufswahl die gleichen Rechte wie Franzosen; eidgenössische Soldaten, die in französischen Diensten standen oder bereits drei Jahre in Folge gestanden hatten, bekamen darüber hinaus sämtliche Privilegien und Exemtionen früherer Könige Frankreichs bestätigt.
Dem Prinzip der Reziprozität folgend, wurde in Artikel 25 französischen Untertanen gestattet, Erbschaften und Besitz in der Eigenossenschaft anzutreten. Auch deren Besitzrecht sollte künftig weder dem Droit d’Aubaine noch dem Abzug oder ähnlichem unterliegen. Würde einem Franzosen ein Vermögen in der Eidgenossenschaft zufallen, sollte es die gleiche Behandlung erfahren wie das Vermögen eines Einheimischen, jedoch unter dem Vorbehalt von Regalien und anderen gebräuchlichen Rechten. Diese Formulierung legt in Hinblick auf spätere Verträge nahe, dass gegebenenfalls doch Steuern (Abzug) bei einem Vermögenstransfer erhoben werden konnten.
85
Die protestantischen Kantone hingegen erlangten erst am 7. Dezember 1771 eine vertragliche Regelung über das Droit d’Aubaine. Sie wurde in einem eigenständigen Aufhebungsvertrag festgeschrieben, einem Vertragstyp, der erst Anfang des 18. Jahrhunderts aufkam, und dessen sich Frankreich verstärkt seit der zweiten Jahrhunderthälfte bediente, als das Land im Rahmen einer – auch in religiöser Hinsicht – liberaleren, von der Aufklärung geprägten Politik vermehrt intersouveräne Abkommen über die Reduzierung und Abschaffung des Droit d’Aubaine schloss.[47] In diesem Kontext muss der Aufhebungsvertrag von 1771 ebenso gesehen werden wie als Ausdruck einer Annäherung zwischen den protestantischen Kantonen und Frankreich, die durch den Sturz des französischen Außenministers Étienne-François Choiseul noch befördert wurde.[48]
In der Präambel bestätigte der französische König das gute Verhältnis zu seinen Vertragskontrahenten, die mit dem Wunsch an ihn getreten seien, das Fremdlingsrecht aufzuheben. Indem er diesem Wunsch nachkomme, gebe er
»auxdits Louable Etats des preuves de son affection et bienveillance Royale, et à se preter à tout ce qui peut affermir de plus en plus l’ancienne union conféderale, amitié et bonne intelligence«.[49]
Wenngleich es sich um eine bilaterale Abmachung in vertraglicher Form handelt, ist sie durch die Betonung des königlichen Wohlwollens mit einem Privileg vergleichbar. Auf der anderen Seite verweist der Aufhebungsvertrag deutlicher auf die gute Beziehung zwischen den Vertragsparteien als die Präambel des Bündnisvertrags mit den katholischen Eidgenossen von 1715. Offenbar sollte diese diplomatische Formulierung Vertrauen schaffen und Kontinuität suggerieren.
Inhaltlich ist der Vertrag von 1771 mit den Artikeln des Bündnisvertrags von 1715 vergleichbar. Allerdings wurden die Einschränkungen, die im Bündnisvertrag mit den katholischen Eidgenossen lediglich angedeutet waren, nun klar formuliert: Die Aufhebung galt nur, wenn dadurch keine lokalen Herrschaftsrechte von Städten, Territorien oder Lehnsgebieten berührt wurden. Ausdrücklich wurde den Souveränen zugestanden, gegen Untertanen aus jenen lokalen Herrschaften, die nicht von ihren besagten Rechten ablassen wollten, reziproke Maßnahmen zu richten.[50] Im Vergleich mit den beiden Bündnisartikeln von 1715 fällt schließlich noch das Fehlen von Abmachungen in Bezug auf eidgenössische Soldaten und deren Privilegien auf; sie waren durch das Ausscheiden der protestantischen Kantone aus dem Bündnis überflüssig geworden.
Der Einfluss von Aufklärung und Liberalismus auf die französischen Politik seit der Jahrhundertmitte sowie die allmähliche Verbesserung und Intensivierung der französischen Beziehungen zu den eidgenössischen Kantonen beider Konfessionen spiegelt sich auch in der Karriere des Schweizer Protestanten Jacques Necker wider, der sich nachdrücklich für eine gesetzliche Abschaffung des Droit d’Aubaine einsetzte.[51] Als junger Bankangestellter 1750 nach Paris gekommen, gehörte er 1762 zu den Gründern der Bank Thellusson & Necker und brachte es schließlich 1777 an die Spitze der königlichen Finanzverwaltung.[52] Nicht zuletzt seinem Einfluss war das Zustandekommen des Bündnisvertrags vom 28. Mai 1777 zwischen Frankreich und allen dreizehn, protestantischen wie katholischen, Schweizer Kantonen zu verdanken.[53] Artikel 19 bestätigte die vorherigen Vereinbarungen über das Jus albinagii, und zwar diejenigen mit den katholischen Kantonen ebenso wie den Vertrag mit den protestantischen Kantonen von 1771.[54] Wie bei letzterem wird festgeschrieben, dass hinsichtlich des Abzugs gegebenenfalls lokales Recht gelte und in jedem Fall das Prinzip der Reziprozität zu beachten sei. Da vergleichbare Einschränkungen nicht generell Gegenstand von Aufhebungsverträgen waren, die Frankreich mit anderen Souveränen schloss, dürften sie von eidgenössischer Seite eingebracht worden sein, womit deren föderaler Organisation Rechnung getragen wurde.
Im Falle der Eidgenossenschaft lässt sich zusammenfassend sagen, dass Frankreich die Exemtionen vom Droit d’Aubaine zunächst aufgrund militärisch-strategischer Interessen gewährte. Zusammen mit anderen Privilegien gehörten sie zu den Anreizen, die wegen ihrer Kampfstärke gerühmten eidgenössischen Söldner anzuwerben und sich deren Loyalität zu sichern. Die Ausweitung dieser Privilegien auf andere Teile der eidgenössischen Bevölkerung hatte eine festigende Wirkung auf das französisch-eidgenössische Bündnisverhältnis. Das Fremdlingsrecht spielte in diesem Zusammenhang eine kaum zu überschätzende Rolle, denn seine Aufhebung, die schließlich Bestandteil der Bündnisverträge wurde, räumte ein Hemmnis für Handel und Auslandsinvestitionen beiseite und vereinfachte Niederlassungen im jeweils anderen Land bis hin zur Familiengründung. In diesem Sinne, aber auch aufgrund der Freundschaftsbezeugungen in den Präambeln, sind die hier besprochenen Vereinbarungen – zunächst in Form von Privilegien, später in Form von Vertragsartikeln oder eigenständigen Verträgen – ebenso wie Handels- oder Heiratsverträge als Instrumente des Friedens anzusehen.
86
Eine weitgehend analoge Entwicklung der Exemtionen vom französischen Fremdlingsrecht lässt sich auch im Falle Schottlands beobachten. Allerdings unterscheiden sich dessen Voraussetzungen in einem Punkt grundlegend von denen der Eidgenossenschaft: Durch seine monarchische Verfassung ergab sich die Möglichkeit dynastischer Verbindungen, wodurch ein zusätzliches Instrument der Friedens- und Freundschaftswahrung zur Verfügung stand und in Verbindung mit den Exemtionen vom Droit d’Aubaine wirken konnte. Bereits seit 1295 bestand zwischen Frankreich und Schottland ein vor allem gegen England gerichtetes Bündnis, die sogennante Auld Alliance, die nahezu durchgängig bis zum Vertrag von Edinburgh (1560 VII 6) Bestand haben sollte.[55] Vor allem im 15. Jahrhundert, während der Herrschaft Karls VII., bekam das Bündnis eine neue Qualität, als der französische König im Kampf gegen England in besonderem Maße auf die Unterstützung schottischer Truppen, die hohe Verluste erlitten, angewiesen war. Ausdruck für diese nun noch engeren Bande ist nicht nur die Eheschließung zwischen Karls Sohn, dem späteren Ludwig XI., und Margarethe von Schottland am 13. Juni 1436, sondern auch die Installierung der aus 200 schottischen Elitesoldaten bestehenden königlichen Leibgarde im Jahre 1445, der sogenannten »garde ecossaise«, sowie die Vergabe von Land, Lehen und Titeln an verdiente schottische Adlige seit den 1420er Jahren.[56] Knapp 30 Jahre nach der Vergabe von Land, Lehen und Titeln finden sich dann die ersten Beispiele für Schotten, denen individuell die »libertas testandi« zugestanden wurde, nachdem sie mittlerweile in Frankreich geheiratet und sich etabliert hatten. Letztlich handelt es sich dabei um nichts anderes als um weitreichende Exemtionen vom Jus albinagii, die Bonner nicht zu Unrecht als eine Form der »lettres de naturalité« verstanden wissen will.[57] Auch in der Folgezeit entstanden vielfältige familiäre Beziehungen in den unterschiedlichen sozialen Schichten bis hin zu den königlichen Familien.[58] Diese wurden durch solche individuellen Exemtionen beziehungsweise Einbürgerungen erleichtert.[59] Eine generelle, für alle Schotten gültige und umfassende Aufhebung des Droit d’Aubaine gewährte dann Ludwig XII. mit dem Naturalisierungsbrief vom September 1513. Bedrängt von der Heiligen Liga, insbesondere von den Truppen Heinrichs VIII., war er im höchsten Maße auf die Loyalität Schottlands angewiesen.[60] Dementsprechend ist im Patentbrief zu lesen:
»the laudable and commendable service which our said good brother, cousin and ally, the present king of Scotland, is actually doing us, as it is notorious, that, in the pursuance of our said friendship fellowship, confederacy and alliance, he hath voluntarily declared for us against the king of England, his brother-in-law, who is at present in our said kingdom; and moreover, hath sent us succours and arms by sea, of great number of ships and men of war, which is so timely a service, as well requires that his subjects be forever recommended and favoured in our said kingdom«.[61]
Alle Schotten, die sich in Frankreich niederlassen wollten, hätten künftig das Recht im ganzen Land Grund und Boden zu erwerben und darüber zu verfügen, »as if they were natives of said Kingdom.«[62] Auch kirchliche Ämter und Benefizien, zu denen Fremde grundsätzlich keinen Zugang hatten, durften auf sie übertragen werden. Dies war ein Novum, denn es ist kein früheres Beispiel bekannt, in dem die französische Krone die gesamten Untertanen eines verbündeten Landes ihren eigenen gleichgestellt hätte. Die Reziprozität war jedoch auch in diesem Fall Bedingung, denn: »the said King of Scotland, and his successors, shall grant and allow such and like privileges to our subjects in their said kingdom.« Wenngleich wesentliche Elemente vertraglicher Übereinkünfte wiederzufinden sind, handelt es sich hier abermals um ein Privileg und nicht um einen Vertrag im eigentlichen Sinne.
Selbst auf dem Höhepunkt der Beziehungen zwischen Frankreich und Schottland, als mit der Heirat des französischen Dauphins Franz II. mit Maria Stuart am 24. April 1558 die Königreiche vereinigt wurden, finden sich in den relevanten Verträgen[63] weder Abmachungen über das Droit d’Aubaine noch über den Status der schottischen Untertanen. Die rechtliche Gleichstellung mit den französischen Untertanen gewährte König Heinrich II. den Schotten im Juni 1558 in Form einer allgemeinen Naturalisierung (lettres de naturalisation), nachdem die
»députez des Estats du royaume d’Escosse ayent, pour et au nom desdicts Estats, faict à nostre fils le serment de fidélité, comme à leur vray et naturel seigneur qu’il est, au moyen de quoy s’estans les subjects des deux royaumes«.[64]
Offenbar beabsichtigte Heinrich II. mit der Privilegierung der Schotten, deren Integration in das neue Herrschaftsgebilde zu befördern und die Reiche zusammenwachsen zu lassen. Dazu war nicht nur die Anerkennung seines Sohnes als Souverän notwendig, sondern eben auch die rechtliche Gleichbehandlung alter wie neuer Untertanen. Diese gewährte der französische König den Schotten ausdrücklich »pour mieux establir, entretenir et fortifier ceste amitié entre nosdicts subjects et ceux dudict royaume d’Escosse.«[65] Wie bereits im Falle der Schweiz, allerdings durch die dynastischen Verbindungen mit weiterreichenden Absichten, wurden durch die Einbürgerung und der damit verbundenen Aufhebung des Droit d’Aubaine, familiäre und wirtschaftlichen Beziehungen enger geknüpft.
87
Die politische und konfessionelle Situation in Schottland vereitelte jedoch die endgültige Vereinigung der beiden Reiche: Zunächst erhoben sich die schottischen Protestanten gegen die Regentschaft der katholischen Königinmutter Maria de Guise und ihrer französischen Berater; die Protestanten wurden dabei von englischen Truppen unterstützt, so dass sich Franzosen und Engländer auf schottischem Boden direkt gegenüberstanden. Nach dem Tode der Königinmutter am 11. Juni 1560 konnten sich englische und französische Abgesandte bereits am 6. Juli im Vertrag von Edinburgh auf den Abzug ihrer Truppen aus Schottland einigen, der den schottischen Protestanten das Feld überließ und formal das Ende der Auld Alliance bedeutete. Erst recht schien das Ende der alten Freundschaft besiegelt, als am 5. Dezember 1560 König Franz II. überraschend starb.[66] Doch anders als bei zahlreichen Verträgen, die aufgrund kurzfristiger Interessen zustande kamen, hatten sich während der Jahrhunderte dauernden französisch-schottischen Freundschaft, die durch eine langfristige Bündnis- und Heiratspolitik sowie dauerhafte Privilegierungen gefestigt war, zahlreiche familiäre, personelle, ökonomische wie auch kulturelle und soziale Beziehungen ergeben. Besonders auf den drei erstgenannten Gebieten wurde die Verflechtung durch die Gewährung des Erbrechts, sei es aufgrund von Exemtionen oder Naturalisierungen, gefördert, wenn nicht sogar ermöglicht.[67] Nach einer vorübergehenden Abkühlung wurden die Beziehungen bereits unter Heinrich IV. erneut intensiviert und 1599 die allgemeine Naturalisierung bestätigt ebenso wie die Handelsprivilegien schottischer Kaufleute. Weitere allgemeine Naturalisierungspatente für schottische Untertanen folgen 1612 und 1646.
1615 befreite Ludwig XIII. die Gesamtheit der britischen Untertanen vom Droit d’Aubaine. Dies geschah nicht zuletzt deshalb, weil Jakob IV. seit 1603 auch den englischen Thron inne hatte und die familiären Bande zwischen den Stuards und den Bourbonen nach wie vor fest geknüpft waren.[68] Dass die Bindung zwischen Schottland und Frankreich in dynastischer Hinsicht auch in der Folgezeit eng war, ist hinlänglich bekannt.[69] Bemerkenswert ist aber die daraus resultierende Konsequenz, die Jean-Baptiste Denisart 1766 wiedergibt:
»Les Anglois & les autres Sujets du Roi Jacques II, qui ont suivi ce Prince en France, jouissent à certains égards des priviléges des Regnicoles. Sans être naturalisés ils forment dans ce Royaume un Corps de Peuple séparé, qui, toujours attaché à la Maison des Stuards, […] recueillent leurs successions, les partagent & disposent de leur biens, selon les Loix de leur Pays.«[70]
Indem der französische König die noch treu zu den Stuarts stehenden Untertanen vom Droit d’Aubaine befreite, genossen sie aufgrund der dynastischen Verbindung der Stuarts die alte Freundschaft Frankreichs selbst im Exil. Denisart wie zuvor Jean Bacquet 1744 schränken in ihren Schriften jedoch ein, dass nach dem Tod Franz’ II. längst nicht mehr alle Schotten in den Genuss der allgemeinen lettres de naturalisation gekommen seien, denn der Einbürgerungsbrief galt nur unter bestimmten Konditionen und solange Schottland Verbündeter, Freund und mit Frankreich vereint war. Diese Bedingung war spätestens mit der Vereinigung der Parlamente Schottlands und Englands 1707 nicht mehr gegeben.[71] Zudem sei auch bemerkt, dass der Vertrag und seine Umsetzung, Rechtsnorm und Rechtspraxis nicht immer konform waren, wovon die zahlreichen Rechts- und Erbstreitigkeiten Zeugnis geben.[72]
Die bisher besprochenen Aufhebungen des Droit d’Aubaine waren zugleich Ausdruck eines freundschaftlichen Verhältnisses der Vertragspartner sowie ein Instrument langfristiger Friedenssicherung. Sowohl im Falle Schottlands als auch der Eidgenossen waren die guten Beziehungen zu Frankreich ausgesprochen dauerhaft. Von großem Interesse ist daher der Blick auf Regelungen des Jus albinagii zwischen Frankreich und denjenigen Ländern, deren Beziehungen weniger Kontinuität besaßen oder sogar regelrechte Brüche aufwiesen. Hier lässt sich erkennen, dass sie, analog zu Heiratsverträgen,[73] gleichfalls ein Signal eines politischen Paradigmenwechsels darstellen konnten, wie die folgenden beiden Beispiele zeigen.
88
Seit Ende des spanischen Erbfolgekriegs näherten sich Frankreich und Preußen diplomatisch an, was unter anderem Ausdruck in den Allianzverträgen von 1716, 1725 und 1741 fand. Ihnen folgten am 14. Februar 1753 die Handelspräliminarien von Paris mit einer 10-jährigen Gültigkeit. Verabschiedet wurde der Vertrag, weil die »union et l’amitié«, die zwischen den Majestäten herrsche, den Wunsch aufkommen lasse, alles zu tun, »qui peut augmenter & faciliter le commerce entre Leurs Sujets«. In Artikel 5 wurden reziprok für die Untertanen besagter Majestäten alle Rechte aufgehoben, die hinderlich sein könnten, um sich niederzulassen oder wegzuziehen, namentlich der Abzug und das Fremdlingsrecht.[74]
1756 erfolgte die politische Kehrtwende. Während ein französischer Unterhändler auf dem Weg nach Berlin war, um die alte Allianz zu erneuern, schloss Preußen am 16. Januar mit Frankreichs Gegner England die Westminsterkonvention ab. Frankreich war von diesem Verhalten brüskiert und wandte sich nun Österreich zu, das bereits zuvor erfolglos seine Fühler in Richtung Westen ausgestreckt hatte.[75] Mit dem Bruch zwischen Frankreich und Preußen waren nicht nur die Handelspräliminarien und somit auch die Exemtion vom Fremdlingsrecht hinfällig geworden, sondern auch ihr Verhältnis langfristig gestört. Das findet seinen Ausdruck unter anderem darin, dass Frankreich unter dem Einfluss liberaler und physiokratischer Wirtschaftslehren zwar mit nahezu jeder größeren oder wirtschaftlich relevanten souveränen und teilsouveränen Herrschaft in Europa Abmachungen über den Abbau des Droit d’Aubaine schloss; mit Preußen kam hingegen bis zum Ende des Ancien Régime kein Vertrag zustande.[76] Das fiel bereits Zeitgenossen auf: In der auflagenstarken, von August Ludwig Schlözer herausgegebenen politischen Zeitschrift »StatsAnzeigen« ist in der Ausgabe von 1785 ohne weitere Erklärungen ein Verzeichnis der vom Droit d’Aubaine befreiten »Staaten« abgedruckt. Es gibt neben einer ergänzenden Fußnote nur diesen einzigen Kommentar:
»Vielleicht findet der Leser etwas besonders darin, dass die Preußischen und KurHanoverischen Lande, die einzigen in das StatsInteresse von Deutschland mächtig wirkenden Staten sind, die noch keine Verträge über jenes verhaßte Recht geschlossen haben.«[77]
Im Gegensatz zu dem geschilderten Fall konnte im Zuge der »Umkehrung der Allianzen« der alte französisch-habsburgische Antagonismus überwunden werden. Bereits am 1. Mai 1756 wurde in Versailles sowohl ein Neutralitätsabkommen als auch ein Allianzvertrag zwischen den einstigen Gegnern geschlossen. Die französisch-österreichische Heiratspolitik wurde entsprechend der veränderten Lage neu ausgerichtet, weitere Bündnisverträge und Konventionen folgten.[78] Zu letzteren gehörte auch die eingangs zitierte Konvention über die Aufhebung des Droit d’Aubaine vom 24. Juni 1766. Die Majestäten begründen den Vertragsschluss mit dem Wunsch, die Bande ihrer Freundschaft enger zu ziehen und darüber hinaus »faire ressentir les effets heureux à leurs sujets, en facilitant le commerce respectif & la correspondance mutuelle entr’eux«.[79] Mit Freundschaft, Handel und gegenseitigem Austausch treten einem hier altbekannte Motive entgegen, von denen die beiden letztgenannten in den Verträgen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer häufiger explizit erwähnt wurden. Ökonomische Beweggründe spielten zwar für die Aufhebungen des Fremdlingsrechts bereits von Anbeginn unseres Betrachtungszeitraums eine Rolle, aber eher in dem Sinne, Personen und Personengruppen mit bestimmten Fähigkeiten anzuwerben. Nun galt es aber im Sinne einer liberaleren Wirtschaftspolitik insgesamt, den gegenseitigen Handel und Austausch zu fördern.[80] Dies sollte nicht nur dem Wohlstand, sondern nach Einschätzung von Zeitgenossen auch dem Frieden zugute kommen. So erklärte Charles de Secondat Montesquieu 1748:
»L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes: si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre; et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels.«[81]
89
Neben solchen Übereinkünften zur Aufhebung des Droit d’Aubaine, die Frankreich aus Gründen der Freundschaft, Bündniskonsolidierung oder Handelsförderung schloss, und die direkt oder indirekt den Friedensinstrumenten zuzurechnen sind, gibt es auch Beispiele, in denen die Aufrechterhaltung oder Durchsetzung von Herrschaftsansprüchen sowie die territoriale Integration als Motive im Vordergrund standen. Kennzeichnend für diese Abkommen ist, dass nicht gesamtheitlich alle Untertanen der Vertragspartner privilegiert wurden, wie beispielsweise im Falle von Freundschaftsverträgen, sondern nur diejenigen, die im umstrittenen, in der Regel geteilten Territorium ansässig waren. Es mag paradox erscheinen, dass dieser Typ vornehmlich in Friedensverträgen zu finden ist, da der Entstehungshintergrund ein gewisses Konfliktpotential barg. Der französische König bekundete nämlich durch solche territorial begrenzten Aufhebungen des Droit d’Aubaine mittelbar seinen Machtanspruch auf verlorene oder unvollständig eroberte Territorien, indem er die neuen beziehungsweise einstigen Untertanen durch die Privilegierung an sich band. Auf der anderen Seite belebten entsprechende Abmachungen zum Nutzen aller Vertragsparteien den wirtschaftlichen Austausch und förderten persönliche Bindungen in den privilegierten Gebieten. Darüber hinaus reduzierten sie Spannungen, zu denen es im Rahmen von Erbschaftsangelegenheiten kommen konnte, weil angesichts neuer Machtverhältnisse einstige Untertanen zu Fremden geworden waren und Erbschaften naher Angehöriger im anderen Gebietsteil unter Umständen entfernten Verwandten oder dem Souverän überlassen werden mussten.
Ein Beispiel für eine solche begrenzte Aufhebung, die einen territorialen Anspruch manifestiert und zugleich auch einen Blick auf weitere Motive zulässt, bietet der 1529 geschlossene Frieden von Cambrai.[82] Er gehört zu einer ganzen Reihe von Friedensverträgen, mit denen versucht wurde, die habsburgisch-französischen Konflikte um die Vorherrschaft in Europa beizulegen. Einen immer wiederkehrenden Zankapfel bildete hierbei das an die Habsburger gefallene burgundische Erbe mit seinen niederländischen Besitzungen, die zum Teil einst unter französischer Lehnshoheit gestanden hatten. Artikel 2 des Vertrages von Cambrai bestätigte zunächst den dreieinhalb Jahre zuvor geschlossenen Frieden von Madrid in vollem Umfang, jedoch mit einigen Änderungen und Neuerungen im Detail. Zu diesen Änderungen gehörte auch die in Artikel 20 festgeschriebene Aufhebung des Droit d’Aubaine für alle Franzosen in den unter habsburgischer Herrschaft stehenden Niederlanden und umgekehrt für die habsburgischen Untertanen dieser Gebiete in Frankreich. Konkret handelte es sich bei den besagten habsburgischen Gebieten um die Herzogtümer Brabant, Limburg, Luxemburg sowie um die Graf- und Herrschaften Flandern, Artois, Burgund, Hennegau, Ostervant, Namur, Holland, Seeland, Tournai, das Tournesis, Salins und Mecheln. Anders als sonst üblich und auch in der Präambel des Friedens von Cambrai formuliert, wird die Übereinkunft zum Droit d’Aubaine nicht mit der Freundschaft zwischen den Ländern und ihren Souveränen motiviert, sondern ausdrücklich
»pour nourrir & entretenir vraye & bonne Amitié, communication & intelligence entre les S u b j e t s,[83] manans & habitans de Duchez, Comtés Terres & Seigneuries dudit Seigneur Empereur & Pais de pardeça, & les Subjets, manans & habitants dudit Royaume de France«.
Diese Formulierung deutet auf Auseinandersetzungen zwischen den französischen und habsburgischen Untertanen hin, die mit dem Verzicht des französischen Königs auf die Souveränitätsrechte über die umstrittenen niederländischen Gebiete zu erklären sind. Durch diesen Verzicht waren die Untertanen der ursprünglich unter französischer Lehnshoheit stehenden Gebiete nunmehr zu Fremden in Frankreich geworden und somit dort nicht mehr erbberechtigt. Umgekehrt galt dasselbe. Dieses Problem, das sich bereits durch den Vertrag von Madrid ergeben hatte, ohne dort aber behandelt worden zu sein, wurde jetzt einer Lösung zugeführt.[84]
90
Offenbar gab es jedoch noch andere Gründe für die vertragliche Regelung des Droit d’Aubaine im Vertrag von Cambrai: John Glissen vermutet, dass diese vertragliche und reziproke Aufhebung des Droit d’Aubaine dem französischen König durch Kaiser Karl V. aufgezwungen worden sei, nachdem ersterer auf seine Oberherrschaft über Flandern, Artois und Tournai verzichtet hatte, denn: »le droit d’Aubaine, de minime importance dans les principautés belges, pesait par contre lourdement sur les étrangers en France.«[85] Allerdings lag diese Reglung durchaus auch im Interesse Franz’ I. Wenn er die Gebiete nicht endgültig verloren geben und das Band zu seinen ehemaligen Untertanen nicht gänzlich zerschneiden wollte, musste er bestrebt sein, durch eine entsprechende Privilegierung alte Loyalitäten zu erhalten und neue zu schaffen, so dass die kulturellen, wirtschaftlichen und familiären Bindungen zwischen Frankreich und den Niederlanden auch in Zukunft wirksam bleiben konnten.
Zwar wurden solche reziproken Exemtionen während der heißen Phasen der habsburgisch-französischen Auseinandersetzung immer wieder kassiert; sie wurden jedoch ebenso regelmäßig wieder in die darauf folgenden Friedensschlüsse aufgenommen.[86] So findet sich die besagte Übereinkunft 1544 im Friedensvertrag von Crépy im weitgehend gleichen Wortlaut wieder.[87] Und auch die reduzierte, allgemein gehaltene Formulierung in den Verträgen von Câteau-Cambrésis 1559[88] und Vervins 1598 ist als Bestätigung der Aufhebung des Droit d’Aubaine zu verstehen. In letzterem heißt es:
»Les Villes, Sujets, Manans, & Habitants des Comtez de Flandre & Artois, des autres Provinces des Pais-Bas, ensemble du Roiaume d’Espagne, jouiront des Privileges, Franchises, & Libertez, qui leur ont esté accordées par les Rois de France, Predecesseurs dudit Sieur Roi Tres-Chretien.«[89]
Ausdrücklich hervorgehoben sei die Tatsache, dass die erwähnten Verträge keineswegs für alle Untertanen Frankreichs und des Hauses Habsburg galten. In ihren Genuss kamen nur die Untertanen jener niederländischen Gebiete, die Frankreich an seinen Konkurrenten verloren hatte, aber weiterhin beanspruchte. Von daher können sie, entgegen anderen Forschungsmeinungen, keinesfalls mit jenen Aufhebungen in eine Reihe gestellt werden, welche Frankreich mit den inzwischen eigenständig geworden Generalstaaten seit den 1630er Jahren im Zuge von Bündnis- und Handelsverträgen vereinbarte.[90]
Zu vergleichbaren Regelungen kam es auch bei französischen Gebietsgewinnen wie den katalonischen Grafschaften Rosselò und Cerdanya. Nachdem erstere mit dem Pyrenäenfrieden von 1659 vollständig, letztere teilweise an Frankreich gefallen war, bildeten sie fortan die französische Grafschaft Roussillon. Katalanen aus Spanien waren dort vom Droit d’Aubaine ebenso befreit wie die neuen französischen Untertanen in Katalonien.[91] Neben dem Ziel, dass die neuen Untertanen keine Nachteile in Kauf zu nehmen hatten, was ihrer Integration diente, dürfte auch hier die Hoffung auf weitere katalonische Gebietsgewinne sowie die Grenzsicherung eine Rolle gespielt haben. Letztes entspräche ganz der französischen Politik in wichtigen Grenz- und Hafenstädten des Königreichs, in denen nicht selten Fremde gleich welcher Herkunft privilegiert wurden, um den Zuzug zu fördern und Loyalität zu schaffen.[92]
Dass Frankreich das Droit d’Aubaine bzw. dessen Aufhebung als politisches Mittel zur Durchsetzung von Territorialansprüchen nutzte, lässt sich mit Einschränkungen auch im Falle des Herzogtums Lothringen beobachten. Das weitgehend lehnsunabhängige Herzogtum wurde infolge von Thronstreitigkeiten 1633 durch Frankreich besetzt. Mit dem Vertrag von Paris 1661[93] erhielt Herzog Karl IV. von Lothringen sein Herzogtum zurück, setzte jedoch bereits ein Jahr später im Vertrag von Montmartre König Ludwig XIV. zum Erben Lothringens ein, gegen eine Zahlung von einer Million Talern und die Aufnahme der lothringischen Prinzen in den französischen Geblütsadel. Wenngleich der Herzog den Vertrag 1669 widerrief, waren Frankreichs Ansprüche nun vertraglich untermauert, so dass König Ludwig XIV. Lothringen im Jahre 1670 erneut besetzen ließ. Erst mit dem Vertrag von Rijswijk 1697[94] konnte das Herzogtum wieder hergestellt werden.[95] Während die lothringischen Untertanen im 16. Jahrhundert dem Droit d’Aubaine unterworfen waren, änderte sich mit der Besetzung ihr Status, der sich jedoch zunächst nicht eindeutig darstellt.[96] Für die Zeiten der französischen Besetzung dürfte jedoch der Grundsatz gegolten haben, dass jene,
»qui sont nés & qui demeurent dans une Province conquise par la France, sont tenus & et réputés comme originairement natifs du Royaume & affranchis du Droit d’aubaine, si depuis la conquête & avant la restitution à l’ancien Souverain par la paix, ils viennent s’établir en France«.[97]
Mit der Restitution 1697 waren die Untertanen Herzog Leopolds von Lothringen und König Ludwigs XIV. von Frankreich offenbar wieder dem Droit d’Aubaine im jeweils anderen Land unterworfen. Ausgenommen waren allerdings wieder jene einst lothringischen Gebiete, die mit den Verträgen von 1661, 1667 und 1697 an Frankreich gekommen waren. Für sie wurden bereits durch die Deklarationen vom 24. und 28. Mai 1701 reziproke Ausnahmeregelungen vereinbart. Dies geht unter anderen aus dem Aufhebungsvertrag vom 24. Januar 1702 hervor, in dem die Bedingungen für eine allgemeine Abschaffung des Droit d’Aubaine vereinbart wurden.[98] Geschlossen wurde der Aufhebungsvertrag auf Initiative des Lothringer Herzogs, worauf die Präambel ausdrücklich verweist:
»Le Roi estant bien ayse de marquer en toutes occasions l’estime et la consideration particulieres que Sa Majesté á pour Monsieur le Duc de Lorraine, elle a ecouté aggreablement les Instances qui luy ont esté faites de la part de ce Prince.«
Wenngleich der König dem Herzog seine Wertschätzung und besondere Achtung bezeugt, erscheint Ferdinand von Lothringen als Bittsteller. Dies kann – mit aller Vorsicht – als Ausdruck des Verhältnisses zwischen den beiden Souveränen verstanden werden – ein Verhältnis, in dem Frankreich dominierend war und das sich zur Zeit des Vertragsabschlusses alles andere als freundschaftlich darstellte, wie die erneute Besetzung des Herzogtums nur wenige Monate später bestätigen sollte. Dass unter diesen Umständen Frankreich überhaupt ein Interesse an diesem Vertrag hatte, ist nur im Rahmen seiner langfristigen Expansions- und Integrationspolitik zu verstehen. Im Falle Lothringens führte diese 1737[99] beziehungsweise 1766[100] endgültig zum Erfolg, nachdem Frankreich die breite Palette diplomatischer Instrumente eingesetzt hatte, die neben militärischen Aktionen, Geldzahlungen, Heiratsverträgen auch die Aufhebung des Droit d’Aubaine einschloss.[101]
91
Der vorliegende Beitrag hat erstmalig das Droit d’Aubaine und dessen Aufhebungsabkommen im Rahmen historischer Friedensverträge untersucht. Die Untersuchung bildet jedoch nur einen kleinen Aspekt eines Themas, das in der deutschen Geschichtswissenschaft in Vergessenheit geraten ist, obwohl es das frühneuzeitliche Leben in vielfacher Hinsicht beeinflusste. Wie sehr es die Zeitgenossen beschäftigte, belegen deren zahlreiche wissenschaftliche Abhandlungen, die nicht oder kaum beachtet der Auswertung harren.[102] Es wäre erfreulich, wenn ein Impuls hierfür von diesem Beitrag ausgehen würde, als dessen Ergebnis sich Folgendes festhalten lässt:
- Eine Aussage über die Beziehungen der Vertragspartner nur anhand von Freundschaftsbezeugungen und ähnlichen Formulierungen in den Präambeln oder in den Einleitungssätzen einzelner Artikel lässt sich nicht treffen, da in den ausgewählten Beispielen keine Systematik zu erkennen ist. Überschwängliche ebenso wie schlichtere Formulierungen finden sich sowohl in solchen Fällen, bei denen aus dem Kontext heraus ein gespanntes Verhältnis zu vermuten ist, als auch in solchen, bei denen eine gute Beziehung angenommen werden darf. Die Gründe hierfür dürften vielfältig gewesen sein. Es mögen dabei allgemeine stilistische Wandlungen im Laufe der Zeit ebenso eine Rolle gespielt haben wie diplomatische Sensibilitäten und Rücksichtsnahmen. Es wird allerdings nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass anhand dieser Freundschafts- und Respektbezeugungen Rückschlüsse in diese Richtung gemacht werden können. Hierfür wäre aber eine weitergehende Analyse einer Serie von Urkunden eines begrenzten Zeitraums notwendig.
- Die intersouveränen Abkommen über das Droit d’Aubaine variierten in ihrer Form und unterlagen einer Fortentwicklung. Ihre Ursprünge liegen in personell erteilten Einzel- oder Gruppenprivilegien in Form von Patenten oder Erlässen, die nicht als Verträge im eigentlichen Sinn bezeichnet werden können. Sie wurden den Begünstigen aufgrund besonderer Fähigkeiten gewährt, die für das Gastland von Interesse waren. Nach und nach wich dieses Personalitätsprinzip einem Territorialitätsprinzip: Indem mit der Beschreibung intersouveräner Beziehungen zunehmend politische Aspekte in die betreffenden Erlasse und Patentbriefe einflossen und die Reziprozität als Voraussetzung für eine allgemeingültige Exemtion festgeschrieben wurde, erhielten diese Privilegien immer stärker den Charakter von zwischenstaatlichen Verträgen. Seit dem 16. Jahrhundert sind dann im Rahmen von größeren Vertragswerken, wie von Friedens-, Bündnis-, oder Handelsverträgen erste vertragliche Vereinbarungen über das Droit d’Aubaine nachweisbar. Regelrechte Aufhebungsverträge, die ausschließliche das Droit d’Aubaine thematisieren, wurden mit der Etablierung aufgeklärter und liberaler Wirtschaftsideen im 18. Jahrhundert, insbesondere während der 2. Jahrhunderthälfte, abgeschlossen. Die neuen Vertragsformen verdrängten die älteren nur langsam und keineswegs vollständig.
- Drei Motive allgemeingültiger Aufhebungen des Droit d’Aubaine können unterschieden werden:
– die Konsolidierung von intersouveränen Beziehungen und Bündnissen;
– die Förderung von Wirtschaft und Handel;
– die Festschreibung von Machtansprüchen beziehungsweise Integration umstrittener, in der Regel geteilter Territorien.
Zudem kann die Aufhebung bzw. die Wiedereinführung des Droit d’Aubaine ein Indikator eines politischen Paradigmenwechsels sein. Verträge zur Aufhebung des Droit d’Aubaine aus den beiden erstgenannten Motiven sind aufgrund ihres Zustandekommens wie auch aufgrund ihrer Wirkung entsprechend des in der Einleitung beschriebenen, erweiterten Friedensvertragsbegriffs als Instrumente des Friedens zu bezeichnen. Weniger eindeutig gilt dies für Aufhebungen aus dem dritten Motiv, auch wenn solche Aufhebungen meistens Teil eines Friedensvertrags im engeren Wortsinn waren. Auch sie hatten zwar in ihrer Wirkung ein befriedendes Element, da sie den Handel und gegenseitigen Austausch mit sowie Niederlassungen in dem jeweils fremden Gebietsteil förderten und vereinfachten. Allerdings barg der Hintergrund solcher Vertragsartikel Konfliktpotential, weil der territoriale Status quo indirekt in Frage gestellt wurde. Dies zeigt, dass die Wirkung der Aufhebung des Droit d’Aubaine auf die Untertanen von der auf die Souveräne unterschieden werden muss. Dennoch ist kein Fall bekannt, in dem das Droit d’Aubaine oder seine Aufhebung unmittelbarer Anlass eines Krieges gewesen wäre. Zudem machten solche Aufhebungen des Droit d’Aubaine aufgrund von Machtansprüchen, wenn überhaupt, nur einen kleinen Teil der Übereinkünfte in Friedensverträgen aus. Es stellt sich deshalb die generelle Frage, inwieweit Friedensverträgen allgemein Konfliktpotential innewohnte und sie der Friedenssicherung dienten, zumal zahlreiche Beispiele bezeugen, dass gerade sie Ausgangspunkt neuer Kriege waren. Trotz der ambivalenten Stellung der übrigens vergleichsweise seltenen dritten Kategorie, dienten die Aufhebungsakkorde in ihrer Gesamtheit und der Erhaltung des Friedens, insbesondere dann, wenn sie langfristig ihre Wirkung entfalten konnten. Somit ist die im Titel gestellte Frage positiv zu beantworten.
92
Alteroche, Bernard d’: De l’étranger a la seigneurie a l’étranger au royaume XIe–XVe siècle, Paris 2002.Anex-Cabanis, Danielle: Art. »Aubaine / Aubaine, droit d’«, in: Lexikon des Mittelalters 1 (1980), Sp. 1182–1183.
[Anonym], Verzeichniß der Staten, die in Frankreich vom Droit d’Aubaine befreit sind. Mit Anzeige der Jare, in welchen sie diese Befreiung erlangt haben, in: Stats-Anzeigen 8 (1785), S. 293–296. URL: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/statsanzeigen/statsanzeigen.htm (eingesehen am 3. März 2008).
Berner, Albert Friedrich: Art. »Heimfallsrecht«, in: Deutsches Staats-Wörterbuch 5 (1860), S. 86–91. URL: http://books.google.de (eingesehen am 3. März 2008).
Blanchard, Guillaume: Table chronologique contenant un recueil en abrégé des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes des rois de France, qui concernent la justice, la police et les finances […] depuis l’année 1115 jusqu’à présent, Paris 1687. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k92272q.table (eingesehen am 3. März 2008).
Blickle, Peter: Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten. Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland, München 2003.
Boulet-Sautel, Marguerite: L’aubain dans la France coutumière du moyen âge, in: L’étranger, Brüssel 1958 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions 10), Teil 2, S .65–100.
Bonner, Elizabeth: French Naturalization of the Scots in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, in: The Historical Journal 40.4 (1997), S. 1085–1107.
Dies.: Scotland’s »Auld Alliance« with France, 1295–1560, in: History 84, Nr. 273 (1999), S. 5–30.
Brunner, Karl: Der pfälzische Wildfangstreit unter Kurfürst Karl Ludwig (1664–1667), Innsbruck 1896.
Contamine, Philippe: Art. »Frankreich«, in: Lexikon des Mittelalters 4 (1989), Sp. 747–798.
CTS siehe Parry, Clive
Danz, Wilhelm August Friedrich: Handbuch des heutigen deutschen Privatrechts. Nach dem Systeme des Herrn Hoftrath Runde, Stuttgart 1796–1823, Bd. 1–10.
Denisart, Jean Baptiste: Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 5. Aufl. Paris 1766, Bd. 1–3. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206722n.pagination (eingesehen am 3. März 2008).
Diderot, Denis/ Alambert, Jean-Baptiste le Ronde d’: Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Paris 1751–1765, Bd. 1–17. URL: http://portail.atilf.fr (eingesehen am 3. März 2008).
Dithmar, Justus Christian: De Jure Albinagii, praecipue in Germania. Dissertatio historica et jurispublici, Frankfurt/Oder 1721.
Dotzauer, Winfried: Der Kurpfälzische Wildfangstreit und seine Auswirkungen im rhein-pfälzischen Raum, in: Regionale Amts- und Verwaltungsstrukturen im rheinhessisch-pfälzischen Raum (14. bis 18. Jahrhundert), Wiesbaden 1984 (Geschichtliche Landeskunde 25), S. 81–105.
Dubois, Alain: Art. »Frankreich«, Kap. 1.5. Auf dem Weg zu einem jahrhundertelangen Bündnis, in: Historisches Lexikon der Schweiz 4 (2005), S. 652–654. Online in: e-HLS. URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D3354-1-5.php (eingesehen am 29. Februar 2008).
Duchhardt, Heinz: Die dynastische Heirat als politisches Signal, in: Miroslawa Czarnecka u.a. (Hg.), Hochzeit als ritus und casus. Zu interkulturellen und multimedialen Präsentationsformen im Barock, Warschau 2001 (Orbis linguarum, Beihefte), S. 67–70.
Ders. u.a. (Hg.): Der Friede von Rijswijk 1697, Mainz 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte 47).
Dumont, Jean (Hg.), Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un Recueil des Traitez d’Alliance, de Paix, de trève, de neutralité, de commerce, etc., qui ont été faits en Europe, depuis le règne de l’empereur Charlemagne jusques à présent, Amsterdam 1726–1731, Bd. 1–8.
Erler, Adalbert: Gabella Emigrationis, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1 (1971), Sp. 1367–1368.
Franckenstein, Jacob August: De Usu Albinagii in Germania, Disseratio iuridica, Erfurt 1719, ND Leipzig 1731, ND [mit deutschem Zusatztitel: Von denen Rechten und Freyheiten der Teutschen, von welchen die auswärtig-gebohrnen ausgeschlossen sind] Jena 1748.
Gama, Emmanuel de: Dissertation sur le droit »d’aubeine«, Paris 1706.
Gern, Philippe: »Frankreich«, Kap. 2.1.3. Frankreich als vermittelnde Macht, in: Historisches Lexikon der Schweiz 4 (2005), S. 656. Online in: e-HLS. URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D3354-3-3.php (eingesehen am 29. Februar 2008).
Glissen, John: Les étrangers en Belgique du XIIIe au XXe siècle, in: L’étranger, Brüssel 1958 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions 10), Teil 2, S. 231–331.
H.: Art. »Patent«, in: Allgemeine Encyclopädie, Sect. 3, Theil 13 (1840), S. 227. URL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN364422122 (eingesehen am 3. März 2008).
Henry, Philippe: Art. »Fremde Dienste«, Kap. 2.2. Die Hauptetappen der Entwicklung, in: Historisches Lexikon der Schweiz 4 (2005), S. 791–794. Online in e-HLS. URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9802-1-2.php (eingesehen am 29. Februar 2008).
Hofer, Sibylle: Art. »Fremdenrecht«, in: Enzyklopädie der Neuzeit 3 (2006), Sp. 1223–1225.
Isambert, François-André u.a. (Hg.): Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris 1821–1833, Bd. 1–29. URL: http://gallica.bnf.fr (eingesehen am 29. März 2008).
Jordan, William Chester: Home Again. The Jews in the Kingdom of France, 1315–1322, in: Frank R.P. Akehurst u.a. (Hg.), The Stranger in Medieval Society, Minneapolis 1998 (Medieval Cultures 12), S. 27–45.
Kaiser, Jakob u.a. (Hg.): Die eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1245 bis 1798. Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede, Luzern 1856–1886, Bd. 1–8.
Keith, Robert: The History of the Affairs of Church and State in Scotland, from the Beginning of the Reformation in the Reign of King James V. to the Retreat of Queen Mary into England, anno 1568, 2. Aufl. Edinburgh 1748. URL: http://find.galegroup.com/menu (eingesehen am 29. Februar 2008).
Köbler, Gerhard: Historisches Lexikon der deutschen Länder, 6. überarbeitete Aufl. München 1999.
Ders.: Lexikon der Europäischen Rechtsgeschichte, München 1997.
Koehler, B.: Art. »Fremde«, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1 (1971), Sp. 1266–1270.
Kugeler, Heidrun u.a. (Hg.): Internationale Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Ansätze und Perspektiven, Münster u.a. 2006 (Wirklichkeit und Wahrnehmung in der Frühen Neuzeit 3).
L’Étranger, Brüssel 1958 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions 10), Teil 1–2 (Neudruck Paris 1984).
Ludewig, Johann Peter von: De Differentia Juris Romani, Gallici et Germanici in Peregrinitate, Albinagio atque Wildfangiatu, Disseratio iuridica, Halle 1735.
Malettke, Klaus: Der Friede von Rijswijk im Kontext der Mächtepolitik, in: Heinz Duchhardt u.a. (Hg.): Der Friede von Rijswijk 1697, Mainz 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte 47), S. 1–45.
Mansord, Charles Antoine: Du droit d’aubaine et des étrangers en Savoie, Chambery 1824.
Madival, Jérôme u.a. (Hg.): Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. 1. Serie (1787 à 1799), Paris 1867–1913, Bd. 1–82. URL: http://gallica.bnf.fr (eingesehen am 3. März 2008).
Mondot, Jean u.a. (Hg.): Deutsche in Frankreich, Franzosen in Deutschland: 1715 – 1789. Institutionelle Verbindungen, soziale Gruppen, Stätten des Austausches, Sigmaringen 1992 (Beihefte der Francia 25).
Monglas, Marie Charles de: De Origine et Natura Iuris Albinagii in Gallia, Dissertatio iuridica, Straßburg 1785.
Montesquieu, Charles Louis de Secondat de: De l’esprit des lois, Nouvelle édition, revue, corrigée, & considérablement augmentée par l’auteur, Bd. 2, London 1757.
Necker, Jacques: De l’administration de Finances de la France, Paris 1784, Bd. 1–3. URL: http://books.google.com (eingesehen am 29. Februar 2008).
Okey, Charles Henri: Droit d’Aubaine de la Grande Bretagne, Paris 1830.
Ders.: Droits, privilèges et obligations des étrangers dans la Grande-Bretagne, Paris 1831.
Paravicini, Werner: La cour, une patrie? L’exemption du droit d’aubaine accordée par les ducs de Bourgogne aux officiers de leur hôtel (1444–1505), in: Les étrangers à la cour des ducs de Bourgogne. Statut, identité, fonctions, Villeneuve-d’Ascq 2002 (Revue du Nord 84), Nr. 345–346, S. 247–204.
Parry, Clive (Hg.): The Consolidated Treaty Series, New York 1969–1981, Bd. 1–231.
Peters, Martin: Heiraten für den Frieden. Europäische Heiratsverträge als dynastische Friedensinstrumente der Vormoderne, in: Heinz Duchhardt u.a. (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 12–20. URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html (eingesehen am 29. Februar 2008).
Ders.: Friedensverträge der Vormoderne. Definition, in: historicum.net. Geschichtswissenschaften im Internet. URL: http://www.historicum.net/themen/friedensvertraege-der-vormoderne/definition (eingesehen am 1. April 2004).
Ragueau, Glossaire du droit françois, nouvelle édition Niort 1882 (ND 1995). URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k508455 (eingesehen am 29. Februar 2008).
Rapport, Michael: Nationality and Citizenship in Revolutionary France. The Treatment of Foreigners 1789–1799, Oxford 2000.
Ders.: A Languishing Branch of the Old Tree of Feudalism.The Death, Resurrection and Final Burial of the Droit d’Aubaine in France, in: French History 14/1 (2000), S. 13–40.
Roll, Christine: Im Schatten der spanischen Erbfolge? Zur kaiserlichen Politik auf dem Kongreß von Rijswijk, in: Heinz Duchhardt u.a. (Hg.): Der Friede von Rijswijk 1697, Mainz 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte 47), S. 47–91.
Rouville, Abraham Mathieu de: De jure albinatus, tum secundum iuris antiquioris fransisi principia, tum in codice nostro servato, Dissertatio historio-iuridica, Lugduni Batavorum 1835.
Ryrie, Alec: The Origins of the Scottish Reformation, Manchester u.a. 2006.
Szajkowski, Zosa: The Jewish status in Eighteenth-Century France and the »Droit d’Aubaine«, in: Historia Judaica 19.2 (1957), S.147–161.
Sahlins, Peter: Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and After, Ithaca 2004.
Ders.: Fictions of a Catholic France: The Naturalization of Foreigners, 1685–1787, in: Representations 47 (1994), S. 85–110.
Schneider, Lars: Kurzbiogramm Necker, in: historicum.net. Geschichtswissenschaften im Internet. URL: http://www.historicum.net/no_cache/persistent/artikel/608 (eingesehen am 29. Februar 2008).
Schnitzler, Adolf: Art. »Fremdenrecht«, in: Wörterbuch des Völkerrechts 1 (1960), S. 566.
Schröder, Rainer: Die Rechtsstellung der Franzosen in Deutschland, in: Jean Mondot u.a. (Hg.) Deutsche in Frankreich, Franzosen in Deutschland: 1715 – 1789. Institutionelle Verbindungen, soziale Gruppen, Stätten des Austausches, Sigmaringen 1992 (Beihefte der Francia 25), S. 247–266.
Semonin de St. Gerans, Mathurin Alexius: De Usu hodierno Juris Albinagii in Gallia, Dissertatio iuridica, Straßburg 1785.
Stammler, Rudolf: Deutsches Rechtsleben in alter und neuer Zeit, München 1928–1932, Bd. 1–2.
Stolz, Otto: Über das Jus albinagii und das Jus detractus in Tirol und Vorderösterreich, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (VSWG) 11 (1913), S. 219–235. URL: http://www.digizeitschriften.de (eingesehen am 3. März 2008).
Teulet, Alexandre (Hg.): Relations politiques de la France et de l’Espagne avec l’Écosse au XVI. siècle, Bd. 1: Correspondances françaises 1515–1560 (François I., Henri II. – Jacques V., Marie Stuart), Paris 1862. URL: http://books.google.de (eingesehen am 29. Februar 2008).
Thieme, Hans: Art. »Fremdenrecht«, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1 (1971), Sp. 1270–1272.
Ders.: Die Rechtsstellung der Fremden in Deutschland vom 11. bis zum 18. Jahrhundert, in: L’étranger, Brüssel 1958 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions 10), Teil 2, S. 201–216.
Tomaschek, Johann Adolf: Das Heimfallsrecht, Wien 1882.
Vanel, Marguerite: Histoire de la nationalité Française d’origine. Évolution historique de la notion de Français d’origine du XVIe siècle au Code Civil, Paris 1945.
Verzijl, Jan Hendrik Willem: Nationality and other matters relating to individuals, Leyden 1972 (International law in historical perspective 5).
Villers, Robert: La condition des étrangers en France dans les trois derniers siècles de la monarchie, in: L’étranger, Brüssel 1958 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’Histoire Comparative des Institutions 10), Teil 2, S. 138–150.
Weindl, Andrea: Europäische Handelsverträge – Friedensinstrumente zwischen Kommerz und Politik, in: Heinz Duchhardt u.a. (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 36–55. URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html (eingesehen am 29. Februar 2008).
Wells, Charlotte C.: Law and Citizenship in early modern France, Baltimore u.a. 1995.
93
[*] Peter Seelmann, M.A., Institut für Europäische Geschichte Mainz, Wiss. Mitarbeiter im DFG-Projekt »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
[1] La Constitution du 3 Septembre 1791, Chapitre IV, Titre VI. Conseil constitutionnel der Republik Frankreich, http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1791.htm. Bereits bevor das Droit d’Aubaine per Verfassung abgeschafft wurde, verabschiedete die Nationalversammlung am 6. August 1790 ein entsprechendes Gesetz. Weitere Gesetze folgten: Am 22. Februar 1791 wurde das Droit d’Aubaine als Feudalrecht abgeschafft, am 1. April 1791 wurden allen Fremden uneingeschränktes Erbrecht zugestanden und am 13. April 1791 wurde per Dekret die Aufhebung des Droit d’Aubaine auf die Kolonien ausgeweitet, vgl. Mavidal, Archives parlementaires 1867–1913, Bd. 17, S. 628–630, Bd. 23, S. 399, Bd. 24, 1886, S. 495 f. und Bd. 25, 1886, S. 10. Sahlins, Unnaturally French 2004, S. 278–282, spricht angesichts dieser nacheinander erlassenen Gesetze von einer »Quadruple Abolition« des Droit d’Aubaine.
[2] Der Begriff Droit d’Aubaine wird meist in der jüngeren Historiographie und auch hier in dieser engen Bedeutung verwendet. Vgl. hierzu Wells, Law 1995, S. 15., die explizit zwischen droit d’aubaine und aubain laws unterscheidet. Seltener wird der Begriff in einem erweiterten, nicht immer eindeutigen Sinn gebraucht. Thieme, Rechtsstellung 1958, S. 206 u. 212, verwendet ihn sowohl in der besagten engeren Bedeutung wie auch als Synonym für Erbbesteuerung von Fremden allgemein und dementsprechend für das jus detractus (Abschoss, Abzug). Ähnlich Erler, Gabella Emigrationis 1971, Sp. 1367, der unter Droit d’Aubaine alle jene Reche versteht, »die dem König in bezug auf Fremde zustehen.« Zur Terminologie sowie zu den verschiedenen Formen der Erbbesteuerung siehe Abschnitt 83.
[3] Zu dieser Definition siehe auch Peters, Friedensverträge 2006.
[4] Befreiung der katholischen Eidgenossen vom Jus Albinagii 1622 IV 8, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 15. März 2008).
[5] Aufhebungsvertrag von Wien über das Droit d’Aubaine 1766 VI 24, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. März 2008).
[6] Konvention von Schwetzingen 1766 VI 16, gedruckt in CTS, 43, S. 347 ff.
[7] Ausdruck dieses Interesses sind beispielsweise der in Trier angesiedelte Sonderforschungsbereich 600 »Fremdheit und Armut«, das DFG-Projekt »Minderheiten in der Frühen Neuzeit«, die von Heinz Duchhardt und Franz Knipping herausgegebene Reihe »Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen«, oder der Sammelband Kugeler, Internationale Beziehungen 2006.
[8] Anex-Cabanis, Aubaine 1980, Sp. 1182 f.; Hofer, Fremdenrecht 2006, Sp. 1224; Schnitzler, Fremdenrecht 1960, S. 566 ff. Nicht immer wird man unter den Lemmata »Aubaine« oder »Droit d’Aubaine« sowie ihren Übersetzungen (lat. jus albinagii, albinagium, dt. »Fremdlingsrecht«; ital. »Albinaggio«) fündig. Kontrolliert wurden deshalb ggf. auch Begriffe wie »Abzug«, »Fremdenrecht«, »Fremder«, »Heimfall(srecht)«, »Jus gentium«, »Rückfallsrecht« und »Wildfangrecht«.
[9] Köbler, Lexikon 1997. Gesucht wurde nach den in Anmerkung 8 angegebenen Begriffen.
[10] Koehler, Fremde 1971, Sp. 1266–1270 und Thieme, Fremdenrecht 1971, Sp. 1270–1272.
[11] Mondot, Deutsche in Frankreich, Franzosen in Deutschland 1992. Lediglich im Beitrag Schröder, Rechtsstellung 1992, S. 253 f., wird das Droit d’Aubaine kurz erklärt.
[12] Die Zahl setzt sich aus jenen Verträgen zusammen, die bei Sahlins, Unnaturally French, S. 335–340 für den Zeitraum von 1753–1791 aufgeführt sind, sowie – für die Zeit davor – aus jenen, die in den CTS-Bänden 23–40 verzeichnet sind.
[13] L’Étranger, Brüssel 1958.
[14] Wells, Law; Sahlins, Unnaturally French.
[15] Alteroche, Étranger 2002; Paravicini, La cour 2002.
[16] Jordan, Home Again 1998; Szajkowski, The Jewish status 1957.
[17] Sahlins, Fictions 1994, sowie ders., Unnaturally French, S. 51 f. u. 162–164. Zitat ebd., S. 52.
[18] Bonner, French Naturalization 1997; Rapport, Languishing Branch 2000.
[19] Dumont, Recueil des Traitez 1726–1731; CTS; Kaiser, Eidgenössische Abschiede 1856–1886.
[20] Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 4. März 2008).
[21] Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 4. März 2008).
[22] Eugène Lefèvre de la Planche war von 1692 bis 1731 Advokat der Domänenkammer des französischen Königs. Zitiert nach Sahlins, Fictions, S. 104, Anm. 10.
[23] Zitiert nach Ragueau, Glossaire 1882, S. 45 f.
[24] Ebd., ebenso Wells, Law, S. 16; Anex-Cabanis, Aubaine, Sp. 1182. Alle drei Autoren weisen noch auf die These hin, dass sich der Begriff albanus auch von Albion herleiten könne, einer alten, wahrscheinlich keltischen Bezeichnung für die Britischen Inseln: Ende des 8. Jahrhunderts, d.h. zeitlich nur wenige Jahre vor Ausstellung der zitierten Urkunde, lösten Normannenangriffe im Norden der Britischen Inseln eine Flüchtlingsbewegung aus. Die Bedrängten suchten im Frankenreich Zuflucht. Wegen ihrer Herkunft, so die Überlegung, seien diese Emigranten von den Franken Albani genannt worden, ein Ausdruck, der später synonym für die Fremden im Allgemeinen geworden sei. Bei Berner, Heimfallsrecht 1860, S. 87 finden sich noch weitere, jedoch weniger überzeugende Erklärungen.
[25] Vgl. Sahlins, Unnaturally French, S. 6 u. 46; Wells, Law, S. 16; Glissen, Étrangers en Belgique 1958, S. 234 f.; Berner, Heimfallsrecht, S. 90.
[26] Vgl. Wells, Law, S. 16; Berner, Heimfallsrecht, S. 86 f.
[27] Koehler, Fremde, Sp. 1266 f.; Schnitzler, Fremdenrecht, S. 566. Ausführlich hierzu auch Wells, Law, S. 16.
[28] Tomaschek, Heimfallsrecht 1882, S. 1.
[29] Beispielsweise bei Danz, Handbuch 1796–1823, Bd. 3, S. 130, § 320. Zudem verweist Tomaschek, Heimfallsrecht, S. 2, im gleichen Zusammenhang auf das Hofdecret vom 24. März 1825 (Justiz-Gesetz-Sammlung Nr. 2080), in dem der Begriff des Heimfallsrechtes im Sinne von Abschossgeld (siehe Abschnitt 83) gebraucht wird. Berner, Heimfallsrecht, S. 86 benutzt den Begriff Heimfall zwar auch synonym zu Droit d’Aubaine, differenziert aber zwischen Privat- und Völkerrecht und ordnet letzteres dem völkerrechtlichen Heimfall zu.
[30] Sahlins, Fictions, S. 87; Boulet-Sautel, L’aubain 1958, S. 89 f.; vgl. auch Contamine, Frankreich 1989, Sp. 747–761.
[31] Feudalherren, die zuvor das Droit d’aubaine ausgeübt hatten, sahen sich ihrer Einnahmequelle beraubt. Unter Verweis auf das Gewohnheitsrecht (coutume) konnten sie es jedoch zum Teil weiterhin für sich sichern. Andere Herrschaftsträger, insbesondere Städte, die stark vom Handel abhingen und das Fremdlingsrecht nicht ausgeübt hatten, fürchteten durch die Einführung ökonomischen Nachteile und erreichten – gleichfalls mit dem Hinweis auf ihre coutume – Exemtionen. Auch Gebiete wie die Provence oder das Languedoc, die erst verhältnismäßig spät unter französische Herrschaft kamen und in römischer Rechtstradition standen, wehrten sich bis Ende des 17. Jahrhunderts erfolgreich gegen die Einführung des Droit d’aubaine. Vgl. Boulet-Sautel, L’aubain, S. 91; Villers, La condition 1958, S. 146; Wells, Law, S. 16; Sahlins, Unnaturally French, S. 46.
[32] Zum Wildfangstreit Blickle, Freiheit 2003, S. 106–118; Dotzauer, Wildfangstreit 1984, S. 81–105; Stammler, Rechtsleben 1928–1932, Bd. 1, S. 237–248; Brunner, Wildfangstreit 1896.
[33] Thieme, Rechtsstellung, S. 212. Ob das Droit d’Aubaine ursprünglich im gesamten Gebiet des karolingischen Reiches verbreitet war und später aufgrund der Authentika omnes peregrini Friedrichs II. aus dem Jahre 1220 auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches zur Gabella hereditaria abgemildert wurde, wie bei Sahlins, Unnaturally French, S. 33 und Berner, Heimfallsrecht, S. 88 f., zu lesen ist, bleibt fraglich, da der Stauferkönig Fremde bzw. Gäste generell die freie testamentarische Verfügung über ihre Güter einräumte und keine Erbschaftssteuer für Fremde vorsah. Die Authentika Friedrichs II. erwähnt auch Koehler, Fremdenrecht, Sp. 1268, allerdings ohne diese Kausalität herzustellen.
[34] Erler, Gabella Emigrationis 1971, Sp. 1367.
[35] Verzijl, Nationality 1972, S. 410. Vgl. Blickle, Freiheit, S. 219; Erler, Gabella Emigrationis; Thieme, Rechtsstellung, S. 212 f.; Stolz, Jus albinagii 1913, besonders S. 222–224 u. 229.
[36] Eine vergleichbare Entwicklung hat auch Weindl, Europäische Handelsverträge 2008, Abschnitt 36–55 für Handelsverträge festgestellt.
[37] Vgl. Sahlins, Unnaturally French, S. 50; Wells, Law, S. 109 f.; Villers, La condition, S. 141 f.
[38] Vgl. den bei Isambert, Recueil général 1821–1833, Bd. 10, S. 711, abgedruckten Brief, in dem der Französische König auf das Droit d’Aubaine verzichtet »pour considération de ce que très-haut et très-puissant prince, nostre très-cher et très-amé frere, cousin et allié le roi des Romains nous a escrit de cette matiere, aussi que lesdits Hanequis et Scheffre sont sujets et des pays de notre très-cher et très-amé cousin l’archevesque de Mayence, qui est nostre parent, amy, confédéré et allié, qui pareillement sur ce nous a escrit et requis, et pour la bone amour et affection que avons à lui, desirant traiter et faire traiter favorablement tous ses sujets, ayant aussi considération de la peine et labeur que lesdits exposants ont prins pour ledit art et industrie de l’impression, et au profit et utilité qui en vient et peut en venir à toute la chose publique, tant pour l’augmentation de la science que autrement.«
[39] Dubois, Frankreich 2005, S. 652–654.
[40] Vgl. Wells, Law, S. 48.
[41] Zur Bedeutung des Begriffs lettres patents siehe den Artikel »Lettres Patents«, in: Diderot / D’Alambert, Encyclopédie 1751–1765, Bd. 9 (1772), S. 426 f., sowie den Artikel H., Patent 1840.
[42] Vgl. Henry, Fremde Dienste 2005.
[43] Isambert, Recueil général, Bd. 11 (1827), S. 310.
[44] Königliche Ausfertigung des Bündnisvertrags zwischen Frankreich und den Eidgenossen 1474 I 2 (i.e. 1475 nach Circumcisionsstil). Zitiert nach Kaiser, Eidgenössische Abschiede, Bd. 2.b, S. 919.
[45] Geheimabkommen von Solothurn 1715 V 9, gedruckt bei Kaiser, Eidgenössische Abschiede, Bd. 7.1, S. 1379.
[46] Bündnis von Solothurn 1715 V 9, in: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 25. Februar 2008).
[47] Vgl. hierzu Sahlins, Unnaturally French, S. 13 u. 49; Rapport, Languishing Branch, S. 19 und Wells, Law, S. XVII u. 129 f.
[48] Vgl. Gern, Frankreich 2005.
[49] Konvention von Solothurn über die gegenseitige Abschaffung des Droit d’aubaine 1771 XII 7, in: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 30. Februar 2008).
[50] Ebd., Artikel 1: »Declarant toutefois n’entendre énoncer que les droits, qui compétent à Sa Majesté et aux[dites] Louables Etats, sans préjudicier en rien aux droit généralement quelconques affectés aux Domaines particuliers des Villes, Terres et Fiefs de leurs dominations, reservant au contraire au Souverains respectives la Faculté d’user du reciproque envers les Sujets des dites Villes, Terres ou Fiefs, qui ne voudrait pas se relâcher desd[ites] droits.« Vgl. auch Artikel 3.
[51] Necker, De l’administration 1784, Bd. 3, S. 309 f.
[52] Vgl. Schneider, Necker 2006.
[53] Allianzvertrag von Solothurn 1777 V 28, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. März 2008).
[54] Ebd. In Artikel 19 ist das Jahr 1772 genannt. Trotzdem kann es sich hierbei nur um den gerade besprochenen Vertrag vom 7. Dezember 1771 handeln, der von Frankreich allerdings erst am 20. Januar 1772 ratifiziert wurde. Vgl. ebd. die französische Ratifikation auf Seite 12 der pdf-Datei.
[55] Lediglich Ludwig XII. von Frankreich und Jakob II. von Schottland erneuerten die Auld Alliance nicht. Zu den Gründen siehe Bonner, Auld Alliance 1999, S. 20 f.
[56] Siehe hierzu ebd., S. 6, 17 f. u. 22, sowie dies., French Naturalization, S. 1102.
[57] Ebd., S. 1085 u. 1087.
[58] So war Jakob V. zunächst mit Madeleine von Frankreich, einer Tochter Franz’ I., verheiratet. Nach deren frühem Tod heiratete er am 18. Mai 1538 Maria von Lothringen, Tochter eines Pairs von Frankreich. Gemeinsame Tochter und – nach dem Tod ihrer Brüder – Thronerbin war Maria Stuart, die dann wiederum die Ehe mit Franz II. einging. Eine Übersicht über die Heiratsverträge zwischen dem französischen und dem schottischen Königshaus für die Zeit von 1295 bis 1661 gibt Bonner, French Naturalization, S. 1102.
[59] Ebd. sind auch Einbürgerungen sowie die Vergabe von Titeln, Land und Lehen aufgeführt.
[60] Leicht könnte das nur mit Monat und Jahr datierte Patent als Kompensation für das Desaster der Schlacht von Flodden Field am 9. September 1513 verstanden werden, bei der Jakob IV. und Tausende seiner Untertanen umkamen. Bonner weist jedoch darauf hin, dass das Schriftstück früher entstanden sein dürfte. Vgl. Bonner, Auld Alliance, S. 22.
[61] Zitiert nach ebd., S. 22.
[62] Zitiert nach ders., French Naturalization, S. 1088.
[63] Gemeint sind der Geheimvertrag von Fontainebleau 1558 IV 4 und der Heiratsvertrag 1558 IV 19. Gemäß ersterem sollte Schottland auch dann an Frankreich fallen, wenn Königin Maria Stuart ohne Nachkommen stürbe. Beide Verträge sind abgedruckt bei Dumont, Recueil des Traitez, Bd. V,1, S. 21–23.
[64] Gedruckt bei Teulet, Relations politiques 1862, S. 312–314, Zitat S. 312.
[65] Ebd.
[66] Vgl. Ryrie, Origins 2006, S. 197 f. und Keith, History 1748, S. 130–153. Letzterer gibt auch den Text des Vertrags von Edinburgh wieder.
[67] Vgl. Bonner, French Naturalization, S. 1086.
[68] Vgl. Wells, Law, S. 109 und Blanchard, Table chronologique 1687, S. 336: »Declaration portant exemption du droit d’aubeine pour les Sujets du Roi de la grande-Bretagne. A Paris en Juin 1615.«
[69] Erinnert sei an die Könige Karl II und Jakob / James II., Jakob / James III. (The Pretender) oder Karl III. (The Young Pretender), die teils in französischem Exil lebten oder mit Hilfe Frankreichs ihre Thronansprüche durchsetzten bzw. durchzusetzen versuchten.
[70] Denisart, Collection 1766, Bd. 1, S. 101.
[71] Ebd. S. 102; Sahlins, Unnaturally French, S. 173. Vgl. Bonner, French Naturalization, S. 1099 f.
[72] Beispiele finden sich bei Wells, Law, insbesondere S. 39–41 oder 105 f.
[73] Vgl. Duchhardt, Dynastische Heirat 2001, S. 67–70 und Peters, Heiraten 2008, Abschnitt 13.
[74] Allianzvertrag von Berlin 1716 IX 14, Freundschafts- und Allianzvertrag, sog. Herrenhäuser Traktat 1725 IX 3, Allianzvertrag von Breslau 1741 VI 5, Handels- und Schiffahrtsvertrag von Paris 1753 II 14. Alle Verträge in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, z.T. mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. April 2008).
[75] Es sei nur der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass die Umkehrung der Allianzen natürlich nicht ausschließlich auf den diplomatischen Fauxpas Preußens zurückgeführt werden kann, sondern letztlich Ausdruck einer veränderten Machtkonstellation in Europa war, die aus dem Aufstieg Preußens zur europäischen Großmacht und aus der Schwächung des Hauses Habsburg resultierte.
[76] Vgl. Sahlins, Unnaturally French, S. 7 u. 13 und Necker, Administration, Bd. 3, S. 315 f., der das Droit d’aubaine als Hindernis für die Wirksamkeit jener Maßnahmen ansah, »qui sont autant d’avantages qui promettent à notre Royaume de nouveaux habitans & de nouvelles richesses«.
[77] [Anonym], Verzeichniß der Staten 1785, S. 296.
[78] Vgl. Rapport, Languishing Branch, S. 22.
[79] Aufhebungsvertrag von Wien über das Droit d‘ Aubaine 1766 VI 24, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. März 2008).
[80] Vgl. Sahlins, Unnaturally French, S. 7.
[81] Montesquieu, Esprit des lois 1757, Bd. 2, S. 239 f. (Liber 20, Kap. 2).
[82] Friede von Cambrai 1529 VIII 5, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters: http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. März 2008).
[83] Sperrung durch den Verfasser.
[84] Bei Denisart, Collection, Bd. 1, S. 101, ist zu lesen, dass es bereits im Madrider Vertrag einen Artikel über die Reglung des Droit d’Aubaine besagter Gebiete gegeben habe, was nicht bestätigt werden kann. Vgl. den Vertrag von Madrid 1526 I 14 bei Dumont, Recueil des Traitez, Bd. IV,1, S. 399–341. Im Gegensatz hierzu Glissen, Étrangers en Belgique, S. 281, Anmerkung 2.
[85] Ebd., S. 281.
[86] Sahlins, Unnaturally French, S. 49.
[87] Friedensvertrag von Crépy-en-Laonnais 1544 IX 18, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters: http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. März 2008). Mit abweichender Absatzzählung gedruckt bei Dumont, Recueil des Traitez, Bd. IV,2, S. 279–287. Vom Droit d’Aubaine handelt Absatz 24 (Dumont, S. 283) bzw. Absatz 22 (in der pdf-Datei der Base Choiseul auf S. 15). Gegenüber dem Friedensvertrag von Cambrai erscheint der Absatz leicht modifiziert: Auf eine Erklärung, welche Probleme das Droit d’Aubaine den Untertanen bereitet, wurde verzichtet und der Schlusssatz verändert; außerdem sind die Herrschaften Geldern, Zuphen, Friesland und Utrecht als exemt hinzugefügt.
[88] Friedensvertrag von Câteau–Cambrésis 1559 IV 3, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters: http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. März 2008).
[89] Friedensvertrag von Vervins 1598 V 2, Artikel 5, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. März 2008).
[90] Im Gegensatz hierzu Sahlins, Unnaturally French, S. 173.
[91] Vertrag von Île de Faisanes, sog. Pyrenäenfrieden 1659 XI 7, Artikel 56, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. März 2008). Siehe auch Sahlins, Unnaturally French, S. 177.
[92] Vgl. Wells, Law, S. 42–51.
[93] Vertrag von Paris zur Wiedereinsetzung Karls IV. (1661 II 28), in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 4. März 2008).
[94] Friedensvertrag von Rijswijk 1697 X 30, Artikel 28, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul, (eingesehen am 4. März 2008). Vgl. den Sammelband DUCHHARDT, Rijswijk 1998 mit den Beiträgen Malettke, Friede von Rijswijk 1998 und Roll, Im Schatten 1998.
[95] Eine Übersicht über die Ereignisse im Herzogtum Lothringen liefert Köbler, Historisches Lexikon 1999, S. 361.
[96] Vgl. Sahlins, Unnaturally French, S. 194 u. 198.
[97] Denisart, Collection, Bd. 1, S. 166 f.
[98] Konvention von Versailles über die Aufhebung des Droit d’aubaine 1702 I 24, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 15. April 2008). Vgl. ebd. S. 1 f.: »Sous lesquelles on pourrait esteindre et supprimer le droit d’aubaine qui jusques à present a eu lieu en France sur les suiets dudit sieur Duc, et dans ses Etatz sur les suiets du Roy a L’exception neanemoins de suiets de Sa Majesté nez dans le trois Eveschez de Metz, Toul et Verdun, Pays de Messin et autres Lieux et Pays qui faisoient cy devant partie du Duché de Luxembourg, du Comté de Chiny, de la Lorraine et du Barrois, qui ont esté cedez sa Majesté par les traitez des années Mil Six Cent Soixante et un, Mil Six Cent Soixante trois et Mil Six Cent Soixante quatre vingt dix Sept, lesquels sont leur residance dans les Estatz dudit Sieur Duc, on qui y possedent des biens, et des Suiets de ce Prince, qui sont aussy leur residence dans ledits Pays on qui y possedent les biens.«
[99] Friedensvertrag von Wien 1737 V 2, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege, mit Link zu: Base Choiseul, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/choiseul (eingesehen am 4. März 2008).
[100] Stanislaus I. Leszczynski, König von Polen und Herzog von Lothringen, stirbt am 23. Februar 1766, so dass Lothringen gemäß dem Friedensvertrag von Wien endgültig an Frankreich fällt.
[101] Vgl. Sahlins, Unnaturally French, S. 226 f.
[102] Gama, Dissertation 1706; Dithmar, De Jure Albinagii 1721; Franckenstein, De Usu Albinagii 1719–1748; Ludewig, De Differentia 1735; Monglas, De Origine 1785; Semonin de St. Gerans, De Usu hodierno 1785; Mansord, Droit d’aubaine 1824; Okey, Droit d’Aubaine 1830; Okey, Droits, privilèges et obligations 1831; Rouville, De jure albinatus 1835.
Peter Seelmann, Aufhebungen und Einschränkungen des Jus albinagii – ein Instrument des Friedens?, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 78–93.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008062408>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 79 oder 78–81.
Kirstin Schäfer *
Kriegsgefangenschaft in Friedensvertragsrecht und Literatur
Gliederung:
Text:
Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei
Wenn hinten weit, in der Türkei
Die Völker aufeinander schlagen
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus
Und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten;
Dann kehrt man abends froh nach Haus
Und segnet Fried und Friedenszeiten« [Goethes Faust][1]
Der britische Jurist Sir Henry Maine schrieb in der Mitte des 19. Jahrhunderts: »Der Krieg scheint so alt wie die Menschheit, aber der Frieden ist eine moderne Erfindung«;[2] und auch wenn J. W. von Goethe im Faust bereits den Frieden – nicht den Krieg – segnet, so ist in der Tat zu konstatieren, dass der Krieg, nicht aber der Frieden lange Zeit den bisherigen Normalzustand unserer Geschichte darstellte. Statistiken besagen, dass im Verlauf von 3400 Jahren Menschheitsgeschichte lediglich 243 Jahre ohne Krieg verlaufen sind.[3] Über Jahrhunderte hinweg wurde Krieg von den meisten Menschen als eine unabänderliche Katastrophe begriffen, er galt, neben Hunger und Pest, als dritter apokalyptischer Reiter. Während Krieg also passierte, war Frieden eine abstrakte Idee, eine Utopie, von ›Friedensrufern‹ erfunden; das aber verleiht dem Zustand des Friedens eine besondere historische Bedeutung und wirft zahlreiche Fragen auf, die sowohl in vielen Jahrhunderten von Völkerrechtlern und Philosophen, Staatsmännern, Militärs und Historikern sowie – freilich unter anderen Vorzeichen – in der historischen Forschung seit den letzten Jahrzehnten intensiv diskutiert wurden.[4]
Ist der Krieg, um das oft zitierte Diktum des Heraklit aufzugreifen, tatsächlich der »Vater aller Dinge«; ist somit der menschliche Aggressionstrieb dem Wunsch nach Frieden und Ruhe übergeordnet? Ist Friede tatsächlich lediglich ein Zustand der Abwesenheit von Krieg? Wie wird Krieg erfahren; wie Frieden erlebt?[5] Wie veränderten sich Vorstellungen von Krieg und Frieden im Zeitverlauf und wie wurden sie medial transformiert? Wie funktionierte Frieden als Resultat einer internationalen Ordnung; wie wurde Frieden in Interdependenz zu zeitlich vorausgegangenen Kriegen geregelt und verhandelt?[6]
94
»Sie bilden erstens einen dramatischen Kontinuitätsbruch. Als tiefer Eingriff in das Leben müssen sie nicht nur verarbeitet, sondern auch in die Erinnerung integriert, sie müssen tradiert werden, um Sinn in der Deutung des eigenen Schicksals zu erhalten, um Opfer und Leid zu ›bewältigen‹. Zweitens stellen Kriege häufig eine Wende im gesellschaftlichen, wie im individuellen Leben dar, und die dem Krieg folgende Zeit wird als Nachkriegszeit erinnert. Kriege führen schließlich drittens auch zu einer neuen Sicht der Zeit, die dem Krieg vorausging, denn diese wird nun auf den Krieg hin erinnert und erscheint als Vorkriegszeit. Insofern sind Kriege Schleusen der Erinnerung: Sie verengen und kanalisieren auch häufig den Zugang zur Vorkriegszeit«.[7]
Friedensverträge sollen in diesem Sinne aus einer kulturhistorischen Perspektive untersucht werden; gefragt wird, ob wir aus den Verträgen subjektive und kollektive Kriegs- und Friedenserfahrungen herauslesen können.[8] Denn stets woben sich in die Paragraphen der Verträge, in die Beschlüsse der Diplomaten und Potentaten die Schicksalsfäden von Zivilisten und Soldaten – Männern und Frauen. Friedensverträge sind unter diesen Vorzeichen Seismographen kollektiver Kriegserfahrung und -erinnerung.[9]
Dass die Frage nach Friedensverträgen als Spiegel von Kriegserfahrungen und -erinnerungen Gegenstand einer umfassenden Untersuchung sein kann, steht außer Frage. Im Folgenden soll nur ein Ausschnitt der Gesamtfragestellung exemplarisch beleuchtet werden: nämlich der Stellenwert der Erfahrung der Kriegsgefangenschaft im Zusammenhang mit Friedensverträgen. Zu fragen ist, welche Erfahrung und Erinnerungen Gefangene machten und, wie sich diese in den Paragraphen frühneuzeitlicher Friedensverträge spiegelten.
95
Zunächst gilt es festzustellen, dass das Motiv der Kriegsgefangenschaft in historischen Quellen – Bildern, Romanen, Gedichten, Autobiographien und Memoiren – stets eine große Rolle gespielt hat. So sind zahlreiche persönliche Berichte überliefert, die Einblick geben in die Erfahrungswelten Gefangener: In diesen Quellen geht es ebenso um die traumatischen schmerzhaften und entbehrungsreichen Aspekte der Gefangenschaft wie auch um die Gebärde des Triumphs, die mit der Gefangennahme von Soldaten feindlicher Armeen sowie mit Beutezügen verbunden war.
Wenngleich autobiographische und fiktive Quellen vom 17. bis ins 19. Jahrhundert in großer Anzahl vorliegen,[10] hat sich das Interesse der Historiker bisher nur mit wenigen Ausnahmen[11] mit ihnen beschäftigt. Die meisten Arbeiten zum Thema fokussieren die Kriege des 20. Jahrhunderts mit ihren überwältigenden Erfahrungsumbrüchen, grausamen Kriegsverbrechen und großen Zahlen Kriegsgefangener. Gerade unter dem Gesichtspunkt neuester Forschungsansätze (histoiré croisée,[12] Erinnerungs- und Erfahrungsgeschichte) sind die Ergebnisse zum Thema Kriegsgefangene methodisch jedoch unzureichend und zu sehr dem deskriptiven verhaftet geblieben. Was aber ist ein Kriegsgefangener?
Das von Johann Heinrich Zedler verlegte Universal-Lexicon (1731–1754), mit Abstand das umfangreichste enzyklopädische Werk, das im Europa des 18. Jahrhunderts hervorgebracht wurde, beschreibt die Möglichkeiten und Grenzen der Soldaten-Gefangennehmung bereits ausführlich.[13] Gefangene hatten demnach besondere Rechte, die von Land zu Land variierten. Verschont werden sollten z.B. Kinder, Schwache, mitunter auch Frauen sowie Priester und Prediger, Kaufleute, Künstler, Handwerker und Trompeter. Besondere Bestimmungen und Richtlinien finden sich in den betreffenden Kriegsrechtsartikeln auch für Offiziere. Das Recht, Gefangene zu töten, wird im Zedler für einen Fall gebilligt, nämlich, wenn die Gefangenen gegenüber der feindlichen Armee in der Überzahl sind.
Gerhard Köbler definiert im Lexikon der europäischen Rechtsgeschichte: »ein Kriegsgefangener ist der in einem Krieg in die Gefangenschaft des Gegners geratene Mensch. Ursprünglich ist er Feind bzw. Beute und damit weitgehend rechtlos«.[14] Tatsächlich wurde bis in den Dreißigjährigen Krieg jeder Soldat wie auch der Einwohner einer durch Sturm genommenen Festung gewissermaßen als Eigentum des Feindes betrachtet, dem er in die Hände fiel, und er musste ihm seine Freiheit mit einer Geldsumme (Lösegeld, Ranzion) abkaufen.
In der Öconomischen Encyclopädie (1773–1858) heißt es zur Behandlung Kriegsgefangener im 16. und 17. Jahrhundert:
»die art und weise, wie kriegs-gefangene aus ihrer gefangenschaft wieder frey werden, ist: 1. die ranzionierung, welches ein vertrag unter den kriegenden theilen ist, vermöge dessen beyderseits gefangene für eine summe geldes, welches die ranzion heißt, ihre freyheit bekommen […] 2. die auswechselung, welche geschieht, wenn beyde kriegende theile vermöge eines vertrages ihre beyderseits gefangene einander zurück geben […] 3. die loslassung, wenn der feind die gefangenen a) entweder freywillig loslässet […] b) oder durch einen vertrag dazu verbunden ist […] 4. die dienst-annahme bey dem feinde«.[15]
Mit dem Wandel des Status und Rechtstandes des Individuums an sich änderte sich auch der Status von Kriegsgefangenen im 18. Jahrhunderts entscheidend, wobei, wie zu zeigen sein wird, jene bellizistische Sattelzeit zwischen 1750 und 1815 dabei den entscheidenden Wandel einleitete. Erst die Haager Landkriegsordnung von 1899 sicherte dem Kriegsgefangenen dann rechtmäßiges Verhalten zu, was durch das Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenschaft vom 26. Juli 1929 noch entschiedener gesichert wurde (abgeändert durch das Genfer Abkommen vom 12. August 1949).[16]
96
Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit waren es vorwiegend »berühmte Gefangene«, Geiseln, an die man sich erinnerte und/oder die in der Lage waren, ihre Gefangenschaftserfahrungen überhaupt schriftlich oder bildlich zu artikulieren beziehungsweise artikulieren zu lassen.[17]
Der 70 Meter lange Teppich von Bayeux (Abb.1), bedeutendstes Zeugnis romanischer Textilkunst, stellt die Eroberung Englands durch die Normannen (1066) in faszinierenden Details dar. Die kunstvolle Visualisierung der Gefangennahme Harold Godwinsons durch den Grafen von Ponthieu und seine Ritter beweist, dass die Gefangenschaft bereits ein Motiv kollektiver Kriegserinnerung war.[18]
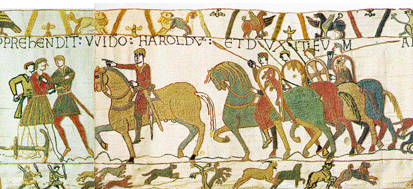
Während der Schlacht von Agincourt (25. Oktober 1415) – als einer der größten militärischen Siege der Engländer über die Franzosen während des Hundertjährigen Krieges tief im britischen Bewusstsein verankert – hatten die Truppen König Heinrichs V. von England zahlreiche (adelige) Gefangene aus dem Heer König Karls VI. gemacht. Unter ihnen befand sich Charles, Herzog von Orléans. Erst der Vertrag von Arras (1435), der die Endphase des Hundertjährigen Krieges einleitete, brachte die Freiheit für die französischen Gefangenen. Eine farbenprächtige britische Miniatur aus dem 15. Jahrhundert zeigt den Herzog von Orléans als Gefangener im Londoner Tower, einem von Mythen umwobenen Ort der Gefangenschaft (Abb. 2).[19]
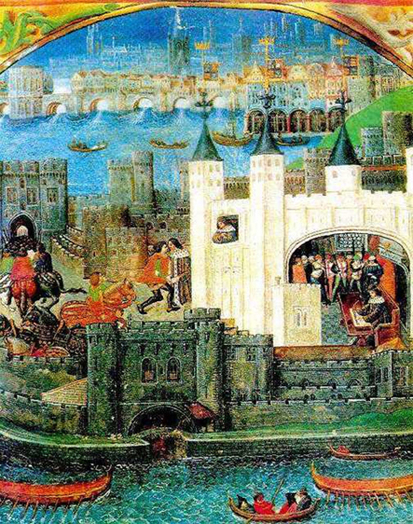
97
Einer der berühmtesten Gefangenen des 16. Jahrhunderts war der französische König Franz I., der während der Schlacht bei Pavia 1525 gefangen genommen wurde. Seine Freilassung war ein Bestandteil des Friedensvertrags von Madrid.[20] Berühmt ist auch die Legende von der versuchten Gefangennahme Friedrichs II. durch russische Husaren bei Kunersdorf während des Siebenjährigen Krieges, wie sie Theodor Fontane in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg (1862–1882) beschreibt.[21] Angeblich wurde Friedrich II. durch den Rittmeister Benedikt von Prittwitz mit 40 Husaren vor der Gefangennahme durch die Kosaken gerettet. Als Dank für seine Rettung schenkte der König dem Rittmeister 1763 das Gut Quilitz (später Neuhardenberg).[22]
Im Zusammenhang mit den Kriegen in den britischen Kolonien wurde Kriegsgefangenschaft zum Medienereignis: Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren die diplomatischen und militärischen Unternehmungen der Briten in Indien ein beliebtes Thema in England. Von zentraler Bedeutung waren die Mysore-Kriege, die im Süden Indiens zwischen 1767 und 1799 ausgetragen wurden. Auf indischer Seite wurden sie von Sultan Tipu, dem so genannten »Tiger von Mysore« geführt. Im Dritten Mysore-Krieg nahmen die Briten unter Führung von Lord Charles Cornwallis 1791 Bangalore und im folgenden Jahr die Stadt Seringapatam ein. Tipu kapitulierte und musste bei den Friedensverhandlungen zwei Söhne als Geiseln stellen, die Hälfte seines Landes abgeben sowie eine Entschädigungssumme zahlen. Als 1794 die Vertragsbedingungen erfüllt waren, kehrten die Söhne zurück. In Großbritannien hatte man die indischen Geschehnisse mit großem Interesse verfolgt und nahm vielfach Anteil am Schicksal der Kinder als Geiseln; Künstler und Verleger widmeten sich dem Thema und fertigten Drucke, durch die sich die Ereignisse aus der exotischen Gegenwelt Südindiens in dramatischen Darstellungen innerhalb der britischen Öffentlichkeit verbreiteten.[23]
98
Neben solchen Geschichten prominenter Kriegsgefangener finden sich mit zunehmender Alphabetisierung und Verbreitung schriftlicher Medien immer mehr Erfahrungs- und Erinnerungsberichte einfacher Gefangener, von denen zwei hier kurz vorgestellt werden sollen, um dann mit den Friedensverträgen kontrastiert zu werden:
In Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens »Odyssee« des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648), dem Simplicissimus Teutsch, gerät der Protagonist Melchior Sternfels von Fuchshaim, ein Anagramm des Namens des Autors, gleichsam von einer Gefangenschaft in die nächste, und wenn auch die Bedingungen dieser Internierungen nicht immer angenehm sind, so führt jede kurze Gefangenschaft zu einer neuen abenteuerlichen Erfahrung und einer Erweiterung von Melchior Sternfels’ zu Kriegsbeginn so einfach strukturierten ›simplen‹ Verstandes. Einmal wird er von einquartierten Truppen gefangen genommen und nach Moskau verschleppt, wo er als Forscher am Hofe des Zaren Karriere macht, da er die Pulverherstellung zu demonstrieren vermag. Das verschafft ihm schließlich die Freiheit, die ihn allerdings wiederum in die Gefangenschaft durch Piraten führt, die ihn als Galeerensklaven verkaufen.
Wenngleich Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch als Abenteuerroman gelesen werden muss, so enthält er doch zahlreiche Erfahrungen und Beobachtungen, die Grimmelshausen selbst im Krieg gemacht hatte und die auch in anderen Quellen überliefert sind; sie geben bemerkenswerte Einblicke in die Sozial- und Kulturgeschichte des Dreißigjährigen Krieges.[24]
99
Die Erinnerungen des Börries von Münchhausen thematisieren die Kriegsgefangenschaft zur Zeit des Siebenjährigen Krieges (1756–1763).[25] In dem 1829 entstandenen Werk blickt der zu diesem Zeitpunkt 84jährige darauf zurück, wie er 1759 als 14jähriger Göttinger Student, zusammen mit seinem älteren Bruder Adolph, von den sich nach der Schlacht bei Minden zurückziehenden Franzosen nach Straßburg verschleppt wird.[26] Der Bericht gibt in seinen Details einen faszinierenden Einblick in den Alltag einer adeligen Geisel im Siebenjährigen Krieg. Börries von Münchhausen beschreibt den Akt der Gefangennahme wie folgt:
»Wir sahen mit Vergnügen bis zum 7ten August abends 11 Uhr, dem Flüchten der, in größter Unordnung durch Göttingen sich drängenden französischen Regimenter zu; und legten uns zu Bette. Bald nach Mitternacht öffnete sich unser Wohnzimmer. Unser Bedienter trat mit dem Lichte herein; ihm folgte ein Husaren Rittmeister vom Corps des Generals Fischer, ein ansehnlicher Mann, der mit einem außerordentlich starken Bauche und mit einem fürchterlichen Schnurr – auch Backenbarte versehen war. Zwey gemeine Husaren, die er bey sich hatte, wurden mit entblößtem Säbel, zur Wache vor die Stubenthür gestellt. Er kam vor unser Bette und verlangte, daß wir sogleich aufstehen und mit ihm gehen sollten, weil wir als Geisseln weggeführt werden würden. Wir befolgten den Befehl des Husaren Rittmeisters von Orb – dies war sein Name. Wir zogen uns eilig an, und wurden von ihm, unter Begleitung jener beiden Husarenwachen, in das dabey gelegene Wirthshaus, die Krone, geführt. Hier fanden wir 40 bis 50 französische Officiere, die auf ihrer eiligen Flucht sehr ausgehungert waren, an langen Tischen saßen und speiseten. Sie sprachen uns mit der gewohnten französischen Höflichkeit, Muth ein; versicherten uns, daß uns kein Leid widerfahren solle, und nöthigten uns zum Mitessen; welches ich aber verbat, und mich in der Kammer auf ein Bette legte«.
Das Zitat, wie auch der Rest des Berichtes zeigt, mit welchem Respekt und welcher Höflichkeit die Gefangenen behandelt wurden. Dass Münchhausen nicht mit den Franzosen speisen wollte, ist fraglos als Zeichen seiner Verachtung für die französischen Feinde zu werten. Wenngleich diese Distanzierung gegenüber den Offizieren der feindlichen Armee plausibel erscheint, so ist sie doch in der von der Verfasserin ausgewerteten Quelle keineswegs dominant: Vielmehr scheint es sehr oft zu einer Annäherung zwischen Opfer und Täter gekommen zu sein, die durch die Nähe hervorgerufen wurde (wie auch im Simplicissimus deutlich wird).
Börries beschreibt die Reise nach Straßburg Station für Station:
»Den 15ten August ging unser Weg über Harle, Homburg (Homberg), nach Wernswik (Wernswig). Den 16ten wurden wir über Frillendorf (Frielendorf), Ziegenheim (Ziegenhain) nach Treisa (Treysa) gebracht; wo man uns aufs Rathaus einquartirte; welches kurz zuvor zum französischen Lazareth gedient hatte. […] In Frankfurt traffen wir […] banquier Bernhard, [er] hatte die Gewohnheit, obgleich er Frau und Kinder und ein großes Haus besaß, manchmal in Wirthshäusern, am öffentlichen Tische zu speisen, um Reisende und Freunde zu sehen. Da er dies auch in dem Gasthofe, worin ich und mein Bruder assen, that, so kam der rechtschaffene Mann, nach Tisch zu uns, und sagte: ›er vernehme daß wir Verwandte des Ministers von Münchhausen zu Hannover wären. […] Er werde sich freuen wenn wir ihm Gelegenheit gäben, seine Dankbarkeit zu bezeigen und uns auf irgend eine Art, mit Gelde oder auf andere Weise nützlich zu seyn‹. […] Weil wir nun ganz unerwartet und so schleunig von Göttingen abgeführt wurden, so war natürlich unsere kleine Kasse, durch die lange Reise, und wegen der den escortierenden Officieren zu machenden Geschenke, ganz erschöpft. Wir dankten also der Vorsehung, die uns den Herrn Bernhard zuwies; der uns nicht nur eine bedeutende Summe Geldes vorstreckte, und uns eine Anweisung an seinen Bruder, den Banquier Bernhard in Straßburg, zum ferneren Empfang der benöthigten Gelder mitgab, sondern auch ein paar Gastmahle, uns zu ehren, in seinem Hause gab; wobey er sich jedoch gefallen lassen mußte, daß unsere französische Wache vor der Thür seines Speisesaals stand«.[27]
Jene ›ritterliche Behandlung‹ und jene Freiräume von Kriegsgefangenen, wie sie Börries beschreibt, haben wenig mit den traumatischen Gefangenschaftserfahrungen vieler einfacher Soldaten – vor allem seit den ›totalen‹ Kriegserlebnissen der Neuzeit zu tun.
100
Und doch: wie die Quellen belegen, waren nicht nur Versehrung, Grausamkeit und Tod, Heimweh und Hunger, sondern auch kulturelle Aneignung und Transfer Bestandteil der Kriegserfahrung; und mit ihr verbanden sich immer auch positive Deutungsmuster.[28] Die Kriege stifteten Emotionen der Überlegenheit, des Sieges, des Rausches, kollektive und individuelle Identitäten; sie ermöglichten das Erlebnis von Abenteuer, »boarder crossing« und damit den Einblick in exotische Gegenwelten und andere Kulturen. Sie offerierten, gerade sozialen Außenseitern, den Ausbruch in das Unbekannte, Andere, wie im Simplicissimus deutlich wird.
Sowohl in Münchhausens Bericht wie auch im Simplicissimus fällt auf, dass die Erfahrung der Gefangenschaft eng mit jenem Faszinosum verbunden war, das hier als ›Kriegstourismus‹ bezeichnet werden soll: Ausgelöst durch bellizistische Auseinandersetzungen verließen zunehmend größere Kollektive ihre Regionen und Länder, um sich quer über Europa durch einen Raum zu bewegen, von dem die meisten von ihnen vorher keine konkrete Vorstellung besessen hatten. Diese Transferbewegungen erstreckten sich in alle Himmelsrichtungen. Zweifelsohne haben diese zweckorientierten und meist erzwungenen ›Reisen‹, die durch Gefangennahmen besonders lang waren, zu der Herausbildung neuer mental maps des europäischen Raumes geführt; sie haben dazu beigetragen, dass sich ein vielschichtiges Verständnis über den Raum Europa entwickelt hat.[29] Gleichzeitig hatten diese Austauschprozesse neben der politisch-militärischen auch eine kulturelle Dimension, sie bezeugen Momente von Alterität in der Kultur. Texte und Praktiken wurden durch Kriege in andere Sprach- und Kulturräume transportiert, wobei ›Kriegstouristen‹ – Exilanten und Gefangene – als Vermittler und Rezipienten wesentliche Schlüsselpositionen einnahmen.[30] Unfreiwillige kriegsbedingte Mobilität endete in vielen Fällen in Sesshaftigkeit in der Fremde. Dominique de La Flize, Chirurg der napoleonischen Armee, geriet auf dem Rückzug nach dem Gefecht von Krasnyj in russische Gefangenschaft; es gefiel ihm im Kiewer Gouvernement so gut, dass er sich dort niederließ und Arzt der Domäne wurde.[31] Etwa 60.000 spanische Kriegsgefangene wurden während der Napoleonischen Kriege von der iberischen Halbinsel nach Frankreich deportiert. Viele dieser Gefangenen ließen sich dort nach dem Krieg nieder. Auch Ehen zwischen Gefangenen und Einheimischen waren, wie die Quellen zeigen, keine Seltenheit.[32]
Viele weitere Beispiele ließen sich anführen, und so wurde die kriegsbedingte kulturelle Assimilation auch im Roman und Drama des 19. Jahrhunderts thematisiert: In Honoré de Balzacs Geschichte La femme de trente ans verliebt sich Julie, die Frau eines napoleonischen Generals, in einen britischen Kriegsgefangenen, der nach dem Ende der Kriege in Frankreich bleibt, weil er nicht nur Julie, sondern auch das Land über alles lieben gelernt hat,[33] und in Hauffs Märchen wird der ägyptische Junge Almansor, der von Soldaten der Grande Armée nach dem Ägyptenfeldzug nach Paris verschleppt wird, zum Lehrer eines Orientalistikprofessors.[34]
101
Es ist bereits deutlich geworden, dass die Erfahrung der Kriegsgefangenschaft Auswirkungen auf die Art und Weise hatte, Krieg und Frieden wahrzunehmen, zu beenden und Frieden und Nachkriegszeiten zu regeln.
Liest man vor diesem Hintergrund die Friedensverträge des krisenhaften 17. Jahrhunderts im Blick darauf, wie jene ›Loslassung des Gefangenen‹, des captivus, prisoners, prisioneros de guerra oder prisoniers de guere geregelt wurde, so spiegeln sie gerade dadurch, dass sie die Gefangenschaft nur in wenigen Sätzen thematisieren, die zeittypische Praxis der Behandlung Gefangener im Krieg und das System des Gefangenentransfers.
Im 1538 zwischen Österreich und Siebenbürgen geschlossenen Friedensvertrag von Großwardein heißt es über die Freilassung der Gefangenen: »Item Quod omnes captivi propter hostilitatem ultro citroque capti ex nunc libere dimittantur«.[35] Fast 100 Jahre später, im während des großen »Religionskrieges« 1626 geschlossenen Friedensvertrag von Pressburg zwischen Österreich und Siebenbürgen, äußern sich die Vertragspartner zum Austausch der Gefangenen in Artikel 7 bereits ausführlicher:
»Insuper iuxta priorum quoque Tractatuum normam, Captivi utrimque gratis dimittantur. Eorum porrò qui in Turcicam Captivitatem inciderunt, liberationem d[omi]nus Princeps omni studio procuret«.[36]
Neun Jahre später, im 1635 geschlossenen Friedensvertrag von Prag zwischen Kaiser und dem Kurfürstentum Sachsen wird die Frage der Freilassung Kriegsgefangener, von denen es in dieser Zeit sehr viele gab, relativ ausführlich verhandelt:
»Alle und Jede Kriegs gefangene deren Principalen Sich dieser friedens handlung aller<dings> würckhlich bequemben, sollen zu allen <und> ieden theilen, ohne einig Lößegelt von <pub>- licirung dieses friedens binnen Monats<frist> erlediget, Und auf freÿen fu<.>ß gest<ellet> werden, doch daß die Jenige welche Sich alb<ereit> geschetzt, oder Eine Ranzion versprochen, dieselbe Erlegen und durch gehendts alle gefangene <es> seÿ gleich eine Ranzion von ihnen Versprochen oder nicht, die Uncosten welche auf Sie in wehrender Custodia ergangen, erstatten sollen«.[37]
102
Im Friedensvertrag von Münster, Symbol des Endes der Gräuel des Dreißigjährigen Krieges und Auftakt einer Phase des aufgeklärten Kriegsdiskurses, heißt es im Oktober 1648:
»Deinde omnes et singuli utriusque partis captivi sine discrimine sagi vel togae eo modo, quo inter exercituum duces cum Caesareae maiestatis approbatione conventum est vel adhuc convenietur, liberi dimittantur«.[38]
Und weiter:
»Restitutione ex capite amnestiae et gravaminum facta, liberatis captivis ratihabitionibus commutatis et praestitis iis, quae de primo solutionis termino supra conventa sunt, omnia utriusque partis militaria praesidia, sive Imperatoris eiusque sociorum et foederatorum sive reginae regnique Sueciae et landgraviae Hassiae eorumque foederatorum et adhaerentium aliove quocunque nomine imposita fuerint, ex civitatibus Imperii ac omnibus aliis locis restituendis sine exceptionibus, mora, damno et noxa pari passu educantur«.[39]
103
Im Europa des 18. Jahrhunderts, während einer Periode, in der Bellizismusdiskurse auf entscheidende Weise vom Geist der Aufklärung geprägt waren, begannen Philosophen und Völkerrechtler wie Emmer(ich) de Vattel und Jean Jacques Rousseau, basierend vor allem auf den Gedanken Immanuel Kants, die Kriegsführung des 17. und 18. Jahrhunderts zu kritisieren. Emmerich de Vattels Werk Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, 1758 als Reflex auf die Kriege seiner Gegenwart publiziert,[40] behandelte viele damit verbundene Fragen, unter anderem die Frage des Umgangs mit Kriegsgefangenen, für die Vattel sich eine humanere Behandlung wünschte.
Blicken wir auf die Verträge des 18. Jahrhunderts, die, um ein geistreiches Diktum Johannes Kunischs aufzugreifen, unter dem Motto »la guerre – c’est moi« von absolutistischen Herrschern geführt wurden, so wird auch hier deutlich, dass Kriege im 18. Jahrhundert von königlichen Privatarmeen ausgefochten wurden, mit einem moderaten Einfluss auf das Leben der Zivilisten – vor allem verglichen mit den Konflikten des 17. Jahrhunderts, insbesondere dem Dreißigjährigen Krieg. Im 1703 zwischen den Generalstaaten und Münster geschlossenen Subsidienvertrag von Den Haag heißt es in Artikel 5, der die Frage der Besoldung sowie der Kriegsgefangenen beinhaltete, lediglich:
»Et en cas, que quelques uns des officiers, ou soldats des troupes de Son altesse fussent faits prisonniers, ils seront reclamés, ranconnés ou eschangés contre ceux de l´ennemy, tous de meme comme les propres troupes de l´Estat«.[41]
Im 1714 geschlossenen Friedens- und Handelsvertrag von Utrecht zwischen den Generalstaaten und Spanien heißt es (Artikel 32):
»Todos los prisioneros de Guerra de una parte y de otra serán sueltos sin pagar rescate alguno, y sin distinzion de lugares, ni de Banderas û Estandartes donde, û debaxo delas quales ayan serbido, por quanto estos Prisioneros están en poder delos dichos Señores Rey, y Estados generales, y las deudas que los dichos Prisioneros de Guerra de una parte y de otra an contraydo«.[42]
Alle Kriegsgefangenen beider Seiten werden ohne irgendein Lösegeld zu zahlen freigelassen.
In Artikel 4 des Hubertusburger Friedens, der auf Schloss Hubertusburg in Wermsdorf geschlossen wurde und den Endpunkt des Siebenjährigen Krieges darstellt, heißt es:
»La Majesté le Roi de Pruse renverra sans rançon et sans delai tous les Pencraux, Officiers et Soldats de la Majesté le Roi de Pologne Electeur de Saxe, qui sont encore prisonniers de guerre«.[43]
104
Der Hubertusburger Frieden stellt im Zusammenhang von Krieg, Frieden und Gefangenschaft eine Zäsur dar: Mit ihm begann der Weg in die Moderne, die mit der Französischen Revolution 1789 vollends entfesselt wurde und erstmals die Erfahrung des totalen Krieges (1793–94) zwischen ganzen Nationen in Waffen schuf.
Dieser Wendepunkt in der Geschichte des Krieges und des Friedens kann nur verstanden werden mit dem Wissen um die zeittypische Dialektik zwischen alter und neuer Welt, alter und neuer Ordnung um das Jahr 1800: Während die Zeit vor der Französischen Revolution also ideologische Überlegungen anstellte, wie man Kriege einhegen könne, kam es mit den Revolutions- und Napoleonischen Kriegen zu einer Einhegung des Krieges. Der Wandel von der gezähmten zur entfesselten Bellona – die Wiedergeburt des Krieges aus dem Geiste der Revolution – hatte sich vollzogen.[44] Es wundert somit nicht, dass viele Zeitgenossen die Kriege ihrer Gegenwart als Wiederholung des Dreißigjährigen Krieges perzipierten.
Neben der Ideologisierung von Krieg und Frieden und dem Wandel der Heeresordnungen kam es zu einer nationalen Bewusstwerdung breiter Kreise.[45] Auch die Zeit- und Raumwahrnehmung veränderte sich, was mit einer zunehmenden Medialisierung zusammenhing.[46] Wie in vielen Bereichen bildeten auch in Bezug auf die Kriegsgefangenschaft die Revolutions- und Napoleonischen Kriege eine historische Wasserscheide. Der Weg vom absolutistischen (Söldner-)Heer zur Nationalarmee war beschritten: Hatten dort noch Söldner gekämpft, so wurden hier emotionalisierte Massen ins Feld geführt – und unter diesen Auspizien bekam die Kriegsgefangenschaft völlig neue Konnotationen. Der Kriegsgefangene des 20. Jahrhunderts, der für die Gesamtdauer des Krieges gefangen blieb, war entstanden. Das Festhalten von Gefangenen, vor allem von zahlreichen Zivilisten, während der Gesamtdauer des bellizistischen Konflikts stellte einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit und der Praxis des Kriegsrechtes des 18. Jahrhunderts dar. Die Friedensverträge dieser Zeit waren ein nüchternes Rechtsgeschäft geworden. In bisher unbekannter Radikalität wurde ein großer Teil der Traditionen, die seit dem Westfälischen Frieden von 1648 gegolten hatten, über Bord geworfen zugunsten knapper, klarer und harter, vor allem ökonomisch harter, Bestimmungen. Die Friedensverträge unter der Ägide Napoleons – Campo Formio (17. Oktober 1797), Amiens (17. Oktober 1797), Lunéville (9. Februar 1801), Pressburg (26. Dezember 1805), Tilsit (7./9. Juli 1807) und Wien (14. Oktober 1809); sie alle waren de facto Waffenstillstände, Diktatfrieden, die zur Auflösung der alten Strukturen Europas führten.[47]
105
Am 23. Mai 1803, nachdem der Friedensschluss von Amiens (27. März 1802) den zweiten Koalitionskrieg zwischen Großbritannien und Frankreich beendet hatte, ordnete Napoleon die Internierung aller männlichen britischen Zivilisten in Frankreich im Alter von 18 bis 60 an. Unter diesem französischen Gesetz wurden zwischen 700 und 800 britische Zivilisten in Frankreich interniert. Unter diesen Kriegs- und Friedensbedingungen erreichte die Anzahl gefangen genommener Europäer eine neuartige Größenordnung. 1795 waren in Großbritannien 13 666 Gefangene unterschiedlicher Nationalitäten interniert,[48] im März 1810 waren es allein 43 683 französische Gefangene. Bis 1814 stieg diese Zahl auf 70 000 an.[49] Insgesamt hielten sich in Großbritannien zwischen 1803 und 1815 rund 100 000 französische Kriegsgefangene auf. Im Vergleich dazu wurden etwa 16 000 britische Kriegsgefangene in Frankreich festgehalten.[50] Nach der für Frankreich verlustreichen Schlacht von Trafalgar 1805 wurden 210 Marineoffiziere und 4 589 Seeleute nach Großbritannien gebracht.[51] Im Juni 1812 waren etwa 25 420 französische Seeleute inhaftiert.[52] Zwischen 1810 und 1814 wurden 16 000 französische Soldaten in Russland, Polen und Deutschland gefangen genommen;[53] zahlreiche französische Zivilisten wurden in Großbritannien interniert: 1812 waren es 1557, darunter 152 Frauen und Kinder – ein in diesem Ausmaß neuartiges Phänomen.[54]
Gerade in französischsprachigen Romanen (man denke nur an Alexandre Dumas’ Grafen von Monte Christo) und Autobiographien nahm die Erinnerung an das traumatische Erlebnis der Gefangenschaft – gerade vor dem Hintergrund des verlorenen Krieges – einen zentralen Platz ein.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Napoleon de facto nicht nur der letzte französische Gefangene der Revolutions- und Napoleonischen Kriege war, sondern mehr noch, wahrscheinlich der berühmteste Kriegsgefangene der Geschichte. Während in Wien die Neuordnung Europas verhandelt wurde, fand die napoleonische Herrschaft 1815 ihr Ende mit der Exilierung des Korsen auf der entlegenen (britischen) Atlantikinsel St. Helena. St. Helena wurde ebenso zum Sinnbild für das Weiterleben des Napoleon-Mythos und des Bonapartismus wie zum Symbol britischer Überlegenheit über Napoleon und seinen Mythos.[55]
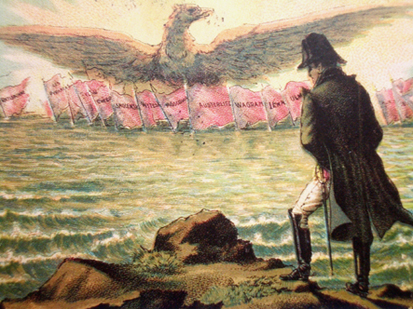
Napoleon wurde in der europäischen Erinnerung zum Gefangenen par excellence und sein Exil auf St. Helena in ganz Europa zu einem von Mythen umwobenen Wallfahrtsort und zur zentralen Kulisse historischer Romane[56] sowie Gegenstand von Autobiographien, Druckgraphiken, Postkarten, Karikaturen und Filmen.
106
Abell, Francis: Prisoners of War in Britain 1756 to 1815. A record of their lives, their romance and their sufferings, Oxford 1914.
[Anonym]: »Soldaten-Gefangennehmung«, in: Zedlers Universal-Lexicon 38 (1743), S. 259–262 (Sp. 491–497), URL: http://www.zedler-lexikon.de/zedler2007/index.html (eingesehen am 16. November 2007).
[Anonym]: Einige Acten-Stücke zur Geschichte der Gefangennehmung des Chursächsischen Feld-Marsch. von Schöning, Mon. May 1692, in: Göttingisches historisches Magazin 1 (1787), S. 163–180, URL: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/suche.htm (eingesehen am 16. November 2007).
[Anonym]: »Kriegs-Gefangene«, in: Johann Georg Krünitz (Hg.), Oeconomische Encyclopädie 50 (1790), S. 408–469, URL: http://www.kruenitz1.uni-trier.de (eingesehen am 5. März 2007).
[Anonym]: Verzeichnis sämmtlicher, wärend des letzten TürkenKriegs, vom 16 Febr. 1788, bis zum WaffenStillstand im Sept. 1790, in türkische Gefangenschaft geratene k.k. Officiere, Cadetten, und Gemeine, nebst dem Ausweis ihrer Ranzionirung, in: Stats-Anzeigen 17 (1792), 17. Bd., S. 68 f., URL: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/suche.htm (eingesehen am 16. November 2007).
[Anonym]: Liste de 16000 militaires au service de la France, faits prisonniers de guerre de 1810 à 1814, et qui sont morts en Russie, en Pologne et en Allemagne, Paris 1825.
APW siehe Oschmann, Antje
Assmann, Aleida: Zum Problem der Identität aus kulturwissenschaftlicher Sicht, in: Rolf Lindner (Hg.), Die Wiederkehr des Regionalen. Über neue Formen kultureller Identität, Frankfurt/Main 1994, S. 13–35.
Dies. u.a. (Hg.): Identitäten, Frankfurt/Main 1998 (Erinnerung, Geschichte, Identität 3).
Balzac, Honoré: La femme de trente ans, relevé de variantes par Maurice Allem, Paris 1962 (Classiques Garnier), URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k101419f.notice (eingesehen am 16. Nov. 2007).
Becker, Ernst Wolfgang: Zeiterfahrungen zwischen Revolution und Krieg. Zum Wandel des Zeitbewußtseins in der napoleonischen Ära, in: Nikolaus Buschmann u.a. (Hg.), Die Erfahrung des Krieges. Erfahrungsgeschichtliche Perspektiven von der Französischen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg, Paderborn 2001 (Krieg in der Geschichte 9), S. 67–96.
Berding, Helmut u.a. (Hg.): Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2000 (Formen der Erinnerung 4).
Bierther, Kathrin (Bearb.): Die Politik Maximilians von Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651, Teil 2, Bd. 10: Der Prager Frieden von 1635, München / Wien 1997, Teilband 1–4 (Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges N.F.).
Blaschke, Karlheinz: »Hubertusburg«, in: Walter Schlesinger (Hg.), Handbuch der historischen Stätten Deutschlands 8. Sachsen, Stuttgart 1965 (Kröners Taschenausgabe 312), S. 154 f.
Böhme, Ernst u.a. (Hg.): Vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Anschluss an Preußen – Der Wiederaufstieg als Universitätsstadt (1648–1866), Göttingen 2002 (Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt 2).
Braubach, Max: Politisch-militärische Verträge zwischen den Fürstbischöfen von Münster und den Generalstaaten der Vereinigten Niederlande im 18. Jahrhundert, in: Westfälische Zeitschrift 91 (1935), S. 150–194.
Burkhardt, Johannes: Vom Debakel zum Mirakel. Zur friedensgeschichtlichen Einordnung des siebenjährigen Krieges, in: Helmut Neuhaus u.a. (Hg.): Menschen und Strukturen in der Geschichte Alteuropas; Festschrift für Johannes Kunisch zur Vollendung seines 65. Lebensjahres, Berlin 2002 (Historische Forschungen 73), S. 299–318.
Buschmann, Nikolaus u.a. (Hg.): Die Erfahrung des Krieges. Erfahrungsgeschichtliche Perspektiven von der Französischen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg, Paderborn 2001 (Krieg in der Geschichte 9).
Campe, Joachim Heinrich: Campens Bemühung zur Befreyung Schubarts, in: Journal von und für Deutschland 5 (1788), 7.–12. St., S. 120 f., URL: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/suche.htm (eingesehen am 16. November 2007).
Colley, Linda: Captives. Britain, Empire and the World, London 2002.
Daly, Gavin: Napoleon’s Lost Legions. French Prisoners of War in Britain, 1803–1814, in: History 89 (2004), S. 361–380, URL: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-229X.2004.00304.x (eingesehen am 6. März 2008).
Dawson, Graham: Soldier heroes. British adventure, Empire and the imagining of masculinities, London 1994.
Duchhardt, Heinz u.a. (Hg.): Krieg und Frieden im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Theorie – Praxis – Bilder. Guerre et Paix du Moyen Age aux Temps Modernes Théorie – Pratiques – Représentations, Mainz 2000 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte 52).
Ders.: Bilanz und Anstoß. Ein Kommentar zum Wiener Europa-Symposion, in: Gerald Stourzh (Hg.), Annäherungen an eine europäische Geschichtsschreibung, Wien 2002 (Archiv für österreichische Geschichte 137), S. 141–146.
Ders. u.a. (Hg.): Kalkül – Transfer – Symbol. Europäische Friedensverträge der Vormoderne, Mainz 2006 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte online 1), URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/01-2006.html (eingesehen am 16. Nov. 2007).
Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart 2005.
Fisch, Jörg: Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses, Stuttgart 1979 (Sprache und Geschichte 3).
Fontane, Theodor: Kriegsgefangen. Erlebtes 1870, Berlin 1871.
Ders.: Aus den Tagen der Occupation. Eine Osterreise durch Nordfrankreich und Elsaß-Lothringen, Berlin 1871, Bd. 1–2.
Forbes, James: Letters from France written in the years 1803 and 1804, London 1806, Bd. 1–2.
Hauff, Wilhelm: Die Geschichte Almansors, in: ders. (Hg.), Märchenalmanach auf das Jahr 1827, Leipzig 1891 (Hauffs Werke 4). Online bei Projekt Gutenberg-DE, URL: http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=3472&kapitel=26&cHash=649ed3e3452#gb_found (eingesehen am 10. März 2008).
Hupel, August Wilhelm: [Rezension von] Thesby de Belcourt, F.A., Tagebuch eines französischen Officiers in Diensten der pohlnischen Konföderation, welcher von den Russen gefangen und nach Sibirien verwiesen worden, in: Allgemeine deutsche Bibliothek 31 (1777), S. 541–544, URL: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/suche.htm (eingesehen am 16. November 2007).
107
Köbler, Gerhard: Lexikon der europäischen Rechtsgeschichte, München 1997.
Kunisch, Johannes: Von der gezähmten zur entfesselten Bellona. Die Umwertung des Krieges im Zeitalter der Revolutions- und Freiheitskriege, in: ders. (Hg.), Fürst – Gesellschaft – Krieg. Studien zur bellizistischen Disposition des absolutistischen Fürstenstaates, Köln u.a. 1992, S. 203–226.
Ders. u.a. (Hg.): Die Wiedergeburt des Krieges aus dem Geiste der Revolution. Studien zum bellizistischen Diskurs des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, Berlin 1999 (Beiträge zur politischen Wissenschaft 110).
Küster, Carl Daniel: Die Lebensrettungen Friedrichs des Zweyten im siebenjährigen Kriege, Berlin 1792.
La Flize, Dominique de: Pochod Napoleona v Rossiju v 1812 godu, Moskau 1912.
Lenz, Thierry (Hg.): Sainte-Hélene. Ile de Mémoire, Paris 2005.
Leonhard, Jörn: Bellizismus und Nation. Die Deutung des Krieges und die Bestimmung der Nation: Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die Vereinigten Staaten 1750–1914, unveröffentlichte Habilschrift, Heidelberg 2004, Bd. 1–3.
Lewis, Michael: Napoleon and his British captives, London 1962.
Lüsebrink, Hans-Jürgen: Kulturtransfer – neuere Forschungsansätze zu einem interdisziplinären Problemfeld der Kulturwissenschaften, in: Helga Mitterbauer (Hg.), Ent-grenzte Räume. Kulturelle Transfers um 1900 und in der Gegenwart, Wien 2004 (Studien zur Moderne 22), S. 23–73.
Masson, Philippe: Les Sépulcres flottants. Prisonniers français en Angleterre sous l’Empire, Rennes 1987.
Oschmann, Antje (Bearb.): Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden, Münster 1998 (Acta Pacis Westphalicae, Serie 3 Abt. B Bd. 1), Teil 1 Urkunden. Online in: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen (Acta Pacis Westphalicae. Supplementa electronica 1), URL: http://www.pax-westphalica.de/ipmipo (eingesehen am 16. November 2007).
Paris, Michael: Warrior Nation. Images of War in Britsh Popular Culture, London 2000.
Peters, Jan (Hg.): Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg. Eine Quelle zur Sozialgeschichte, Berlin 1993 (Selbstzeugnisse der Neuzeit 1).
Raumer, Kurt von: Ewiger Friede. Friedensrufer und Friedenspläne seit der Renaissance, München 1953 (Geschichte der politischen Ideen in Dokumenten und Darstellungen 1).
Ringmar, Erik: Identity, Interest and Action. A Cultural Explanation of Sweden’s Intervention in the Thirty Years War, Cambridge 1996.
Robel, Gerd / Robel, Hergard: Alieni de Russia. Russlandberichte von der ältesten Zeit bis zum Jahre 1855, Bd. 3 Lieferung 3 (1811–1812), München 1999 (Mitteilungen des Osteuropa-Instituts München).
Saul, Nigel (Hg.): The Oxford Illustrated History of Medieval England, Oxford 1997.
Schmidt-Rösler, Andrea: Princeps Transilvaniae – Rex Hungariae? Gabriel Bethlens Außenpolitik zwischen Krieg und Frieden, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Kalkül – Transfer – Symbol. Europäische Friedensverträge der Vormoderne, Mainz 2006 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 1), Abschnitt 80–98, URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/01-2006.html (eingesehen am 16. November 2007).
Schröckh, Johann Matthias: Geschichte der Gefangenschaft des Hugo Grotius, in: Beiträge zur Beruhigung und Aufklärung 5 (1797), 2. St., S. 146–166, URL: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/suche.htm (eingesehen am 16. November 2007).
Serman, William / Bertaud, Jean-Paul: La nouvelle histoire militaire de la France 1789–1919, Paris 1998.
Siemann, Wolfram: Auf der Suche nach einer Friedensordnung. Das Jubiläum der Revolution von 1848 im Nachkriegsdeutschland, in: Johannes Burkhardt (Hg.), Krieg und Frieden in der historischen Gedächtniskultur. Studien zur friedenspolitischen Bedeutung historischer Argumente und Jubiläen von der Antike bis zur Gegenwart, München 2000 (Schriften der Philosophischen Fakultäten der Universität Augsburg 62, Historisch-sozialwissenschaftliche Reihe), S. 125–136.
Strohmeyer, Arno: Friedensverträge im Wandel der Zeit: Die Wahrnehmung des Friedens von Madrid 1526 in der deutschen Geschichtsforschung, in: Heinz Duchhardt u.a. (Hg.), Kalkül – Transfer – Symbol. Europäische Friedensverträge der Vormoderne, Mainz 2006 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beihefte online 1), Abschnitt 132–143, URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/01-2006.html (eingesehen am 16. November 2007).
Vattel, Em(m)er(ich) de: Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi naturelle appliqués à la Conduite et aux Affaires des Nations et des Souverains, Leiden 1758, Bd. 1–2.
Voigtländer, Lutz: Vom Leben und Überleben in Gefangenschaft: Selbstzeugnisse von Kriegsgefangenen 1757 bis 1814, Freiburg i. Br. 2005.
Wandruszka, Adam: Reichspatriotismus und Reichspolitik zur Zeit des Prager Friedens von 1635. Eine Studie zur Geschichte des deutschen Nationalbewußtseins, Graz u.a. 1955 (Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 17).
Wegner, Bernd (Hg.): Wie Kriege entstehen. Zum historischen Hintergrund von Staatenkonflikten, Paderborn 2000 (Krieg in der Geschichte 4).
Ders. (Hg.): Wie Kriege enden. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn 2002 (Krieg in der Geschichte 14).
Werner, Michael u.a. (Hg.): De la comparaison à l’histoire croisée, Paris 2004 (Le genre humain 42).
Ders. / Zimmermann, Bénédicte: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity, in: History and Theory 45,1 (2006), S. 30–50.
Wolfrum, Edgar: Krieg und Frieden in der Neuzeit. Vom Westfälischen Frieden bis zum Zweiten Weltkrieg, Darmstadt 2003 (Kontroversen um die Geschichte).
108
[*] Kirstin Schäfer, Dr., Frankreich-Zentrum der Freien Universität Berlin, Wiss. Mitarbeiterin, zeitweise freie Mitarbeiterin im DFG-Projekt »Europäische Friedensverträge der Vormoderne Online«.
[1] Goethes Faust I, zit. nach Wolfrum, Krieg und Frieden 2003, S. 1.
[2] Zit. nach ebd., S. 41.
[3] Ebd., S. 3 f.; vgl. auch Wegner, Wie Kriege entstehen 2000; Ders.: Wie Kriege enden 2002.
[4] Lange lagen die Schwerpunkte der militärhistorischen Betrachtung auf der bloßen Deskription von Kriegen sowie der Huldigung ihrer Helden. Mit der Öffnung der traditionellen Militärgeschichte zunächst für wirtschafts- und sozialgeschichtliche, später auch kulturgeschichtliche Fragestellungen veränderte sich der Fokus des Interesses der militärhistoriographischen Forschung. Wegweisend waren hier vor allem französische Forscher, die sich schon früh intensiv mit der Sozialgeschichte der französischen Armee beschäftigt haben; vgl. dazu Serman / Bertaud, Histoire militaire 1998.
[5] Buschmann, Erfahrung des Krieges 2001; vgl. die herausragende Untersuchung Leonhard, Bellizismus und Nation 2004. Leonhard behandelt den intellektuellen Bellizismus-Diskurs in den untersuchten Ländern.
[6] Vgl. zuletzt Duchhardt, Kalkül – Transfer – Symbol 2006; vgl. auch Raumer, Ewiger Friede 1953.
[7] Wolfrum, Krieg und Frieden, S. 28, unter Verweis auf Berding, Krieg und Erinnerung 2000.
[8] Vgl. die universalhistorische Studie Fisch, Krieg und Frieden 1979.
[9] Erll, Kollektives Gedächtnis 2005; Siemann, Suche nach einer Friedensordnung 2000.
[10] Voigtländer, Leben und Überleben 2005; Beispiele in Robel / Robel, Alieni de Russia 1999 mit einer Auflistung zahlreicher Berichte von Kriegsgefangenen in Russland. Zahlreiche Quellen finden sich auch in den digitalisierten Zeitschriften der Aufklärung der Universität Bielefeld, u.a. Hupel, Rez. Belcourt Tagebuch 1777; Anonym, Acten-Stücke 1787; Campe, Bemühung 1788; Anonym, Verzeichnis 1792; Schröckh, Gefangenschaft des Hugo Grotius 1797; http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/suche.htm (eingesehen am 16. November 2007).
[11] Colley, Captives 2002; Daly, Napoleon’s Lost Legions 2004; Lewis, Napoleon and his British captives 1962; Masson, Sépulcres flottants 1987.
[12] Werner / Zimmermann, Histoire Croisée 2006; Werner, De la comparaison à l’histoire croisée 2004.
[13] Vgl. Anonym, Soldaten-Gefangennehmung 1743.
[14] Köbler, Lexikon 1997, Art. »Kriegsgefangener«, S. 309.
[15] Anonym, Kriegs-Gefangene 1790.
[16] Ebd.
[17] Vgl. zu der Bildlichkeit in der Erinnerungskultur der Frühen Neuzeit Duchhardt, Krieg und Frieden 2000.
[18] Abb. 1: Ausschnitt aus dem Teppich von Bayeux, ca. 7000 x 50 cm, entstanden zwischen 1070 und 1082 n. Chr., Künstler unbekannt. Detail: Die Gefangennahme König Harolds durch den Grafen von Ponthieu und seine Ritter. Original: Musée de la Reine Mathilde (Bayeux, Normandie).
[19] Abb. 2: Der Herzog von Orléans als Gefangenen im Londoner Tower, britische Miniatur aus dem 15. Jh., Künstler unbekannt. Provenienz der Abb.: British Library, London, Sig. MS Royal 16 F ii fo. 73; farbige Abb., in: Saul, Nigel (Hg.): The Oxford Illustrated History of Medieval England, Oxford 1997, S. 117.
[20] Hierzu Strohmeyer, Friedensverträge 2006.
[21] Theodor Fontane wurde übrigens im deutsch-französischen Krieg 1870/71 selbst zum Kriegsgefangenen; diese Erfahrungen verarbeitete er in Fontane, Kriegsgefangen 1871 und ders., Aus den Tagen der Occupation 1871.
[22] Vgl. den Kupferstich von P. Haas nach Zeichnung von B. Rode in: Küster, Lebensrettungen Friedrichs 1792.
[23] Vgl. z.B. die dramatischen Gemälde des britischen Malers Robert Home: The Death of Colonel Moorhouse at the Pettah Gate of Bangalore; 1791–97. Ö/L, 149×199,4 cm, National Army Museum, London, und deren Verbreitung in der populären Druckgraphik wie bei Edward Stalker (nach Robert Home): The Death of Col. Moorhouse, at the Storming of Bangalore; 1811. London, Geoe. Guilding, June 1st, 1811, Druckgraphik handkoloriert, A.S.K. Brown Military Collection, Providence oder Sir David Wilkie’s »General Sir David Baird discovering the body of Sultan Tippoo after the Storming of Seringapatam« (heute National Gallery of Scotland). Die Ereignisse in Indien waren um 1800 in der britischen Öffentlichkeit von so großem Interesse, dass sie auch auf die Londoner Bühnen gebracht wurden; z.B. Sadlers Wells: »The Pantomime Story of Tippoo Saib«, »The Death of Tippoo, and the Capture of his Two Sons by the British Army and their Allies« oder Asley’s Royal Amphitheatre: »The Storming of Seringapatam, or the Death of Tippoo Saib«; Lyceum Theatre (1800): »The Storming of Seringapatam«; vgl. dazu auch Paris, Warrior Nation 2000, S. 13–83.
[24] Vgl. dazu den Erfahrungsbericht eines einfachen Soldaten im Dreißigjährigen Krieg in Peters, Söldnerleben 1993. Kulturgeschichtlich hoch interessant in diesem Zusammenhang ist Ringmar, Identity, Interest and Action 1996.
[25] Vgl. Burkhardt, Vom Debakel zum Mirakel 2002, S. 304.
[26] Das in blaue Pappe gebundene Buch ist in einer bewundernswert sauberen und gut lesbaren deutschen Handschrift verfasst (seiner eigenen?). Namen sind lateinisch geschrieben, ebenso französische Begriffe. Teilweise wechselt die Schrift sogar in einem Wort; mein Dank für die Bereitstellung der Quelle gilt Herrn Otto Freiherrn von Blomberg, Familienarchiv, Rittergut Nienfeld.
[27] Ebd.; vgl. zum Entstehungsumfeld der Quelle: Böhme, Göttingen 2002.
[28] Zur pleasure culture of war besonders im Falle Großbritanniens, das Kriege als ›absentes‹ Phänomen erlebte vgl. Dawson, Soldier heroes 1994.
[29] Vgl. Duchhardt, Bilanz und Anstoß 2002; er prägt hier den Begriff der ›Schneisengeschichte‹.
[30] Vgl. Lüsebrink, Kulturtransfer 2004, S. 28.
[31] Die Tagebuchnotizen des Arztes sind erstmals in russischer Sprache erschienen: de La Flize, Pochod Napoleona 1912 (nachgewiesen bei Robel / Robel, Alieni de Russia, S. 58 Nr. 518).
[32] Vgl. Abell, Prisoners of war 1914, S. 429; als Beispiel Forbes, Letters 1806.
[33] Balzac, Femme de trente ans 1962.
[34] Hauff, Die Geschichte Almansors 1891.
[35] Friedensvertrag von Großwardein 1538 II 24, S. 23, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 30. März 2008).
[36] Friedensvertrag von Pressburg 1626 XII 20, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 18. März 2008). Vgl. Schmidt–Rösler, Princeps Transilvaniae 2006.
[37] Friedensvertrag von Prag 1635 V 30, S. 46, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 18. März 2008). Gedruckt bei Bierther, Prager Frieden 1997, Teilband 4, S. 1606–1630, hier S. 1620 Artikel 57; vgl. Wandruszka, Reichspatriotismus 1955.
[38] Artikel 104 IPM = Artikel XVI,7 IPO, in: APW 3.B.1.1, S. 31, 152. Auch online in: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen (Acta Pacis Westphalicae. Supplementa electronica 1); http://www.pax-westphalica.de/ipmipo (eingesehen am 16. November 2007).
[39] Artikel 105 IPM entsprechend Artikel XVI,13 IPO, in: APW 3.B.1.1, S. 31, 154. Auch online in: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen (Acta Pacis Westphalicae. Supplementa electronica 1); http://www.pax-westphalica.de/ipmipo (eingesehen am 16. November 2007).
[40] Vattel, Droit des Gens 1758.
[41] Subsidienvertrag von Den Haag 1703 III 13, S. 6, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 30. März 2008). Gedruckt bei Braubach, Politisch-militärische Verträge 1935, S. 172–175, hier S.173.
[42] Friedens- und Handelsvertrag von Utrecht 1714 VI 26 Generalstaaten, Spanien, S. 34 f., in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 30. März 2008).
[43] Friedensvertrag von Hubertusburg 1763 II 15, S. 6, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters, http://www.ieg-mainz.de/friedensvertraege (eingesehen am 30. März 2008). Das zwischen 1721 und 1742 von König August II. zur Parforcejagd erbaute Schloss Hubertusburg wurde während des Krieges 1761 im Inneren komplett zerstört und geplündert. Die Tagungen der Gesandten fanden somit nicht im Schloss statt, sondern einige Meter östlich des Gebäudes in Pavillons, vergleiche Blaschke, Hubertusburg 1965, S. 154.
[44] Dazu Kunisch, Entfesselte Bellona 1992 sowie ders., Wiedergeburt des Krieges 1999.
[45] Zur Problematik des Identitätsbegriffs allg. Assmann, Problem der Identität 1994 und dies., Identitäten 1998.
[46] Becker, Zeiterfahrungen 2001.
[47] Wolfrum, Krieg und Frieden, S. 53.
[48] Abell, Prisoners of war, S. 117.
[49] Public Record Office (PRO) London, ADM 105/46, Transport Board table on French prisoners of war, 19 March 1810.
[50] Lewis, Napoleon and his British captives, S. 48.
[51] Masson, Sépulcres flottants 1987, S. 47.
[52] PRO ADM 105/46, Transport Board table on French prisoners of war, 19 March 1810.
[53] Vgl. Anonym, Liste 1825.
[54] Archives Nationales Paris (AN) FF2 17, government table on French prisoners of war from 22 May 1803 to 30 May 1814.
[55] Abb. 3: Napoléon als Gefangener auf St. Helena, franz. Postkarte aus dem 19. Jh., Künstler unbekannt. Im Besitz der Fondation Napoléon, Blv. Haussmann, Paris. Proveninez der Abb., in: Lenz, Thierry (Hg.): Sainte-Hélene. Ile de Mémoire, Paris 2005.
[56] Vgl. dazu Lenz, Sainte-Hélene 2005. Romanbeispiel: Paul Féval, La petite-fille du Bossu, Paris 1931.
Kirstin Schäfer, Kriegsgefangenschaft in Friedensvertragsrecht und Literatur, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 94–108.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008062408>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 95 oder 94–97.