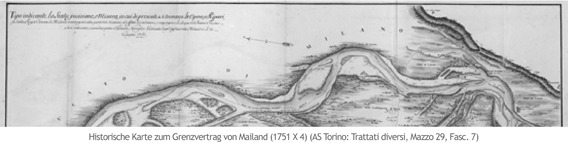
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz
Beiheft online 4
Martin Peters (Hg.)
Grenzen des Friedens
Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne
Mainz: Institut für Europäische Geschichte 2010
ISSN: 1863-897X
Europäische Friedensverträge der Vormoderne sind eine geeignete Quelle, um räumliche Wahrnehmung in der damaligen Zeit zu untersuchen. Landerwerb, Ländertausch, Landkompensationen und Arrondierung sind zentrale raumbezogene Maßnahmen frühneuzeitlicher Außen- und Sicherheitspolitik. Was kann man aus Friedensverträgen über Räume, Orte und Grenzen erfahren? Enthalten diese völkerrechtlichen Urkunden und deren Auslegungen Informationen über den Aufbau, Ausbau oder auch Abbau spezifischer Räume und Orte, Grenzen und Linien? Die Beiträge des online-Beihefts „Grenzen des Friedens“ untersuchen an ausgewählten Beispielen raumbezogene Dimensionen im europäischen Friedensprozess der Vormoderne.
Empfohlene Zitierweise:
Martin Peters (Hg.): Grenzen des Friedens. Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne, Mainz 2010-07-15 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 4).
URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/04-2010.html
URN: urn:nbn:de:0159-2008061836
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieser Publikation hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Inhaltsverzeichnis
Andreas Kunz / Johannes Wischmeyer
Geleitwort: Frühneuzeitliche Friedensgrenzen im Kontext raumbezogener Fragestellungen
Andrea Weindl
Von Linien und (Stütz-)Punkten – Kartographie und Herrschaft im Zeitalter der Entdeckungen
Martin Peters
Friedensorte in Europa – Überlegungen zu einer Topographie vormoderner Friedensschlüsse
Peter Seelmann
"… zu einer Bestendigen rechten und heytern March gesetzt und benambset …" – Grenzen und Räume in Savoyen-Piemont
Andrea Schmidt-Rösler
Grenzraum und Staatlichkeit. Zur Wahrnehmung des Fürstentums Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit
Bengt Büttner
"an beider reiche grentzen oder sonst einem gelegenen ort" – die dänisch-schwedischen Grenztreffen im 16. und 17. Jahrhundert
Martin Peters *
Vorwort
Gliederung:
Text:
Die Beiträge der vorliegenden online-Publikation sind das Ergebnis von Forschungen, die im Rahmen des DFG-geförderten Projektes „Europäische Friedensverträge der Vormoderne – online“ entstanden, das zwischen 2005 und 2009/2010 am Institut für Europäische Geschichte angesiedelt war. Ein Teil des Vorhabens war seit 2008 integriert in den Forschungsbereich „Raumbezogene Forschungen zur Geschichte Europas seit 1500“. Die Grundlage der Beiträge, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Projektgruppe „Europäische Friedensverträge der Vormoderne“ erarbeitet wurden, bildete ein internes Kolloquium des Forschungsbereichs „Die Grenzen des Friedens“, das am 19. Februar 2009 am Institut für Europäische Geschichte in Mainz durchgeführt wurde.
Für die Vorbereitung der online-Publikation ist Henrike Meyer zu Devern und Vanessa Brabsche zu danken.
Mainz, im Juli 2010
Martin Peters
4
[*] Martin Peters, Dr., Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
Martin Peters, Vorwort, in: Martin Peters (Hg.), Grenzen des Friedens. Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne, Mainz 2010-07-15 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 4), Abschnitt 4–4.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/04-2010.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008061836>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 5 oder 4–7.
Andreas Kunz / Johannes Wischmeyer *
Geleitwort: Frühneuzeitliche Friedensgrenzen im Kontext raumbezogener Fragestellungen
Gliederung:
Text:
Der vorliegende online-Sammelband zu den ‚Grenzen des Friedens‘ kombiniert einen konzeptionellen und einen materialen Ansatz: Theoretischer Fokus ist die raumbezogene Analyse historischer Gesellschaften, ihrer Diskurse und Institutionen. Thematischer Schwerpunkt sind die Rahmenbedingungen frühneuzeitlicher Friedensverträge, die in den Jahren 2005 bis 2009 von einer DFG-finanzierten Projektgruppe am Institut für Europäische Geschichte untersucht wurden. Das Interesse der – allesamt dem Friedensverträge-Projekt verbundenen – Autoren geht dahin, Fragestellungen, die sich dem sogenannten ’spatial turn‘ in den Sozial- und historischen Kulturwissenschaften widmen, für die Erforschung frühneuzeitlicher Friedensverträge und der sie umgebenden politischen Kultur fruchtbar zu machen. Damit werden gleich mehrere aktuelle Tendenzen der Frühneuzeitforschung aufgegriffen – die erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber Phänomenen von geographisch und/oder sozial konnotierter Räumlichkeit; die Beschäftigung mit Fragen der politischen Kultur; und nicht zuletzt das Interesse an kulturellem Austausch, Transfer- und Übersetzungsbeziehungen auf europäischer Ebene und darüber hinaus.
Gleichzeitig dokumentieren die hier vorgelegten Studien die Kooperation mit dem am Institut für Europäische Geschichte seit 2007 eingerichteten Forschungsbereich ‚Raumbezogene Forschungen zur Geschichte Europas seit 1500‘, dem das Friedensverträge-Projekt im letzten Jahr seiner Laufzeit teilweise zugeordnet war. Der Forschungsbereich hat sich zum Ziel gesetzt, die Frage nach den Grundlagen des modernen Europa in räumlicher Perspektive zu thematisieren. Dieser Frage wird in Form von Analysen historischer, geographischer, wirtschaftlich-sozialer, kulturell-religiöser und politischer Räume und Raumsysteme in der europäischen Geschichte der Neuzeit nachgegangen. Bei aller Heterogenität der innerhalb des Forschungsbereichs verfolgten Einzelprojekte und bei aller Offenheit für neuere, sozialwissenschaftlich bestimmte Raumtheorien verbindet die am Forschungsbereich beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Überzeugung, dass eine Operationalisierung der Raumsemantik im Zuge historischer Untersuchungen nur dann sinnvoll ist, wenn die untersuchte Situation eine wahrnehmbare geographische Dimension besitzt. In der Zusammenarbeit mit dem Friedensverträge-Projekt hat sich die Tragfähigkeit dieser Voraussetzung erneut bewiesen. Darüber hinaus waren und sind für alle Beteiligten zwei konzeptionelle Leitgedanken bestimmend:
Die erste verbindende Fragestellung gilt den Kriterien für Raumbildung. Dabei interessiert zunächst die Herausbildung, Entwicklung und Aushandlung von Grenzen als Grundlage der Konstituierung sowie der Veränderung historischer Räume. Weiterhin wird untersucht, auf welche Weise die interne Kohäsion dieser Räume durch Organisations- und Entwicklungsstrategien gesteigert bzw. durch Differenzierungen und Diversifizierungsprozesse gemindert wurde. Daraus hat sich eine Reihe zu bearbeitender Forschungsfelder ergeben: Seit Längerem wird die Entwicklung von überregionalen und transnationalen Wirtschaftsräumen im Zeitalter der Moderne, auch in ihrer Rolle als Motor von zentralisierten politischen Räumen, untersucht. In jüngerer Zeit kam die Frage nach der Genese und dem Ausbau von Religions- bzw. Konfessionsräumen hinzu – mit Schwerpunkten im Zeitalter der Konfessionalisierung Europas sowie im langen 19. Jahrhundert. Im Friedensverträge-Projekt wird nun eine der zentralen Leitfragen des Forschungsbereichs – diejenige nach der Entwicklung von politischen Räumen bzw. nach der Territorien- und Staatenbildung sowie der „Lebens“-Geschichte dieser Räume – aufgegriffen. Ansatzweise geht es außerdem um die (oft prekäre) Beziehung sprachlicher, ethnischer und allgemein primär kulturell bestimmter Räume zu politischen Raumsystemen. Ohne sich mit diesen Themen zu beschäftigen, kann die Ausbildung des modernen Europa in seiner territorialen Gliederung nicht verstanden werden.
5
Die zweite gemeinsame Leitfrage betrifft die Interaktion von historischen Räumen. Charakteristisch für die europäische Geschichte der Neuzeit sind wechselnde Konstellationen grenzübergreifender politischer Bündnisse, religiös-konfessioneller Kulturräume sowie wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Kooperationen. Diese historischen Raumbeziehungen stellen Grenzbildungen infrage und führen zu ihrer zeitweiligen Überwindung. In beteiligten Forschungsprojekten wurden bisher die Schaffung internationaler Verkehrsnetze – als „entgrenzende“ Voraussetzung für überregionale und transnationale Handelsbeziehungen, auch und gerade in Zeiten merkantilistischer bzw. nationalökonomischer Tendenzen der Wirtschaftspolitik –, die Ausbildung politischer Kooperationsräume, außerdem überregionale Religions- und transnationale Bildungspolitik untersucht. Dabei stand immer auch die Frage im Vordergrund, inwiefern die Interaktion historischer Räume sowohl als parallele wie auch als eine zeitversetzte Reaktion auf Grenzziehungen verstanden werden kann. Das im vorliegenden online-Sammelband verfolgte Konzept der ›Friedensräume‹ fragt nach der wechselseitigen Interaktion europäischer Räume und Raumsysteme in Form politischer Allianzen, Unionen, Staatenbünde oder auch nur vermittels einer institutionalisierten Friedensdiplomatie. Es erweitert und vertieft damit die im Forschungsbereich behandelten Sachthemen um die (Kultur-)Geschichte der internationalen Beziehungen.
In der Summe zeigen die Beiträge das Erkenntnispotenzial, das raumbezogene Fragestellungen in sich bergen. Es ist zu wünschen, dass bald weitere Forschungen den hiermit eröffneten Diskussionsraum beleben werden.
6
[*] Andreas Kunz, Ph.D., Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
Johannes Wischmeyer, Dr., Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
ZITIEREMPFEHLUNG
Andreas Kunz / Johannes Wischmeyer, Geleitwort: Frühneuzeitliche Friedensgrenzen im Kontext raumbezogener Fragestellungen, in: Martin Peters (Hg.), Grenzen des Friedens. Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne, Mainz 2010-07-15 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 4), Abschnitt 5–6.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/04-2010.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008061836>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 6 oder 5–8.
Andrea Weindl *
Von Linien und (Stütz-)Punkten – Kartographie und Herrschaft im Zeitalter der Entdeckungen
Gliederung:
a) Geheimnisvolles Afrika oder Kartographiepolitik im 15. Jahrhundert
b) Die Entdeckung Amerikas als Medienereignis
3. Die Linien und die Kartographie
4. Zeigen, benennen und verschweigen
5. Die Karte als Medium plakativer politischer Propaganda
6. Zusammenfassung und Schluss
Quellen- und Literaturverzeichnis
Text:
Die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus brachte den Europäern nicht nur neue Seewege und einen ganz neuen Kontinent ins Bewusstsein. Der Umstand, dass Kolumbus im Auftrag der spanischen Könige nach Westen gesegelt war und im Namen derselben die neu entdeckten Ländereien in Besitz nahm, ließ die europäische Expansion unwiderruflich zu einem Kommunikationsproblem werden. Zwar war wahrscheinlich bereits vor 1492 der ein oder andere Seefahrer mit oder ohne königlichen Auftrag und Schutz nach Westen gesegelt und hatte mehr oder weniger zufällig neue Inseln oder amerikanisches Festland betreten, doch kaum jemandem war es bis dahin gelungen, feste Besitzansprüche im Atlantik anzumelden – geschweige denn stetige Verbindungen mit neu entdeckten Gebieten aufrecht zu erhalten. Einzig die Seeleute im Auftrag der portugiesischen Krone galten als unumstrittene Avantgarde der europäischen Entdecker, und Portugal war das einzige Land, in dem die Fahrten in unbekannte atlantische Gewässer hoheitlich gefördert wurden, ebenso wie die Sammlung von Informationen darüber in königlichem Auftrag stattfand[1]. So blieb nach der Eroberung der Kanaren durch Spanien die europäische Expedition nach Übersee zunächst eine portugiesische Angelegenheit. Erst die Unternehmungen Kolumbus’ stellte die portugiesische Vorherrschaft auf diesem Gebiet ernsthaft in Frage, und so ist es kein Wunder, dass schon kurz nach der Rückkehr des Kolumbus von seiner ersten Fahrt Verhandlungen über die Abgrenzung von Einflusssphären begannen.
Doch das Entdecken, Inbesitznehmen oder zumindest die Reklamierung alleiniger Zugangsrechte blieb keine rein iberische Angelegenheit. Noch in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts, das gesamte 16. Jahrhundert über und im beginnenden 17. Jahrhundert häuften sich – auch im Zusammenhang mit der Verschärfung der politischen Auseinandersetzungen in Europa – die Fahrten von Franzosen, Niederländern, Engländern[2] usw. in überseeische Gewässer mit der Maßgabe, neue Gebiete zu entdecken und für die jeweilige Krone in Besitz zu nehmen.
7
Gleichzeitig begreifen neuere Forschungen die europäische Expansion weniger von europäischen Staaten gelenkt, sondern als Handlungsfeld von Akteuren verschiedenster ethnischer Provenienz, die im eigenen Interesse eroberten, Forts anlegten, Handelsverträge schlossen und den Handel abwickelten[3]. Natürlich versuchten die Akteure, staatliche Stellen für Finanzierungs-, Planungs- und Organisationsaufgaben zu nutzen, doch allzu oft mussten sie sich mit ideeller Unterstützung und Schutzbriefen zufrieden geben. Wenn es der politischen Opportunität in Europa diente, entzog man ihnen auch das und sie bezahlten ihre Unternehmungen mit dem Gefängnis oder dem Leben[4]. Dennoch hat sich über Jahrhunderte im Gedächtnis der Europäer die Expansion als ein von großen europäischen Männern im Auftrag großer europäischer Souveräne unternommenes Unterfangen eingeprägt.
Das Beanspruchen neu entdeckter Gebiete war zunächst einmal ein Kommunikationsproblem. Bei oft nur sporadischen Schiffsverbindungen und kaum militärischer Präsenz vor Ort mussten Ansprüche, und das größtenteils unbeschadet der tatsächlichen Machtverhältnisse in Übersee, gegenüber europäischen Mitbewerbern vermittelt und durchgesetzt werden. Immer wieder ist im Zusammenhang mit der Expansion einhergehenden Weiterentwicklung des europäischen Völkerrechts diskutiert worden, ob es so etwas wie das Recht der Erstentdeckung für bewohnte Gebiete überhaupt gebe. Allerdings wurde diese Frage in Diplomatie und Politik weitgehend unabhängig vom völkerrechtlichen Diskurs verhandelt; es wurde schlichtweg versucht, in irgendeiner Form Fakten zu schaffen.
8
Im Folgenden soll die Kartographie als Medium für die Vermittlung von Herrschaftsansprüchen untersucht werden bzw. als Hilfsmittel, diese Fakten zu schaffen. Thema ist die Kommunikation innerhalb Europas, wenngleich es natürlich bereits seit dem 15. Jahrhundert einen mehr oder weniger regen Austausch kartographischer Techniken und Kenntnisse auch über die Grenzen Europas hinaus gab[5].
Mit Kosseleck soll davon ausgegangen werden, dass „die Räume, die sich der Mensch selbst schafft“[6], also territoriale Inbesitznahme durch den Menschen einen der Pole der Frage nach dem Verhältnis von Raum und Geschichte bildet. Die Kartographie der Frühen Neuzeit kann hierbei als Medium der sozialen und kulturellen Aneignung verstanden werden. Im Bezug auf das Völkerrecht kann das nur heißen, dass dieses Medium weniger im Hinblick auf die Bewohner der nicht-europäischen Gebiete genutzt werden konnte, denn vor Ort musste die Inbesitznahme über physische Präsenz, sei es durch Eroberung, Siedlung, militärische Stützpunkte oder die Erfüllung von Handelskontrakten umgesetzt werden[7], sondern zur Visualisierung und Kommunikation dieser Aneignung innerhalb Europas. Über das Studium frühneuzeitlicher Karten kann man das „Territorialitätsregime“ in der Entstehung auf metaphorischer Ebene beobachten und sich der Beantwortung der Frage annähern, inwieweit diese Metaphorik oder bildliche Repräsentanz im europäischen Völkerrecht über Übersee tatsächlich eine politische Fakten schaffende Rolle spielte.
Die frühneuzeitliche Kartographie hatte eine Doppelfunktion zu erfüllen: Zum einen dienten Karten als Planungsinstrument für weitere Unternehmungen und auf ihnen mussten so viele Informationen wie möglich gesammelt werden, um den Erfolg erneuter Entdeckungsfahrten zu sichern. Neben geographischen Gegebenheiten wie Untiefen, Ankerplätze usw. informierten sie die Seefahrer auch über politische Abgrenzungen, entweder um ihr Eindringen in fremdes Gebiet zu unterbinden oder um sie vor Ansprüchen anderer Parteien zumindest zu warnen. Zum anderen dienten Karten als Repräsentationsinstrument, um die Leistungen und Herrschaftsansprüche einzelner Dynastien oder Staaten im Bewusstsein der Zeitgenossen und potentiellen Konkurrenten zu verankern. Gelegentlich behinderten sich diese beiden Funktionen gegenseitig, denn es konnte durchaus von politischem oder propagandistischem Interesse sein, geographische Gegebenheiten zu verschweigen oder falsch darzustellen.
Dazu trat ein weiteres Spezifikum frühneuzeitlicher Kartographie: über etwas zu kommunizieren, dessen Wesen nicht bekannt war bzw. erst nach und nach von verschiedenen Akteuren erforscht wurde. Informationen verschiedener Kartographen, die nicht alle mit denselben technischen Prämissen arbeiteten, mussten zusammengesetzt werden. Bis zum 18. Jahrhundert blieb das Problem der Entfernungsmessung zur See in Ost-West Richtung ungelöst. Tatsächlich war man nicht imstande, die Entfernung zwischen Europa/Afrika und dem amerikanischen Doppelkontinent, bzw. zwischen diesem und Asien genau zu messen. So gab es zwar theoretisch die Möglichkeit, den Globus in seiner Gesamtheit mehr oder weniger maßstabsgetreu nachzubilden und nach der Erfindung der Mercator-Projektion konnte man die Darstellung auch auf die Zweidimensionalität von Karten übertragen, die Entfernungsangaben blieben jedoch ungenau.
9
Im Zentrum dieses Artikels steht die Frage nach der politischen Funktion frühneuzeitlicher Kartographie. War die Kartographie wichtig(st)es Kommunikationsmedium für Herrschaft außerhalb Europas? Was konnte auf Karten dargestellt werden, von wem und in welcher Absicht? Änderten sich Darstellungsweisen mit den politischen Veränderungen in Europa, insofern sie überseeische Gebiete betrafen? Zu denken wäre hier beispielsweise an die spanisch-portugiesische Thronunion oder den Unabhängigkeitskampf der Niederländer.
Die zur europäischen Expansion parallel laufende Entwicklung des Buchdrucks erleichterte die Kommunikation über die neu entdeckten Gebiete und fügte den herkömmlichen Medien – Manuskriptkarten – weitere Techniken und Verbreitungsmöglichkeiten hinzu. War man sich über Verbreitung und Wirkungsbereich der unterschiedlichen Medien bewusst und nutzte diese gemäß der zu übermittelnden Inhalte, natürlich auch in Abhängigkeit der Informationsübertragung zwischen den einzelnen Kartenherstellern? In wie weit war diese steuerbar? Lässt sich überhaupt so etwas wie eine durchgängige Politik hinsichtlich der Verbreitung geographischen Wissens feststellen oder hing diese doch eher von informellen Kanälen ab?
Die frühneuzeitliche Kartographie und deren Urheber wurden bis dato vor allem auf den Zusammenhang bestimmter gestalterischen Schulen untersucht, auf Informationsflüsse anhand der Verarbeitung bestimmter Erkenntnisse und technischer Fortschritte etc. Eine Untersuchung der politischen Funktion der Kartographie existiert allenfalls hinsichtlich einzelner Akteure. Allerdings ist für die Jahre nach 1500 eine ungeheure Fülle von Kartenmaterial überliefert, dessen Zuschreibung zu bestimmten Kartographen (und damit zu ihrer eventuellen politischen Funktion) noch aussteht bzw. nicht mehr mit Sicherheit vorgenommen werden kann.
Durch diese beiden Umstände muss der vorliegende Artikel fast zwangsläufig fragmentarisch bleiben und wird mehr Fragen aufwerfen als er beantwortet. Keinesfalls konnten alle noch existierenden Karten des Entdeckungszeitalters gesichtet werden, denn diese werden in verschiedenen Archiven weltweit aufbewahrt, auch wenn es inzwischen schon zahlreiche gute (Faksimile-)sammlungen gibt. Auch im Internet lassen sich, wie der Leser feststellen wird, zahlreiche Abbildungen frühneuzeitlicher Karten verschiedener Provenienz finden. Angesichts der Fülle des Materials umspannt die Untersuchung lediglich den Zeitraum von den Entdeckungen ab 1492 bis etwa zur Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das bietet die Möglichkeit, die angedeuteten Problemfelder beispielsweise an den Auseinandersetzungen zwischen Spanien und Portugal oder zwischen den iberischen Mächten und nordwesteuropäischen Mitbewerbern um koloniale Besitztümer vergleichsweise tiefgehend zu untersuchen. Freilich müssen in dem skizzierten Zusammenhang ebenso interessante Themenfelder wie z.B. die Auseinandersetzungen der Nordwesteuropäer untereinander ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts oder die Kartierung der USA und die daraus resultierenden Grenzstreitigkeiten mit dem spanischen Machtbereich außer Acht bleiben.
Für diesen Artikel wurde zunächst einmal die umfängliche Sammlung portugiesischer Kartographen Portvgaliae monvmenta cartographica gesichtet [8]. Nicht nur die portugiesische Vorreiterrolle legte diese Auswahl nahe, sondern auch die Indienstnahme zahlreicher portugiesischer Kartographen durch Spanien, so dass ein wichtiges Feld der Auseinandersetzung, nämlich das zwischen beiden iberischen Monarchien abgedeckt werden konnte. Ergänzt wurden die Quellen durch die bekannte Nebenzahl-Sammlung[9], Wolffs Band zum Amerikabild[10], der auch zahlreiche Druckwerke aus dem Reich mit einbezieht, die Veröffentlichungen zu den Kartensammlungen in den Staatsbibliotheken in München und Dresden[11] sowie einige Abbildungen verschiedener Karten in weniger spezifischen Bildbänden und Webseiten.
10
a) Geheimnisvolles Afrika oder Kartographiepolitik im 15. Jahrhundert
Immer wieder ist von der Wissenschaft die Frage gestellt worden, in wie weit die für die Schifffahrt bereitgestellte Kartographie des Entdeckungszeitalters der Geheimhaltung unterlag. Dafür müssen vor allem die handgezeichneten so genannten Portolankarten untersucht werden, in die alle für die Seefahrer wichtigen Informationen eingetragen wurden[12]. Dieses geographische Wissen trug zum Erfolg der Seefahrt bei, sicherte Handelspositionen und militärische Wirksamkeit.
In Europa lagen im 14. und 15. Jahrhundert die Zentren für Seefahrt und nautisches Wissen in den italienischen Stadtstaaten und auf Mallorca. Die meisten der dort entstandenen Portolankarten enthielten relativ genaue Angaben über den Mittelmeerraum[13]. Nur die Darstellung Afrikas endete oft auf der Höhe von Kap Bojador, also ungefähr an dem Punkt, südlich dessen Portugal die Gebiete für sich allein beanspruchte, obwohl portugiesische Seefahrer bereits 1460 bis Elmina an der Goldküste vorgedrungen waren. Selbst die auf Bestellung König Alfons V. von dem Venezianer Fra Mauro 1459 gefertigte Karte, die ganz Afrika zeigte und prophetisch einen Seeweg zur Umrundung des Kontinents verzeichnete, weist rätselhafte Lücken auf. Obwohl die Portugiesen den Kartographen angeblich mit den aktuellsten Informationen versorgt hatten, fehlen auf der Karte die Azoren, weder der Verlauf der afrikanischen Westküste noch ihre Beschriftung entsprechen dem damaligen Kenntnisstand[14]. Zwar gibt es einige Ausnahmen wie die Karten der Venezianer Grazioso Benincasa und Christoforo Soligo aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts oder des Mallorquiners Jaume Bertran von 1482, die Afrika bis weit über die Kapverden hinaus verzeichneten ebenso wie die so genannte Kolumbuskarte[15], die den Verlauf der afrikanischen Westküste bis zur Kongomündung zeigt, doch ist auffallend, dass auf von portugiesischen Kartographen signierten Portolankarten des 15. Jahrhunderts die Darstellung Afrikas weiter nördlich endet als auf anonymen portugiesischen oder den erwähnten nicht-portugiesischen Karten. Darüber hinaus sind ohnehin kaum portugiesische Portolankarten des 14. und 15. Jahrhundert überliefert worden[16]. Natürlich waren die Karten zunächst einmal Gebrauchsgegenstände, die sich abnutzten, so dass ihre Überlieferung dem Zahn der Zeit zum Opfer fiel. Erstaunlich ist aber das Fehlen portugiesischer Repräsentationskarten aus der Zeit, die auf der Grundlage des Padrão Real, jener Musterkarte, die in der jeweiligen Seefahrerbehörde[17] aufbewahrt und ergänzt wurde, erstellt worden wäre wie es aus späteren Zeiten bekannt ist. Noch 1504 verbot ein portugiesischer, königlicher Erlass die Herstellung von Globen und untersagte auf Seefahrerkarten die Wiedergabe Westafrikas unterhalb der Kongomündung[18]. Möglicherweise existierte der Wunsch der königlichen Verwaltung, die Preisgabe der neuesten geographischen Erkenntnisse zu kontrollieren. Ein lückenlos durchsetzbares portugiesisches „Geheimhaltungssystem“ für das 15. Jahrhundert erscheint jedoch kaum vorstellbar[19].
Karten funktionierten im Entdeckungszeitalter also nicht ausschließlich oder vornehmlich als neutrale oder wertfreie Darstellungen der Wirklichkeit. Sie sammelten Herrschaftswissen im Sinne Foucaults und das Verheimlichen kartographischer Daten bzw. die Verhinderung ihrer Verbreitung konnte der Sicherung von Herrschaft dienen[20]. Dieser Zusammenhang erfuhr eine ernsthafte Erschütterung in dem Moment, als Karten nicht mehr allein der Speicherung von Wissen zum Zwecke von Machterhalt oder Machtmehrung eines Souveräns dienten, sondern zu Medien avancierten, die Machtansprüche sichtbar machen sollten; zum einen gegenüber anderen Souveränen, zum anderen gegenüber einer wie auch immer gearteten europäischen Öffentlichkeit.
11
b) Die Entdeckung Amerikas als Medienereignis
Von Anfang an war die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, natürlich auch aufgrund des kurz zuvor erfundenen Buchdrucks, ein europäisches Medienereignis. In diesem Zusammenhang ist es auch nebensächlich, ob, wie später immer wieder behauptet wurde, das südamerikanische Festland, von portugiesischen Seefahrern schon vor Kolumbus entdeckt wurde oder ob, wie es wahrscheinlich ist, englische, bretonische und portugiesische Seefahrer bereits seit den 1480ern vor Neufundland Fischfang betrieben und dort die Küste des nordamerikanischen Festlandes erkundeten[21]: es waren die Spanier, die sich ihre neuen Entdeckungen über eine päpstliche Bulle und einen bilateralen Vertrag mit Portugal völkerrechtlich anerkennen ließen und über ein weit gespanntes Nachrichtennetz die neuen Entdeckungen bekannt machten und für sich beanspruchten. Erst die erfolgreiche spanische Nachrichtenpolitik führte zu einem Umdenken in Lissabon und rief eine offensivere Propaganda auch seitens der portugiesischen Administration hervor. Dabei existierte ein auffälliger Unterschied in der Wahl der Medien zwischen der von Lissabon und der von dem spanischen Hof ausgehenden Übermittlung von Nachrichten über die neu entdeckten Gebiete. Während die Verbreitung gedruckter Informationen über die erste Expedition des Kolumbus von Spanien ausgehend bereits 1493 einsetzte[22], sind aus den ersten Jahren der offiziellen portugiesischen Amerikafahrten keine gedruckten Nachrichten erhalten. Lissabon emittierte bis 1504 ausschließlich handschriftliche Nachrichten über kaufmännische und diplomatische Netzwerke. Das Reich mit seinen Zentren des frühmodernen Buchdrucks erreichten sie meist über den Umweg Italien[23]. So kann davon ausgegangen werden, dass die Benennung der Neuen Welt nach Amerigo Vespucci durch Matthias Ringmann und Martin Waldseemüller [24] letztlich auf eine propagandistische Initiative der Portugiesen zurückgeht, die für die Publikation des fiktiven Reiseberichtes Vespuccis im Reich sorgten, um ihren Anteil bei der Entdeckung Amerikas zu unterstreichen[25]. Möglicherweise weist die Entscheidung Waldseemüllers, Amerika als eigenständigen Kontinent, ohne Landverbindung zu Asien zu verzeichnen, lange bevor Balboa und Magellan den Pazifik erreicht hatten, in dieselbe Richtung[26]. Die Rücknahme dieser Einschätzung in seiner ›Carta Marina‹ von 1516, der Umstand, dass die Druckstöcke seiner Karte ›Terre Novae‹ von 1513, die ebenfalls keine Westküste des amerikanischen Doppelkontinents verzeichnen, bereits 1506/07 fertig gestellt waren[27] und das spätere Hervorheben der Leistungen Kolumbus für die Entdeckung Amerikas spricht ebenfalls für die Entstehung der Karten im Spannungsfeld portugiesischer und spanischer Propaganda. Zwar lassen sich die Einflüsse nicht mehr genau nachvollziehen, doch gilt es zu bedenken, dass es in spanischem Interesse lag, auf die Westküste Asiens gestoßen zu sein, während die Portugiesen nach der Entdeckung eines Seewegs nach Asien über Afrika zum Aufbau und zur Sicherung der asiatischen Handelsmonopole eher daran interessiert waren, dass es sich bei den Entdeckungen im Westen um einen eigenständigen Kontinent handelte[28].
12
Natürlich widerspricht eine vermutete portugiesische Propagandaoffensive zum Teil der weiter oben erwähnten Geheimhaltungspolitik, doch lässt sich für die ersten Jahre nach 1492 eine wenig kohärente Politik im Spannungsfeld zwischen den Anforderungen des Wissensvorsprungs durch Geheimhaltung und jenen der Durchsetzung eigener Ansprüche durch Veröffentlichung annehmen und, wenn auch anhand des vorhandenen Kartenmaterials nur bedingt, nachvollziehen.
Jedenfalls setzte die überregionale Verbreitung kartographischen Materials von Spanien aus ein, als die dritte Kolumbusexpedition Festland erreicht hatte. Nach den Entdeckungen der Corte Reals und der Expedition Gonçalo Coelhos an die brasilianische Küste begannen die Portugiesen ihre Sicht der Dinge auf Manuskriptkarten, die in ganz Europa verbreitet wurden, darzustellen[29]. Auffällig ist nach wie vor die nur rudimentäre Darstellung Afrikas auf diesen frühen Karten bis etwa 1510 bzw. der oft gewählte Kartenausschnitt, der Afrika auf Höhe der Kanaren enden lässt[30]. Die von Spanien entdeckten Karibikinseln verschwiegen die Karten zum Teil völlig[31].
Weder in Portugal noch in Spanien wurden Karten über die Neue Welt gedruckt, denn in beiden Ländern war man sich der Vorläufigkeit des Wissens um die neu entdeckten Gebiete bewusst. Die vor allem in Italien und im Reich nördlich der Alpen gedruckten Karten wurden, neben den theoretischen Überlegungen aus St. Die, sowohl von portugiesischen als auch spanischen Quellen beeinflusst[32].
In Spanien kannte man ohnehin kaum Zurückhaltung in der Veröffentlichung und Verbreitung kartographischer Kenntnisse. 1512 regelte die Kastilische Krone den Verkauf von Kopien des offiziellen Padrón Real, nicht um seine Verbreitung zu verhindern, sondern um die finanziellen Nutznießer an diesem Geschäft festzulegen[33].
Doch die Kartographie drehte sich nicht allein um Politik. Die in die Auseinandersetzung um die Entdeckungen kaum involvierten Humanisten und Kartographen aus den nördlichen Reichsgebieten waren stärker an der Lösung der im Zusammenhang mit der Kartographie auftretenden technischen Probleme interessiert als an politischen Fragen. Wichtig erschienen die Vervollständigung des Weltbildes und die Projektion der Erdkugel auf ein zweidimensionales Medium. Die Verarbeitung der jeweils neuesten geographischen Erkenntnisse trat dagegen ein wenig in den Hintergrund. So fand Mercator für seine Weltkarte 1569 zwar einen Projektionsmodus, zeigte aber wesentlich ungenauere Umrisse Südamerikas als beispielsweise die Weltkarte Desceliers aus der Diepper Schule von 1550[34].
13
Insgesamt können zwei Ströme der Verbreitung kartographischer Kenntnisse ausgemacht werden, die sich zwar gegenseitig beeinflussten und befruchteten, denen jedoch unterschiedliche Motivationen zugrunde lagen. In den Zentren des Buchdrucks nördlich der Alpen stützte man sich zwar auf handschriftliche Vorlagen und Informationen von der Iberischen Halbinsel, die Intention der Kartographie lag jedoch in einem humanistischen Interesse an der Erneuerung und Vervollständigung des Weltbildes. Die neuesten, aus den letzten Entdeckungsfahrten resultierenden, geographischen Erkenntnisse schlugen sich erst mit einiger Zeitverzögerung in den Karten nieder, natürlich auch in Abhängigkeit der verwendeten Technik. Seit 1507 bevorzugte man nördlich der Alpen Holzschnitte und tradierte bis Mitte des 16. Jahrhunderts die Ideen Waldseemüllers. Auch in Venedig und anderen italienischen Städten wurden Holzschnitte gefertigt, die Italiener hatten aber während der Regierungszeit Karls V. engere Verbindungen zur Iberischen Halbinsel, so dass die italienischen Karten genauere geographische Informationen enthielten. Bis in die 1560er lag außerdem das Zentrum der Herstellung von Kupferstichkarten in Venedig, bevor diese Technik, als sich der spanische Seehandel vom Mittelmeerraum in den Atlantik verlagerte, in Antwerpen adaptiert wurde und sich von dort aus nach Amsterdam verlagerte.
Ein anderer Verbreitungsstrom kartographischer Kenntnisse verlief parallel zum politischen Interesse an den neuen Entdeckungen. Aufbauend auf der kartographischen Tradition des Mittelmeers nahm diese Strömung ihren Ausgang in Portugal, um an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert ein weiteres Zentrum in Sevilla zu finden. Die Informationsübertragung fand, soweit bekannt, mittels Manuskriptkarten statt, die von hier aus nach ganz Europa versandt wurden ebenso wie aus Venedig und Genua, wo sich weitere Zentren der Herstellung handgemalter Portolankarten befanden[35]. Ob in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Markt für teure handgemalte Manuskriptkarten zusammenbrach[36] oder ob sich die Produktion und Verbreitung nur weiter diversifizierten, wovon zahlreiche von portugiesischen Kartographen in Indien erstellte Portolankarten und -atlanten zeugen, sei einmal dahingestellt[37]. Jedenfalls entwickelte sich parallel zu den Expeditionen französischer Seefahrer in den atlantischen Raum und den verschärften Auseinandersetzungen zwischen dem Haus Habsburg und dem französischen König, die man auch über Angriffe auf Überseeterritorien austrug, die Diepper Kartographenschule. Über drei Jahrzehnte produzierte man in Dieppe und Umgebung handgemalte Karten, die nicht nur als erste die Entdeckungen Cartiers in Nordamerika verarbeiteten, sondern die, für wohlhabende und mächtige Auftraggeber erstellt, außerdem französische Ansprüche und Leistungen transportierten[38].
Vor allem während der spanisch-portugiesischen Thronunion scheint sich der Austausch, trotz des niederländischen Befreiungskampfes gegen die spanischen Habsburger, zwischen portugiesischen und niederländischen Kartographen bzw. Druckern erleichtert zu haben. So griff beispielsweise Petrus Plancius für die Erstellung seiner Karten und Planisphären auf Vorlagen Bartolomeu Lassos zurück, die ihm genauer erschienen als die Mercatorkarten. Mit diesen Karten segelten die Niederländer in ihnen unbekannte Gebiete[39]. Damit wurden auch die über Manuskriptkarten tradierten Erkenntnisse mit den in den oberdeutschen Zentren des Druckereiwesens entwickelten Techniken weiter in Übereinstimmung gebracht als die Jahrzehnte zuvor. Für eine Geheimhaltungspolitik seitens der spanischen Administration, die ja auch über portugiesische Kartographen zu bestimmen hatte, lassen sich trotz der Konkurrenzsituation in Übersee keine Hinweise finden.
Ihre wiedererlangte Unabhängigkeit begleiteten die Portugiesen mit einer kartographischen Propagandaoffensive. Von dem von João Teixeira I. 1640 gefertigten Brasilien-Atlas sind noch heute sieben Exemplare vorhanden, ein Zeichen für die große Auflage des Werkes. Auf 31 bzw. 32 Karten verzeichnete Teixeira nicht nur alle den Holländern wieder abgenommenen Forts und Häfen, kartographisch weitete er die Grenzen Brasiliens auf das Gebiet zwischen dem Rio de la Plata und dem Flüsschen Vicente Pinzon, westlich des Amazonas[40].
14
Bereits vor der Entdeckung Amerikas war es zwischen beiden iberischen Mächten zu Streitigkeiten um den Rechtstitel auf den Besitz der kanarischen Inseln gekommen. Doch zunächst blieb der spanische Ausgriff auf die Kanaren eine in sich abgeschlossene Aktion, so dass beide Mächte ihre Entdeckungen und Missionsgebiete zwar über päpstliche Bullen absegnen ließen[41], daraus aber kaum eine völkerrechtlich endgültige Anerkennung eines exklusiven Schifffahrts- und Eroberungsrechts abgeleitet werden kann. Denn trotz unbestrittener religiöser Autorität des Papstes, blieb seine weltliche Macht zumindest umstritten. Solange päpstliche Bullen nicht über zwischenstaatliche Verträge bestätigt wurden, mögen sie als vom Papst unterstützte Ansprüche interpretiert worden sein, völkerrechtlich bindend waren sie noch nicht. So muss der seitens anderer europäischer Mächte relativ wenig in Frage gestellte portugiesische Ausgriff nach Afrika (und im Anschluss daran nach Indien) eher mit dem navigatorischen Unvermögen der Resteuropäer erklärt werden als mit einem tatsächlichen Einverständnis in die Monopolansprüche der Portugiesen. Solange keine andere Macht in der Lage war, diese Ansprüche ernsthaft zu gefährden, wurden die päpstlichen Bullen stillschweigend hingenommen und Portugal vermied es, diese Ansprüche, de facto wenig gefährdet, zum Thema zwischenstaatlicher Politik zu machen. Denn man war sich bewusst, dass eine völkerrechtliche Festschreibung der Ansprüche für alle Zukunft kaum zu erreichen sein würde[42]. So kam es erst 1479 im Vertrag von Alcaçovas zwischen Spanien und Portugal zu einer zwischenstaatlichen, völkerrechtlich bindenden Vereinbarung über Herrschaftsansprüche über außereuropäische Gebiete. Freilich begründete diese Abmachung nicht nur eine Tradition, an der sich das europäische Völkerrecht hinsichtlich der zukünftig neu entdeckten Gebiete orientieren sollte, gleichzeitig schuf diese Abmachung Verwirrung bzw. blieb hinsichtlich der geographisch den portugiesischen Ansprüchen unterworfenen Gebiete ungenau. Denn wo es in besagtem Vertrag noch hieß: „De las yslas de la Canaria para baxo contra Guinea“[43], also „Von den Kanarischen Inseln an gegen Guinea“, ließen sich die Portugiesen diesen Passus in der zwei Jahre später zur Bestätigung des Vertrages wiederum vom Papst veröffentlichten Bulle in die Worte „Ab insulis de Canaria ultra et circa et in conspectu Guinee“ übersetzen, zu deutsch: „Von den Kanarischen Inseln an diesseits und jenseits und im Gebiet von Guinea“[44]. Ob Übersetzungsfehler oder eine absichtlich vorgenommene Verdrehung, die Zuschreibung blieb umstritten und das wurde natürlich vor allem dann virulent als man tatsächlich das Kap der Guten Hoffnung nach Osten umschifft, nach Westen Amerika entdeckt und mit der Expedition Magellans 1521 erstmals die Welt gänzlich umrundet hatte. Denn jetzt fehlte eine Abgrenzung der Sphären im Osten.
Doch die Formulierung verweist auf ein weiteres Problem: Guinea war kein geographisch fest umrissener Begriff. Er bezeichnete die Westküste Afrikas, nach Norden vielleicht noch durch Kap Bojador begrenzt, nach Süden auf jeden Fall völlig unbestimmt. Auf Karten des 15. Jahrhunderts, so sie denn Afrika überhaupt südlich von Kap Bojador zeigten, findet sich Guinea als Begriff so gut wie nicht verzeichnet[45]. So überrascht es auch kaum, dass überhaupt keine frühneuzeitliche Karte bekannt ist, die die völkerrechtliche Linie des Vertrags von Alcaçovas ausweist.
15
Nach der Entdeckung Amerikas griffen die iberischen Mächte auf das Instrument der Teilung durch eine Linie zurück. Bekanntermaßen wurden bereits 1493 Spaniern und Portugiesen durch die päpstliche Bulle Inter caetera verschiedene Einflusssphären zugewiesen. Da diese päpstliche Teilung, wie bereits erwähnt, für eine völkerrechtliche Anerkennung der Besitztitel nicht ausreichte, beschlossen Spanien und Portugal 1494 im Vertrag von Tordesillas eine längs durch den Atlantik verlaufende Linie, welche die Einflusssphären beider Mächte voneinander abgrenzen sollte. Zu diesem Zeitpunkt war weder die Ostküste Brasiliens offiziell entdeckt noch Neufundland oder Labrador. Erstaunlicher und für die Kartographie weit reichender aber ist, dass es noch nicht möglich war, zur See den Abstand der Längengrade zu messen. Über das Astrolabium und den Polarstern ließ sich zwar die Position gen Norden oder Süden relativ genau bestimmen, hinsichtlich der Position nach Westen oder Osten herrschte jedoch große Unsicherheit.
Wenn man dieses Problem berücksichtigt, wird die Absurdität der verschiedenen Abgrenzungslinien ziemlich klar: Ein Vertrag mit der Vereinbarung einer imaginären Linie, deren Endpunkte nicht auf Landmassen lagen, sondern die vereinbart worden war mit den Worten „370 leguas westlich der Kapverden“ war eine Sache, die völkerrechtliche Umsetzung dieser Linie (und sei es nur zwischen Spanien und Portugal) eine völlig andere.
16
3. Die Linien und die Kartographie
Bedenkt man die Schwierigkeiten bei der Messung von Entfernungen und die Tatsache, dass der Vertrag von Tordesillas Gebiete verteilte, deren geographische Lage und Gegebenheiten in Europa nicht bekannt waren, wird deutlich, welch große Rolle die Kartographie dabei spielte, Gebiete zu beanspruchen. Lediglich Karten und Atlanten boten die Möglichkeit, Einflusssphären und Besitzansprüche zu visualisieren, denn das Meer konnte nicht markiert werden, und die Zugehörigkeit der Landmassen blieb umstritten, auch wenn der Vertrag vereinbarte, eine gemeinsame Kommission nach Westen fahren zu lassen, um die Linie zu vermessen, einzutragen und gegebenenfalls an Land Grenztürme zu erbauen. In welcher Form die Linie zu verzeichnen sei, darüber schwieg sich der Vertrag aus, ebenso wie er es den Kommissionsmitgliedern überließ, sich darauf zu einigen, in welcher Form die Entfernung gemessen werden sollte[46]. Dazu kam, dass man die zu messende Entfernung in Leguas angab, diese aber in Spanien und Portugal verschiedene Maße hatten. Die Unsicherheit über den Erdumfang verhinderte wiederum die genaue Bemessung der Abstände zwischen den Längengraden. Es überrascht daher kaum, dass die vereinbarte Kommission nicht zustande kam und zunächst jedes Land für sich versuchte, die Linie festzulegen.
Die kartographische Darstellung konnte natürlich die mit der fehlerhaften Entfernungsmessung und dem unterschiedlich angenommenen Erdumfang einhergehenden Probleme auch nicht lösen. Dazu kamen – ob vorsätzlich oder nicht – bis weit nach der Erfindung der Mercator-Projektion die aufgrund der Erdkrümmung falsch eingetragenen Landmassen.
Die ersten überlieferten Karten, die Amerika überhaupt zeigen, veranschaulichen nicht nur die technische Problematik, sondern auch die dahinter liegende politische Intention. Der von dem kantabrischen Seemann und Kartographen, Juan de la Cosa, der Kolumbus auf zwei Reisen begleitet hatte sowie Ojeda und Americo Vespucci bei ihrer Erkundung des amerikanischen Festlandes, nutzte in seiner Karte von 1500[47] für Amerika und Europa/Afrika zwei unterschiedliche Maßstäbe, und obwohl sich damit der Abstand zwischen beiden Kontinentalmassen zeichnerisch verkürzt, wurde die Linie sehr weit östlich eingetragen. Sie streift kaum das südamerikanische Festland[48]. Da man weiß, dass de la Cosa von den Katholischen Königen 1503 beauftragt wurde, in Portugal wegen der portugiesischen Seefahrt westlich der Linie zu intervenieren und im selben Jahr als Lohnempfänger der Casa de la Contratación auftaucht, kann man davon ausgehen, dass die Karte im Auftrag der spanischen Könige erstellt wurde (oder um ihnen die Neuentdeckungen vor Augen zu führen) und bezüglich der Linie die spanische Sicht der Dinge wiedergibt [49]. Um ganz sicher zu gehen, schrieb de la Cosa die Entdeckung der östlichsten von ihm eingezeichneten Landmasse Südamerikas dem Spanier Pinzón zu, während er den Portugiesen lediglich eine relativ kleine, mitten im Atlantik gelegene Insel überließ[50]. Interessanterweise ist de la Cosa weniger besitzergreifend gegenüber englischen Entdeckungen. Die Ostküste Nordamerikas zeigt nicht nur mehrere englische Fähnchen, sondern trägt auch die Aufschrift „mar descubierto por Ingleses“[51]. Möglicherweise empfand man in Spanien die Entdeckungsfahrten der Engländer noch nicht als starke Konkurrenz.
17
Vergleicht man mit der Cosa-Karte die 1502 entstandene, so genannte Cantino-Planisphäre, tritt der kartographische Gegenentwurf der portugiesischen Sicht der Dinge deutlich vor Augen. Auch wenn die Karte auf Geheiß Alberto Cantinos, des Botschafters des Herzogs von Ferrara illegal außer Landes geschmuggelt wurde und man ihren Urheber nicht kennt, ist doch davon auszugehen, dass sie nach Vorlage des offiziellen padrão real gefertigt worden ist. Sie zeigt nicht nur die Tordesillaslinie sehr prominent mit der Aufschrift „este he o marco dentre Castelha t Portugal“, sondern legt auch weite Teile Südamerikas und das von portugiesischen Seefahrern entdeckte Neufundland oder Labrador östlich der Linie. Die Legende beschreibt ausführlich von wem und in wessen Namen die jeweiligen Gebiete entdeckt und in Besitz genommen wurden[52]. Die englischen Entdeckungen sind dem Kartographen unbekannt oder er verschweigt sie ebenso wie die Fahrt Pinzons an die Nordostküste Brasiliens.
Das Herausstreichen der Leistungen der jeweiligen Krone bei der Entdeckung und Erkundung der Neuen Welt von jeweils im Dienste dieser Krone stehenden Kartographen ist nicht allzu verwunderlich. Interessanter ist die Frage danach, welche der beiden Versionen weitere Verbreitung fand bzw. welche Version sich durchsetzte.
Doch zunächst einmal sahen sich die Kartographen mit einem weiteren Problem konfrontiert. Magellan ließ sich 1519 wahrscheinlich von Pedro und Jorge Reinel in Sevilla eine Karte fertigen, mit der er bei Karl V. dafür warb, über den Westweg nach Asien zu segeln. Die Karte zeigt die Gewürzinseln oder Molukken, mit welchen Handelsverbindungen anzuknüpfen vornehmstes Ziel Magellans war, in spanischem Gebiet im Westen hinter der Tordesillaslinie [53]. Zumindest Pedro Reinel, der Vater Jorges, stand zu diesem Zeitpunkt in Diensten des portugiesischen Königs und weilte nur in Sevilla, um seinen Sohn, der aufgrund einer Auseinandersetzung von Lissabon geflohen war, zurückzuholen. Vor der Rückkehr half er seinem Sohn die Karte – wahrscheinlich die erste spanische Karte, welche die Molukken überhaupt zeigt – zu vollenden[54].
18
Als man dann erfuhr, dass die Expedition Magellans den amerikanischen Kontinent umrundet hatte und auf dem Westweg die Gewürzinseln ansteuerte, um von Osten aus nach Europa zurückzukehren, wurde die Zugehörigkeit der Molukken, wo die Portugiesen bereits einen Handelsposten installiert hatten, zum Zankapfel zwischen beiden iberischen Mächten. An den Kartographen lag es nun, die Demarkationslinie über die beiden Pole hinaus zu verlängern und zu beweisen, dass die Gewürzinseln in portugiesischem oder spanischem Einflussgebiet lagen. In seiner Polprojektion kam wahrscheinlich wieder Pedro Reinel zu dem Schluss, dass die über die Pole verlängerte Linie mitten durch die Inselgruppen der Molukken verläuft, wobei ein Großteil der Inseln in der portugiesischen Zone zu liegen kommt – ebenso wie das portugiesische Gebiet Südamerikas im Süden bereits bis an die Rio de la Plata Mündung reicht[55]. Wahrscheinlich wurde diese Karte bereits vor der Rückkehr der Magellan-Expedition gezeichnet, so dass die Lage der Molukken allein durch die Fahrten der Portugiesen bekannt war. Pedro Reinel trat, je nach Auftrag, mit sich selbst in Widerstreit, denn beiden Karten lagen dieselben geographischen Erkenntnisse zugrunde. Darüber hinaus verhandelte Pedro Reinel für Portugal auf den 1524 einberufenen Verhandlungen in Badajoz und Elvas, die die Molukkenfrage klären sollten[56].
Für diese Konferenz fertigte Juan de Vespucci[57] für Spanien ebenfalls eine Karte in Polprojektion, auf der die Molukken eindeutig östlich des 135. Längengrades, der die Verlängerung des die Tordesillaslinie bezeichnenden 315. Längengrades darstellte, zu liegen kamen. Es ist kaum verwunderlich, dass man sich auf dieser Konferenz nicht einigen konnte, obwohl vor allem die Spanier noch einige Karten fertigen ließen, die ihre Ansprüche auch bei Dritten unterstreichen sollten[58]. Letztlich konnte man sich erst fünf Jahre später, nach vergeblichen spanischen Versuchen, über die Magellanstraße eine Handelsroute mit dem Westpazifik zu installieren, und gegen eine portugiesische Entschädigungszahlung in Höhe von 35.000 Dukaten in Saragossa auf eine Abgrenzung im Osten einigen. Die Demarkation dieser Linie scheint einfacher gewesen zu sein bzw. weniger politisch umstritten, denn man legte sie durch bestimmte Inseln gehend fest. In Folge des Vertrages sollte die Linie von jeweils zwei Kartographen auf den Vorlagekarten der Seefahrerbehörden eingetragen werden und selbst für den Fall, dass sich mit der Zeit die Molukken als weiter östlich liegend als angenommen entpuppen sollten, veränderte das nichts an der Einflusszone des portugiesischen Königs, denn die Linie wurde in Bezug auf die Inselgruppe selbst definiert[59]. Diese so genannte Saragossa-Linie tauchte danach ohnehin nur noch selten auf einigen portugiesischen Karten auf[60]. Weder die Drucker und Kartographen im Reich, noch die Spanier, die wohl wenig an ihrer Darstellung interessiert waren, nachdem sie angefangen hatten, die Philippinen zu kolonialisieren, welche gemäß des Vertrages in portugiesischem Hoheitsgebiet lagen, schenkten dieser Linie allzu große Aufmerksamkeit.
19
Politisch umstrittener blieb die Abgrenzung im Westen. Umso erstaunlicher ist, dass sich auf der Iberischen Halbinsel zunächst kartographisch die portugiesische Version durchgesetzt zu haben scheint. Sowohl die bereits erwähnte Castiglioni-Karte, als auch die von 1525 von Nuño García de Torrenos gefertigte Karte[61], die beide im Kontext des spanischen Werbens für die eigenen Interessen entstanden, oder eine unvollendet gebliebene Karte von Diego Ribeiro aus dem Jahr 1532[62] zeigen die Linie zwischen der Rio de la Plata Mündung im Süden und westlich der Maranhão Mündung im Norden. Erst gegen Mitte des Jahrhunderts ruderten die in spanischen Diensten stehenden Kartographen zurück und verschoben die Grenze zwischen dem spanischen und portugiesischen Amerika nach Osten[63]. Beinahe alle Kartographen ließen Teile Nordamerikas, seien es Neufundland, Labrador oder nicht eindeutig identifizierbare Landmassen in Nachfolge der Cantino-Karte in das Einflussgebiet der Portugiesen fallen, obwohl in Wirklichkeit kein Teil der Ostküste Nordamerikas östlich der Tordesillas-Linie zu liegen kommt. Tatsächlich begriffen wohl sowohl Portugiesen und Spanier als auch die Engländer, welche Fischerei- und Siedlungsgebiete vor und auf Neufundland aufgrund der Entdeckungen John Cabots unter dem Privileg der englischen Krone geltend machten, das östlichste Eiland Nordamerikas als gemäß dem Tordesillasvertrag zu Portugal gehörig. Zumindest findet sich das Thema in den bilateralen Verhandlungen zwischen Portugal und England im 16. und 17. Jahrhundert, ohne dass Spanien dagegen protestiert hätte[64].
Die wohl interessantesten Darstellungen der Tordesillas Linie befinden sich in einem von Luis Teixeira[65] 1630 gezeichneten Atlas. Hier wurde die Linie in zwei unterschiedlichen Karten eingetragen. Auf der Weltkarte verläuft die Linie von Süd nach Nord durch den Rio de la Plata, östlich des Amazonas, durch Labrador und westlich von Neufundland. Eine weitere Karte zeigt nur den Südatlantik zwischen Afrika und Südamerika. Die Linie liegt weit östlich des Rio de la Plata und nur ein kleiner Teil Brasiliens kommt östlich der Linie zu liegen. Wenngleich im Titel der Karte auf Projektionsprobleme hingewiesen wird[66], muss den Zeitgenossen die politische Brisanz durchaus bewusst gewesen sein. Noch während der Thronunion wahrscheinlich auch spanischen Seefahrern bekannt, versuchten die Portugiesen, den Atlas nach 1640 geheim zu halten. Zwar existieren in der British Library in London skizzenhafte Kopien dieser Karten unbekannten Datums, doch entwendete 1681 im Zuge erneuter spanisch-portugiesischer Verhandlungen um die Festlegung der Grenzen in Brasilien „Capitan Don fran.co de Seixas y Louera por yntelixencias y dinero“ den Atlas aus dem königlichen Archiv Lissabons, um ihn einige Jahre später dem Indienrat zu übergeben [67]. Mit der Gründung der Colônia do Sacramento im heutigen Uruguay im Jahr 1680 hatte die Auseinandersetzung an Schärfe gewonnen und das militärische Vorgehen in Amerika wurde in Europa mit diplomatischen Verhandlungen begleitet. Derartige Karten aus dem gegnerischen Lager konnten da enorme Schützenhilfe leisten[68]. Die Karte, die von der portugiesischen Abordnung 1682 auf dem Kongress von Badajoz benutzt worden war, stammte von João Teixeira Albernaz II, der seit ca. 1666 die Grenze zwischen dem Südufer des Rio de la Plata und der Mündung des Flüsschens Vincente Pinzon westlich des Amazonas verlaufen ließ [69]. Warum von den spanischen Diplomaten der bereits ein Jahr zuvor entwendete Atlas von João Teixeira I nicht für die Konferenz benutzt wurde, ist unbekannt.
20
Untersucht man die Informationsübertragung bezüglich der politischen Verhältnisse in andere europäische Länder, sticht die Parallelität zwischen politischer Spanien-Feindlichkeit und kartographischer Verkleinerung der Spanisch-Amerikanischen Gebiete ins Auge. Obwohl sich im Reich, wie bereits erwähnt, die geographischen Vorstellungen aus portugiesischen Quellen speisten, übertrugen sich die politischen Vorstellungen der Portugiesen kaum auf die mitteleuropäischen Kartographen. Zwar vermieden die meisten Urheber gedruckter Karten das Einzeichnen der Linie(n) und markierten die Zugehörigkeiten allenfalls mittels Fähnchen, doch dort, wo Linien zu sehen sind, ließen die Kartographen Brasilien zugunsten spanischer Gebiete schrumpfen. Sowohl auf der Weltkarte Gerhard Mercators von 1569 als auch auf dem Globus Peter Apians von 1576 verlief die Linie (weit) östlich von Rio de la Plata und Amazonasmündung, wenn auch zugegeben werden muss, dass das östliche Neufundland immer noch auf portugiesisches Gebiet fiel[70].
Dasselbe gilt grosso modo für die Verzeichnung der Molukken. Auch nach dem Vertrag von Saragossa wurde die Inselgruppe von Spanien freundlichen Autoren optisch in den spanischen Machtbereich gesetzt. So wie Sebastian Caboto die Molukken im Westen hinter dem amerikanischen Festland zeigte, so präsentierten auch Gemma Frisius 1553 auf der in der Cosmographia Petri Apiani abgebildeten zwiebelförmigen Weltkarte die Molukken im Westen und Johannes Honter in seinem Atlas von 1546[71].
Die Karten englischer, niederländischer und französischer Provenienz folgten weit mehr der portugiesischen Auffassung und verlegten die spanisch-portugiesische Amerikagrenze weit nach Westen ebenso wie die Gewürzinseln meist im Osten verzeichnet wurden[72].
21
4. Zeigen, benennen und verschweigen
Natürlich beschränkte sich die Durchsetzung von Besitzansprüchen über das Medium der Kartographie nicht auf die Darstellung der Linien. Ebenso oder fast noch prominenter waren die Namensgebung und die Verteilung besitzanzeigender Fähnchen oder Wappen[73]. Niederländische Kartographen teilten die Landmassen durch farbige Flächen ein. Fast automatisch entstand so die Vorstellung unterschiedlicher politischer Gegebenheiten, seien es unterschiedliche Sprachgruppen oder eben Herrschaftsbereiche. Auch wenn die Farbflächen nicht immer eindeutig zugeordnet werden können und der Phantasie entsprungen zu sein scheinen, im Falle Brasiliens oder Neufrankreichs verfestigte die Darstellung doch die Vorstellungen von territorialen Herrschaftsgebieten[74], auch wenn die spanische Seite diesen Stil aufnahm und die traditionelle Liniendarstellung dagegen zu setzen versuchte. Die in der Descripción de las Yndias des spanischen Historikers Antonio de Herrera y Tordesillas gedruckte Karte der westlichen Hemisphäre, auf der die Tordesillaslinie die Farbfläche „Brasilien“ in zwei Hälften teilt, mag als Beispiel gelten für den Versuch, zwei unterschiedliche Darstellungsweisen, die unterschiedliche politische Vorstellungen transportierten, miteinander zu versöhnen[75]. Als die Vereinigten Provinzen Teile Brasiliens erobert hatten, teilte man in den Niederlanden das Gebiet kartographisch farblich ab[76], ebenso wie die Kartographen Nordamerika zwischen den europäischen Mächten aufteilten, ohne dass man allzu viel vom Landesinneren gewusst hätte[77].
22
Auch an diesen Karten lassen sich die weltanschaulichen Gräben zwischen den gegenüber Spanien positiv oder negativ eingestellten Kartographen studieren. Petrus Plancius, der mittels Farbflächen die Zugehörigkeit großer Gebiete Brasiliens zu Portugal bzw. später zu den Niederlanden suggerierte, war als Prediger der reformierten Kirche 1585 vor der Inquisition nach Amsterdam geflohen und beriet die niederländische Ostindienkompanie für ihre Unternehmungen. Abraham Ortelius, seit 1575 Kartograph in Diensten Philipps II., verkleinerte, wenn er denn die Technik der unterschiedlichen Einfärbung der Landmassen anwandte, das portugiesische Brasilien zu Gunsten der Spanier[78]. Leider sind die genauen Informationsübertragungswege nicht bekannt, denn hinsichtlich der Form Südamerikas weist Ortelius beispielsweise enorme Abweichungen gegenüber der offiziellen spanischen Cabot-Karte von 1544 auf[79]. Auch scheint sich die portugiesisch-spanische Thronunion nur wenig auf die „pro- oder contra-spanische“ Darstellungsweise ausgewirkt zu haben, so dass über die Motive der Kartographen nur spekuliert werden kann. Auffällig bleiben aber die beschriebenen Unterschiede.
Die Technik der farbigen Einteilung der Landmassen blieb zunächst vorwiegend auf gedruckte Karten niederländischer Provenienz beschränkt. Portugiesische Kartographen begannen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, natürliche Grenzen für die südamerikanischen Gebiete Portugals zu erfinden. Aus einem See im Herzen des südamerikanischen Festlandes, der gelegentlich mit El Dorado identifiziert wurde, entsprang ein Fluss gen Norden und mündete zuerst im Maranhão, gegen Ende des Jahrhunderts im Amazonas, nahe an dessen Atlantikmündung. Ein weiterer Fluss, meist als Rio Paraguay identifizierbar, floss nach Süden und mündete im Rio de la Plata. Ein Wappen reklamierte das Gebiet östlich dieser Flussläufe für Portugal. Zwischen 1568 und 1575 ließ Fernão Vaz Dorado das portugiesische Herrschaftsgebiet am Maranhão enden, 1580 verzichtete er auf die „natürliche Grenze“ und suggerierte bildlich eine Ausweitung des Gebiets bis zum Amazonas[80]. Immer wenn danach portugiesische Kartographen die „natürliche Grenze“ einzeichneten, kam sie am Amazonas zu liegen [81]. Seit 1543 die Entdeckung des Amazonas in Portugal bekannt geworden war, hatten die portugiesischen Kartographen die Flussmündung in die Nähe des Maranhão gerückt. Auf spanischen Karten kam er stets ein Stückchen weiter westlich zu liegen[82].
23
Wichtiges Ritual und Herrschaftsmittel im Zeitalter der Entdeckungen war die Neubenennung und damit Neuaneignung eines Territoriums durch den Entdecker. Dieser Herrschaftsmechanismus hatte zwei Spitzen: Einmal war er gegen die Ureinwohner gerichtet, denn indem der ursprüngliche Name verschwand, wurde das Gebiet zur terra nullius erklärt und symbolisch in Besitz genommen. Zum anderen wurden über die Namensgebung Herrschaftsrechte gegenüber Konkurrenten angemeldet und – so sie sich durchsetzten – sprachlich besiegelt[83]. Karten suggerierten dabei die Territorialität von Herrschaft, die ja oft nicht mehr war als einige wenige mehr oder minder gut versorgte Handelsplätze oder Siedlungen oder gar nur die postulierte ›Erstentdeckung‹ eines Kaps, einer Insel, einer Wasserstraße oder größerer Landmassen durch europäische Seefahrer. Kartographisch lässt sich dieses Phänomen am Besten für Nordamerika untersuchen. Hier befanden sich die Europäer bereits im 16. Jahrhundert in der größten Konkurrenzsituation. Abseits von den zentralen Großreichen Südamerikas und damit außerhalb des zentralen Fokus’ der Spanier und Portugiesen tummelten sich hier, neben den Iberern, Engländer und Franzosen auf der Suche nach einer Nordwestpassage oder nach reichen Fischgründen.
Während sich die frühen englischen Entdeckungsfahrten abgesehen von der bereits erwähnten Cosa-Karte (und der verschollenen Karte der Cabotos) zunächst kartographisch nicht niederschlugen, manifestierten die Franzosen die ersten im Namen ihres Königs unternommenen atlantischen Fahrten auf Karten. 1523 starteten Florentiner Kaufleute in Lyon ein Unternehmen zur Suche nach einer Durchfahrt durch Nordamerika, engagierten den Kapitän Giovanni de Varrazzano und stellten die Unternehmung unter den Schutz Franz I. Verrazzano bereiste die nordamerikanische Ostküste zwischen Florida und Neufundland, eine Fahrt von der eine Kartenskizze Vesconte de Maggiolos Zeugnis gibt[84]. Obwohl sich der von Verrazzano vergebene Name nach Franz I. auf Dauer nicht durchsetzte, konnte man sehr schnell die Bezeichnung Neu-Frankreich in der europäischen Kartographie etablieren, obwohl zunächst weder spanische noch portugiesische Kartographen von dieser Namensgebung Notiz nahmen. Auf einer Karte des Bruders des Entdeckers Girolamo Verrazzano wurde das Gebiet als Nova Gallia eingetragen, eine Bezeichnung die in verschiedenen sprachlichen Abwandlungen von den französischen Karten der Diepper Schule vertieft und von den nördlich der Alpen gedruckten Karten tradiert wurde bis sie an der Wende zum 17. Jahrhundert schließlich auch von den Iberern übernommen wurde, obwohl der Zusatzartikel des Waffenstillstandes von Vaucelles noch 1556 die französische Schifffahrt nach Amerika ohne Zustimmung Philipps II. verboten hatte. Freilich waren nach den Entdeckungsfahrten Cartiers zwischen 1534 und 1542 auch auf portugiesischen Karten bereits französische Fähnchen an der Ostküste Nordamerikas aufgetaucht[85].
24
Als der Wettbewerb um Kolonialbesitz im 17. Jahrhundert schärfer wurde und mehr und mehr Informationen über die Neue Welt auch von nicht-iberischen Seefahrern nach Europa gebracht wurden, schlug sich das recht schnell in der kartographischen Namensgebung nieder. Lange bevor englische Siedler Virginia dauerhaft in Besitz nehmen konnten, war es kartographisch bereits eine englische Kolonie[86]. Nur wenige Jahre benötigte die Kolonie bis sie auch auf portugiesischen Karten Einzug erhielt[87]. Völkerrechtliche Relevanz erhielten frühe englische Amerikakarten, da man im Friedensvertrag 1604 zwischen Spanien und England vereinbart hatte, die englische Schifffahrt nach Indien dürfe gemäß den Gewohnheiten vor dem Krieg (de uso y observancia) stattfinden. Nun erhielten Karten wie jene John Whites, der 1585/86 die Küste Virginias verzeichnet hatte, Beweiskraft[88]. Joannes Janssonius verzeichnete 1636 bereits einen nordamerikanischen Fleckenteppich, auf dem sich die europäischen Seemächte von Neu-Spanien bis Neu-Britannien spiegelten[89].
Eine außergewöhnlich interessante Karte ist die Mapamundi Sabastian Cabotos aus dem Jahr 1544, denn ihr Urheber diente sich für seine Entdeckungsfahrten sowohl dem englischen als auch dem spanischen Monarchen an. Seine für kommerzielle Zwecke in Sevilla auf Grundlage des offiziellen Padron Real gefertigte Weltkarte, die in Antwerpen gedruckt wurde, zierte im 16. Jahrhundert angeblich die Privatgalerie der englischen Monarchen in London [90] und spiegelt, so wird Caboto zumindest von einigen Wissenschaftlern unterstellt, eine spanisch-englische Komplizenschaft gegen französische Ansprüche. Obwohl Caboto durchaus die Erkundungen Cartiers verarbeitete, verlegte er die Entdeckungsfahrt seines Vaters Giovanni oder John Cabot(o)s 1497/98 im Auftrag der Engländer kurzerhand nach Süden, so dass Cartier die Erstentdeckung abgesprochen werden konnte[91].
Neben solch unterschwelligen Botschaften boten Karten natürlich auch Platz für anderweitige Informationen. Vor allem Manuskriptkarten im Portolanstil wurden oftmals ergänzt durch Einträge zu den europäischen Entdeckern einzelner Küstenabschnitte, ökonomischen Interessen oder politischen Verhältnissen. Angefangen von der Cantino-Karte, die sowohl Entdecker als auch Handelsgüter, lokale Herrscher und Bündnisse verzeichnet, über die Karten der Reinels finden sich derartige Angaben vor allem auf portugiesischen Karten. Portugals überseeische Unternehmungen waren immer abhängig von der Beteiligung ausländischer Kaufleute und Geldgeber und so kann vermutet werden, dass die Karten auch ein Stück weit die Funktion erfüllten, Investoren für die Unternehmungen zu werben. Die Überlieferung so mancher Karte in Oberdeutschland oder in italienischen Handelsstädten spricht ebenfalls für eine solche Vermutung.
25
5. Die Karte als Medium plakativer politischer Propaganda
Natürlich könnte man die Mehrheit der bereits angesprochenen Aspekte unter den Oberbegriff Propaganda fassen, denn letztlich transportierten die Karten bewusst oder unbewusst politische Ansprüche. So dient die hier vorgenommene Einteilung hauptsächlich der besseren Übersicht und die im Folgenden genannten Beispiele wurden ausgewählt, weil ihre Botschaft sehr plakativ ist und leicht in den politischen zeitgenössischen Rahmen eingeordnet werden kann.
In Frankreich verlief der Ausgriff auf amerikanisches Territorium und die Entwicklung der Kartographie in den französischen Hafenstädten parallel, so dass der Aufstieg der französischen Kartographieschule begleitet wurde durch die Nutzung des Mediums für die Auseinandersetzung der Franzosen mit den Spaniern. Die erste Darstellung indianischer Zwangsarbeit in der europäischen Kunst – wichtiger Topos der gegen Spanien gerichteten Schwarzen Legende – findet sich denn auch auf einer französischen Karte der späten 1530er Jahre[92]. Auf die Durchsetzung französisch geprägter Territorialnamen ist weiter oben schon verwiesen worden.
Wie ebenfalls bereits erwähnt, setzte die Durchsetzung der von englischen Seefahrern vergebenen Namen in der europäischen Kartographie erst später ein, denn bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts gab es zwar englische Erkundungsfahrten nach Amerika, doch diese führten kaum zu diplomatischen Verwicklungen mit Spanien und Portugal, denn zum einen waren Spanien und England in ihren Auseinandersetzungen mit Frankreich gebunden. Auch lagen die wirtschaftlichen Interessen der Engländer kaum im Überseehandel, sondern auf einem stabilen Austausch mit den Niederlanden. Erst als dieser durch die spanisch-niederländische Auseinandersetzung nachhaltig gestört wurde, schwenkte die englische Politik auf Konfrontation[93]. Sehr geschickt begleiteten die Engländer die Ausgriffe ihrer Seadogs auf spanische Siedlungen und auf von Spanien reklamierte Territorien mit einer politischen Propaganda, die den heroischen englischen Kampf gegen die Hegemonialmacht Spanien unterstützte. Ab 1588 wurden wiederholt Karten gedruckt, die die Erdumsegelungen Francis Drakes und Thomas Cavendishs feierten, ebenso wie der in London ansässige italienische Kartograph Baptista Boazio kolorierte Kupferstiche fertigte, die die Angriffe Drakes auf spanische Atlantikhäfen drastisch visualisierten. Hondius’ unterschlug zwar die bereits 1585 von Sir Walter Raleigh gegründete ›Kolonie‹ Virginia, verzeichnete aber das von Francis Drake gegründete ›Nova Albion‹ an der kalifornischen Küste[94].
Schließlich ließen sich iberische Besitzansprüche immer wieder durch eine behauptete Erstentdeckung Amerikas im Namen anderer Souveräne anzweifeln. Mitte des 16. Jahrhunderts tauchte ein angeblich aus dem 14. Jahrhundert stammender italienischer Reisebericht auf, der durch eine während der Reise angefertigte Karte bewiesen werden sollte. Zwar können Bericht und Karte heute eindeutig als Fälschung entlarvt werden, doch wurde der Bericht nicht zufällig im Jahre 1600 in Richard Hakluyts Reisesammlung Principal Navigations aufgenommen, just zu dem Zeitpunkt als man in England nachhaltig versuchte, die spanischen (und portugiesischen) Besitztitel auf die Neue Welt grundsätzlich zu erschüttern[95].
26
6. Zusammenfassung und Schluss
Nach den Entdeckungen des Kolumbus avancierte die Kartographie zu einem wichtigen Medium zur Verbreitung der Kenntnisse über die neu entdeckten Gebiete und Seewege. Dabei können verschiedene Anforderungen an die Kartographie ausgemacht werden, die sich zum Teil gegenseitig behinderten. Auf der einen Seite sollte die über Karten weitergegebene Information die Seefahrt sicherer machen und zum Erfolg weiterer Expeditionen beitragen. Zum anderen gab es kaum ein besseres Medium, um Herrschaftsansprüche über neu oder noch gänzlich unbekannte Gebiete zu visualisieren. Drittens schließlich diente die Kartographie einem humanistischen Interesse an der Vervollständigung des europäischen Weltbildes. Zwar kann jedem dieser Zwecke eine bestimmte Herstellungs- bzw. Verbreitungstechnik zugeordnet werden ebenso wie ein oder mehrere Zentren der Produktion, doch die Kartographen der verschiedenen Länder, Zentren und Techniken beeinflussten sich gegenseitig, ohne dass die genauen Kommunikationswege sich heute noch exakt nachvollziehen lassen.
Darüber hinaus kann bei vielen Werken eine politische Aussage festgestellt werden und oft lässt sich auch ein politisches Interesse zuordnen. Allerdings lässt sich die Steuerbarkeit der Kartographie durch die (königliche) Obrigkeit im Sinne einer durchgängigen Informationspolitik nur sehr eingeschränkt annehmen. Wie nicht zuletzt das Beispiel Pedro Reinels und seiner „Molukkenkarten“ zeigt, konnten Monarchen bzw. Behörden Kartographen anstellen bzw. Karten in ihrem Sinne fertigen lassen, die Unterbindung dieser Dienste für andere Höfe gelang jedoch kaum. Das kartographische Bild der Welt wurde nicht nur von Kartographen verschiedener Provenienz zusammengetragen, das Agieren der Kartographen selbst war in höchstem Maße „transnational“ verflochten, so dass die Nutzung des Mediums Karte als Propaganda- und Beglaubigungsinstrument zwar seitens der Souveräne und Administrationen angestrebt wurde, mangelnde Überprüfbarkeit der Daten aber ebenso wie die nur unzureichende Macht über die Kartographen zu einer nur eingeschränkten Kontrolle dieses Instruments führte.
Für fast jeden Kartenbeweis gibt es auch einen kartographischen Gegenbeweis und so wird man zwar auf Karten für die Durchsetzung völkerrechtlicher Ansprüche zurückgegriffen haben, der Erfolg dieser Maßnahmen bleibt aber zumindest umstritten. Dennoch konnten Karten, wie beispielsweise die Zuordnung Neufundlands in portugiesisches Gebiet zeigt, für Gegenden, die etwas außerhalb des Interessefokus lagen, durchaus politische Fakten schaffen. So blieb die Kartographie auch als man anfing, das ptolemäische Weltbild durch eines stärker der Erfahrung verpflichteten zu ersetzen, ein Medium für ein Weltbild zwischen Realität und Fiktion.
27
Quellen- und Literaturverzeichnis
Arbel, Benjamin: Maps of the World for Ottoman Princes? Further Evidence and Questions concerning The „Mappamondo“ of Hajji Ahmed, in: Imago Mundi 54 (2002), S. 19–29.
Archivo General de Simancas: Estado, Leg. 2513, 10.11.1607.
Artehistoria: Revista digital, http://www.artehistoria.jcyl.es.
Barber, Peter (Hg.): Das Buch der Karten, Darmstadt 2006.
Bayerische Staatsbibliothek: BSB-CodIcon Online, http://codicon.digitale-sammlungen.de.
Biblioteca estense universitaria, Modena: Immagini, Carte geografiche, http://www.cedoc.mo.it/estense/img/geo/index.html.
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e dell’Istituto Universitario Europeo: La Cartografia europea tra Rinascimiento e Illuminismo, online-Ausstellung, http://www.bncf.firenze.sbn.it/notizie/Cartografia%20Web/Imperi/Portolano%2027/Texeira%20G.htm.
Bibliothèque et Archives nationales du Québec: Collection numériques des cartes et des plans, http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/accueil.xsp.
Bitterli, Urs: Die Entdeckung Amerikas: von Kolumbus bis Alexander von Humboldt, München 2006 [1991].
Black, Jeremy: Maps and History, New Haven u.a. 1997.
Brown University, Facilities: John Carter Brown Library, online-Exhibition „Portugal and Renaissance Europe“, http://www.brown.edu/Facilities/John_Carter_Brown_Library/Portugal/Geographies.html.
Canas, António Costa: Cartografia náutica medieval, in: Insituto Camoes (Hg.): Navegações Portugueses (2002), http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/b03.html.
Cartographic Images, in: Henry Davis Consulting, Inc., New Products and Marketing Consultants, http://www.henry-davis.com/MAPS/Ren/Ren1/carto.html.
Chadwick, Ian (1992–2007): http://www.ianchadwick.com/hudson/.
Cortesão, Armando/Teixeira da Mota, Avelino: Portvgaliae monvmenta cartographica: comemorações do V centenário da morte do infante D. Henrique, 6 Bde, Lissabon 1960 (Kurztitel PMC).
Cortesão, Armando: History of Portuguese Cartography, Coimbra 1971.
Davenport, Francis Gardiner: European Treaties bearing on the History of the United States and its dependencies, Bd. 1, New York 1917.
Dreyer-Eimbcke, Oswald: Mythisches, Irrtümliches und Merkwürdiges im Kartenbild Lateinamerikas während der Entdeckungszeit, in: Karl-Heinz Kohl (Hg.): Mythen der Neuen Welt. Zur Entdeckungsgeschichte Lateinamerikas Ausstellung des 2. Festivals der Weltkulturen, Horizonte `82. Martin-Gropius-Bau, 13. Juni – 29. August 1982, Berlin 1982.
Duchhardt, Heinz / Peters, Martin (Hg.): http://www.ieg-friedensvertraege.de.
Dünne, Jörg: Die Karte als Operations- und Imaginationsmatrix. Zur Geschichte eines Raummediums, in: Jörg Döring/Tristan Thielmann (Hg.): Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld 2008, S. 49–69.
Encylopedia Britannica: A New Survey of Universal Knowledge, Chicago u.a. 1956.
Feldbauer, Peter: Estado da India. Die Portugiesen in Asien 1498–1620, Wien 2003.
Fisch, Jörg: Die europäische Expansion und das Völkerrecht, Stuttgart 1984.
Gama, Luisa: Escola de Sagres, unter: Insituto Camoes (Hg): Navegações Portugueses (2002), http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/a21.html.
Hantzsch, Victor/Schmidt, Ludwig (Hg.): Kartographische Denkmäler zur Entdeckungsgeschichte von Amerika, Asien, Australien und Afrika aus dem Besitz der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Leipzig 1903.
Harley, J.B.: Silences and Secrecy. The hidden Agenda of Cartography in Early Modern Europe, in: Imago Mundi 40 (1988), S. 57–76.
Heitzmann, Christian (Hg.): Europas Weltbild. Globalisierung im Zeitalter der Entdeckungen, Wolfenbüttel 2006.
Herrera y Tordesillas, Antonio de: Descripción de las Yndias Ocidentalis, Amsterdam 1622.
Hinz, Felix: Hispanisierung in Neu-Spanien 1519–1568. Transformation kollektiver Identitäten von Mexica, Tlaxcalteken und Spaniern, Hamburg 2005.
Historical Atlas of Canada, Online Learning Project, http://www.historicalatlas.ca/website/hacolp.
John Ford Bell Library (Univerity of Minnesota): Portolan Charts, online: http://bell.lib.umn.edu/map/PORTO/porto.html.
Jones, Evan T.: Alwyn Ruddock: John Cabot and the Discovery of America, in: Historical Research 81/12 (2008), S. 224–254.
Kahle, Günter: Lateinamerika in der Politik der europäischen Mächte, Köln u.a. 1993.
Kempe, Michael: Piraten als Gestalter des Völkerrechts? Ein Blick in frühneuzeitliche Friedens- und Waffenstillstandsverträge, in: Publikationsportal Europäische Friedensverträge, hg. vom Institut für Europäische Geschichte, Mainz 2008-11-18, Abschnitt 1–28, bes. 2, URL: http://www.ieg-mainz.de/publikationsportal/kempe12200801/index.html.
Kimble, George H.: Portuguese policy and its influence on fifteenth century cartography, in: The Geographical Review 23 (1933), S. 653–659.
Kupcik, Ivan: Münchner Portolankarten „Kunstmann I– XIII“ und zehn weitere Portolankarten. Überarbeitete und ergänzte Neuausgabe des Originalwerkes von Friedrich Kunstmann aus dem Jahr 1859 mit 13 erneuerten Farbtafeln sowie zehn weiteren Seekarten vom Anfang des 16. Jahrhunderts, einschließlich der seit 1945 verschollenen Seekarten aus Münchner Sammlungen, München u.a. 2000.
Larsen, Egon: John und Sebastian Cabot, Stuttgart 1985.
Library of Congress: Exhibitions, Exploring the Early Americas, http://www.loc.gov/exhibits/earlyamericas.
Ders.: Exhibitions, The Cultures and History of the Americas: The Jay I. Kislak Collection, http://www.loc.gov/exhibits/kislak/kislak-exhibit.html.
Ders.: Geographic and Maps Division, An Illustrated Guide, http://www.loc.gov/rr/geogmap/guides.html.
Ders.: Hispanic and Portuguese Collections, An Illustrated Guide, http://www.loc.gov/rr/hispanic/guide/iberia.html.
Ders.: Map Collections, General Maps, http://memory.loc.gov/ammem/gmdhtml/gnrlhome.html.
Library of New South Wales: http://acms.sl.nsw.gov.au/album/albumView.aspx?itemID=861199&acmsid=0.
Mesenburg, Peter: Untersuchung zur Geometrie und Genese alter Karten (ohne Datum), http://www.mesenburg.de.
Nebenzahl, Kenneth: Atlas de Colón y los Grandes Descubrimientos, Madrid 1990.
NOVA: science programming on air and online, the Viking deception, http://www.pbs.org/wgbh/nova/vinland/insp-03.html.
Pieper, Renate: Die Vermittlung einer Neuen Welt, Amerika im Nachrichtennetz des habsburgischen Imperiums, 1493–1598, Mainz 2000.
Dies.: The Impact of the Atlantic on European Self-Perception. European World-Maps of the 16th Century, in: Horst Pietschmann (Hg.): Atlantic History. History of the Atlantic System 1580–1830, Göttingen 2002.
Piltz, Eric: „Trägheit des Raums“. Fernand Braudel und die Spatial Stories der Geschichtswissenschaft, in: Jörg Döring/Tristan Thielmann (Hg.): Spatial Turn. Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld 2008, S. 75–102.
Relaño, Francesc: The shaping of Africa, Aldershot/Burlington 2002.
The European Library: Exhibitions, Treasures, http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition/treasures/geography/geography1.html.
Tohoku University Library: Image database of the Kano Collection, http://www2.library.tohoku.ac.jp/kano/ezu/kon/kon.html, Trevelyan, Raleigh: Sir Walter Raleigh, New York 2004.
Virga, Vincent: Cartographia. Mapping Civilizations, New York u.a. 2007.
Vizuete Villar, Francisco Javier: La Cartografía como discurso legitimador en „el Descubrimiento“ y Conquista de América, http://www.ub.es/hvirt/expo/javi/index.htm.
Wagner, Henry R.: A map of Sancho Gutiérrez of 1551, in: Imago Mundi 8 (1951), S. 47–49.
Weindl, Andrea: Wer kleidet die Welt? Globale Märkte und merkantile Kräfte in der europäischen Politik der Frühen Neuzeit, Mainz 2007.
Wikimedia Commons: Medien Archiv, http://commons.wikimedia.org.
Wolff, Hans (Hg.): America das frühe Bild der Neuen Welt, München 1992.
Zeuske, Michael: Atlantik, Sklaven und Sklaverei. Elemente einer neuen Globalgeschichte, in: Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte 6 (2006), S. 9–44.
Websites ohne genauere Herkunftsangabe: http://1.bp.blogspot.com/_KEOd_sgYszk/SjEa9CO9uoI/AAAAAAAACBE/mNEnykYwwJ0/s1600-h/ColombusMap2.jpg und http://shakingthetree.files.wordpress.com/2009/06/antique_map_plancius_world1.jpg
28
[*] Andrea Weindl, Dr., Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
[2] Damit ist weniger der Geburtsort oder die Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe gemeint, sondern die Ausführung des Unternehmens im Namen und unter dem Schutz eines bestimmten Souveräns. Auch der Begriff Untertan hilft in diesem Zusammenhang wenig weiter. Schon Kolumbus gibt Zeugnis für die „Transnationalität“ der Entdecker. Vgl. auch zur Geschichte von Giovanni/John und Sebastian Cabot(o), Larsen, John und Sebastian Cabot 1985.
[3] Vgl. Zeuske, Atlantik 2006, S. 9–44, wo Zeuske feststellt: „Der allgemeine Prozess der Aufhebung der relativen Isolierung der großen Reiche und Weltökonomien durch Conquistas, maritime Expansion und Handel lag zwischen 1400 und 1600 in der Luft beziehungsweise […] auf den Wassern des Globus. In der Expansion folgte die Flagge dem Rescate-Handel (oft auch, weil die men on the spot auf eigene Rechnung raubten) oder dem Schwert oder Krummsäbel. Der Ansatz bei Kolumbus war Rescate und portugiesische Feitoria, also der Fernhandel, nicht die Territorialconquista!“, ebd., S. 35.
[4] Vgl. exemplarisch Trevelyan, Sir Walter Raleigh 2004. Die Geschichte der Freibeuter, Piraten und Korsaren spielt meist in genau diesem Spannungsfeld. Vgl. Kempe, Piraten 2008, Abschnitt 2, URL: http://www.ieg-mainz.de/publikationsportal/kempe12200801/index.html (eingesehen am 10.11.2009).
[5] Vgl. z.B. die von dem arabischen Kartographen Piri Reis aus verschiedenen Quellen gefertigte Atlantikkarte von 1513 unter: Mesenburg, Untersuchung o.J., http://www.mesenburg.de/Seiten/Porolane/Weltkarten/Piri-Reis/Piri-Reis_Karte.htm (zu deren Quellen vgl. Wolff, America 1992, S. 43 oder die japanische Kopie einer Weltkarte von Matteo Ricci online unter Tohoku University Library, Image database of the Kano Collection, http://www2.library.tohoku.ac.jp/kano/ezu/kon/kon.html). Eine der ersten modernen Weltkarten überhaupt, die so genannte Cantino-Planisphäre zeigt zahlreiche arabische Einflüsse. Sowohl Vasco da Gama als auch Pedro Álvarez Cabral hatten arabische Piloten in ihren Diensten. Vgl. hierzu auch Arbel, Maps of the World 2002. Zur Kartographie der Frühzeit außerhalb Europas vgl. auch Black, Maps and History 1997, S. 1–4.
[6] Reinhard Kosseleck zitiert nach Piltz, Trägheit des Raums 2008, S. 78. Den zweiten Pol bildet die „Naturvorgegebenheit jeder menschlichen Geschichte“, ebd.
[7] Besonders im Spanischen Machtbereich, aber auch für die Landfragen zwischen europäischen Siedlern und nordamerikanischen Ureinwohnern, griff man immer wieder auf das Medium der Kartographie zur Klärung und Sicherung von territorialen Besitztümern und Machtansprüchen zurück. Das Thema des vorliegenden Aufsatzes ist aber das Verhältnis zwischen der Kartierung der Welt und europäischem Völkerrecht wie es über Übersee vereinbart wurde. Vgl. hierzu auch Fisch, Europäische Expansion 1984, S. 44–108.
[8] Cortesão, PMC 1960.
[9] Nebenzahl, Atlas de Colón 1990.
[10] Wolff, America 1992.
[11] Kupcik, Münchner Portolankarten 2000; Hantzsch, Kartographische Denkmäler 1903.
[12] Die Portolankarten (manchmal auch Portulan) entwickelten sich aus Verzeichnissen, die über Häfen, Untiefen, Strömungen usw. Auskunft gaben. Zur Geschichte der Portolane mit einigen Beispielen vgl. online: John Ford Bell Library (University of Minnesota): Portolan Charts, http://bell.lib.umn.edu/map/PORTO/porto.html (eingesehen am 22.10.2009).
[13] Vgl. hierzu z.B. Mesenburg, Untersuchung o.J., http://www.mesenburg.de/Seiten/Porolane/portolane_index.htm (eingesehen am 22.10.2009).
[14] Der Venezianer Bianco fertigte 1448 eine Karte in London, für die er wahrscheinlich Vorlagen aus Lissabon mitnahm. Bianco verzeichnete zwischen Cap Bojador und Cabo Roxo 36 Ortsnamen während Fra Mauro nur 23 nannte. Ganz im Westen trug Bianco eine „ixola otinticha“ (authentische Insel), die von manchen als Beweis einer frühen portugiesischen Entdeckung Amerikas genommen wird. Vgl. Cortesão, Portuguese Cartography 1971, S. 171–178; Kimble, Portuguese policy 1933, S. 653–659. Kimble vermutet, dass die Portugiesen Fra Mauros Karte weniger zur Verzeichnung der genauesten geographischen Kenntnisse wünschten, sondern um sich bestätigen zu lassen, dass die Umrundung Afrikas nach Meinung der berühmtesten Kartographen der Zeit möglich wäre. Für eine Ansicht Fra Mauros Karte siehe online Wikimedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FraMauroDetailedMap.jpg (eingesehen am 12.11.2009).
[15] Ungeklärt ist, ob Christoph Kolumbus gemeinsam mit seinem Bruder Bartolomeu die nach 1492 entstandene Karte selbst fertigte oder fertigen ließ. Zumindest ist wahrscheinlich, dass sie sich im Besitz des Seefahrers befand. Seit 1476 befand sich Christoph Kolumbus mehrere Jahre in Portugal zur Sammlung von Informationen. Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 23. Ein hochauflösbares Bild der Karte findet sich unter http://1.bp.blogspot.com/_KEOd_sgYszk/SjEa9CO9uoI/AAAAAAAACBE/mNEnykYwwJ0/s1600-h/ColombusMap2.jpg (eingesehen am 22.10.2009), siehe auch Mesenburg, Untersuchung o.J.
[16] Cortesão nennt lediglich zwei Karten aus dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts. Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. I, S. xlv und Estampa 2. Es kann davon ausgegangen werden, dass spätestens seit 1420, als ein mallorquinischer Meister in Lissabon unterrichtete, Portolankarten in Lissabon erstellt wurden. Vgl. Canas, Cartografia 2002, http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/b03.html (eingesehen am 22.10.2009).
[17] 1434 wurde in Lissabon die Casa da Ceuta gegründet, 1445 folgte in Lagos die Casa de Arguim e da Guiné, nach 1460 wurden beide Häuser unter dem Dach der Casa da Guiné e da Mina in Lissabon vereinigt, nach der erfolgreichen Umrundung Afrikas zentralisierte man die überseeischen Unternehmungen in der Casa da Guiné, da Mina e da Índia, die man später schlicht Casa da Índia nannte. Vgl. Feldbauer, Estado da India 2003.
[18] Vgl. Harley, Silences 1988, S. 61. Harley gibt hier keine Quellenangabe. Wahrscheinlich ging es bei dem Erlass um öffentlich verbreitete Karten und nicht um jene, die Seefahrern für ihre Entdeckungsfahrten mitgegeben wurden.
[19] Vgl. Relaño, Shaping of Africa 2002, S. 152–157.
[20] Vgl. Harley, Silences 1988, S. 58f.
[21] Vgl. Jones, Alwyn Ruddock 2008, S. 236f.
[22] Vgl. Pieper, Vermittlung 2000, S. 88. Pieper weist darauf hin, dass die Informationen, aus Barcelona stammend, über Rom verbreitet wurden, was auf eine Nutzung der guten Verbindungen der Katholischen Könige zum spanischen Papst hinweist.
[23] Vgl. ebd., S. 123, 125, 132f.
[24] Der Name „America“ tauchte erstmals auf der Karte „Die vollständige Kosmographie nach der Überlieferung des Ptolemäus und nach Amerigo Vespucci sowie nach anderen Abbildungen“ auf, die Waldseemüller als Begleitkarte der von Ringmann herausgegebenen und fälschlicherweise Vespucci zugeschriebenen „Quatuor navigationes“ fertigte. Für eine Ansicht der Karte siehe: Library of Congress, Exploring the Early Americas, http://www.loc.gov/exhibits/earlyamericas/maps/html/worldmap1507 (eingesehen am 26.10.2009).
[25] Vgl. Pieper, Vermittlung 2000, S. 140–143.
[26] In seinem Werk „Cosmographiae introductio“ berief sich Waldseemüller auf heute unbekannte portugiesische Karten. Vgl. Library of Congress, Exploring the Early Americas, http://www.loc.gov/exhibits/earlyamericas/maps/html/worldmap1507/highlights1507.html (eingesehen am 23.10.2009).
[27] Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 64. Für eine Abbildung siehe ebd., S.64f. oder Library of Congress, An illustrated guide, http://www.loc.gov/rr/geogmap/guide/gm010001.jpg. Für die Carte Marina von 1516 siehe ebd., Exploring the Early Americas, http://www.loc.gov/exhibits/earlyamericas/maps/html/cartamarina1516 (eingesehen am 23.10.2009).
[28] Vgl. hierzu auch Caspar Vopels Weltkarte von 1545, auf der eine Legende erzählt, einige Kastilier und der Kaiser selbst hätten ihm versichert „die genannten Länder [in der Neuen Welt, A.W.] seien keineswegs durch das Meer vom Orient getrennt, sondern hingen mit ihm zusammen.“ Zitiert nach der deutschen Übersetzung des lateinischen Originals, in: Heitzmann, Europas Weltbild 2006, S. 89f. Die Karte ist verloren gegangen, doch gibt es eine 1558 von Giovanni Vavassore gefertigte Kopie, die 1570 mit wenigen Abänderungen in Antwerpen publiziert wurde. Vgl. ebd., S. 88.
[29] Vgl. Pieper, Vermittlung 2000, S. 115 und Anhang.
[30] Vgl. z.B. die so genannten Kunstmann-Karten I-III, die wahrscheinlich aus der Sammlung Konrad Peutingers stammten, der ein Konsortium oberdeutscher Kaufleute für ihre Beteiligung an einer Indienexpedition juristisch vertrat, in: Kupcik, Münchner 2000 und Pieper, Vermittlung 2000, S. 136.
[31] Selbst die illegal aus Lissabon geschmuggelte Cantino-Karte von 1502 weist Lücken in der Benennung der afrikanischen Westküste auf. Die Manuskriptkarte Nicolo Caveris, 1504–1505, die ebenfalls sowohl die spanischen Karibikinseln als auch ganz Afrika verzeichnet gilt als Kopie der Cantino-Karte. Vgl. Relaño, Shaping of Africa 2002, S. 156; Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 34–37 und 40–43. Siehe auch Biblioteca estense universitaria, Modena http://www.cedoc.mo.it/estense/img/geo/Cantino/index.html (eingesehen am 23.10.2009). Ebenso weist die so genannte Kunstmann II Karte wahrscheinlich aus italienischer Feder eine starke Ähnlichkeit mit der Cantino-Planisphäre auf. Online unter: BSB-CodIcon Online, http://codicon.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00003881,00001.html?prozent=1 (eingesehen am 4.11.2009).
[32] Vgl. Pieper, Vermittlung 2000, S. 141–157.
[33] Vgl. ebd., S. 156f.
[34] Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 112–115 und S. 126–129.
[35] Vgl. Pieper, Impact 2002, S. 97–117, bes. 113–117.
[36] Vgl. ebd., S. 114.
[37] Vgl. z.B. die von Vaz Dourado stammenden Karten in Bd. III der PCM. Die aus der Feder Dourados stammenden Karten Kunstmann VIII–XII wurden in Goa gezeichnet und in München gebunden.
[38] Vgl. Wolff, America 1992, S. 55–59.
[39] Ein Patent der Generalstaaten erteilte 1592 dem Drucker Cornelis Claesz das Privileg alle 25 Seekarten, die er über Petrus Plancius von Bartolomeu Lasso erhalten hatte, zu drucken. Auch für den Verkauf mehrerer Karten Luis Teixeiras, portugiesischer Kartograph (ca. 1550–1620), an die Firma Christoph Platin in Antwerpen lassen sich Belege finden. Ebenso wie Verbindungen zu Ortelius und Jodocus Hondius. Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. III, S. 88 und 41.
[40] Vgl. ebd., Bd. IV, Estampa 487–495, vgl. hierzu auch Kap. 4.
[41] Zu den päpstlichen „Übersee-“ bzw. „Missions“bullen vgl. Fisch, Europäische Expansion 1984, S. 205–209.
[42] Vgl. ebd., S. 46–48.
[43] Vertrag von Alcaçovas, Aragon, Kastilien, Portugal 1479 IX 4, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege, zitiert nach Davenport, European Treaties 1917, S. 38 (Art. 8).
[44] Fisch, Europäische Expansion 1984, S. 52.
[45] Auf den für diesen Aufsatz gesichteten Karten des 15. Jahrhunderts fand sich allein auf der so genannten „Kolumbuskarte“ die Bezeichnung „Guinea“ und das auch nicht auf der Portolankarte sondern auf der im Halsstück des Pergaments gezeichneten „mapamundi“. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts ließ sich lediglich auf vier Karten die Verwendung des Begriffs „Guinee“ oder „Guinea“ nachweisen, nämlich auf beiden Karten Diego Ribeiros von 1529 (Cortesão, PMC 1960, Bd. I, Estampa 39, 40), von der sich eine im Vatikan, die andere in der Ebner-Bibliothek in Weimar befindet, auf der Jorge Reinel zugeschriebenen Karte von 1519 aus München (auch Kunstmann IV, ebd., Bd. I, Estampa 12), sowie auf der Pedro Reinel zugeschriebene Karte von 1535, die sich heute im National Maritime Museum Greenwich befindet (ebd., Bd I, Estampa 14). Die Bezeichnung Neuguinea setzte sich dagegen schneller durch. Vgl. hierzu auch Encylopaedia Britannica 1956, Bd. 10, S. 971f., die erwähnt, dass der Begriff bereits auf einigen Karten des 14. Jahrhunderts gefunden werden könne, sich aber erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts allgemein durchgesetzt habe. Ein portugiesischer Historiker des 15. Jahrhunderts habe den Begriff erstmals für Gebiete südlich des Senegal-Flusses benutzt.
[46] Zum Wortlaut des Vertrages vgl., Vertrag von Tordesillas, Aragon, Kastilien, Portugal, 1494 VI 7, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-mainz/friedensvertraege.de (eingesehen am 28.10.2009).
[47] Die Karte wurde auf das Jahr 1500 datiert, doch einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei dem überlieferten Exemplar, das heute im Mueso Naval, Madrid ausgestellt wird, um eine spätere Kopie handelt. Vgl. Dreyer-Eimbcke, Mythisches 1982, S. 121–125; Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 30.
[48] Vgl. die Karte unter http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:1500_map_by_Juan_de_la_Cosa-North_up.jpg (eingesehen am 28.10.2009) sowie die von Prof. Dr. Mesenburg an der Universität Duisburg-Essen angestellte Untersuchung zur Geometrie und zur Genese alter Karten, die Übereinstimmungen und Abweichungen der Karte vom tatsächlichen Küstenverlauf verdeutlicht, http://www.mesenburg.de/Seiten/Porolane/Weltkarten/Juan-de-la-Cosa/Juan-de-la-Cosa_Ergebnis.htm (eingesehen am 28.10.2009). Immer wieder ist auch darauf hingewiesen worden, dass das Dokument, in dem Kolumbus während der Erkundung der Südküste Kubas von seiner Mannschaft sich hatte bestätigen lassen, dass man Festland erreicht habe, auch die Unterschrift de la Cosas trug. Gleichwohl wird auf der Karte Kuba bereits als Insel verzeichnet.
[49] Vgl. Cosa, Juan de la, in: Artehistoria http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/5759.htm (eingesehen am 29.10.2009).
[50] Über die als ›liña meridional‹ eingezeichnete Tordesillas-Linie wurde in der Höhe Brasiliens vermerkt: „este cavo se descubrió en año de mil y IIIIXCIX por Castilla syendo descubridor yicentians“ (Vicente Yanez Pinzón), während die davon ein Stück südöstlich liegende Insel die Aufschrift: „Ysla descubierta por Portugal“ trägt. Wahrscheinlich gelangte die Kunde von der Entdeckung Cabrals noch während de la Cosa an der Karte arbeitete nach Spanien. Zur Beschreibung der Karte vgl. auch http://www.henry-davis.com/MAPS/Ren/Ren1/305mono.html (eingesehen am 29.10.2009).
[51] Zu Deutsch „durch Engländer entdecktes Meer“. Man geht davon aus, dass de la Cosa die Verzeichnung der Ostküste Nordamerikas einer heute verschollenen Karte der Cabotos entnahm. Wahrscheinlich wurden die Spanier von den englischen Entdeckungen durch einen Brief von England an Ferdinand von Spanien in Kenntnis gesetzt. Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 30.
[52] Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. I, S. 11. Online wie FN 31 Biblioteca estense universitaria http://www.cedoc.mo.it/estense/img/geo/Cantino/index.html (eingesehen am 29.10.2009).
[53] Die Karte ist auch unter Kunstmann IV bekannt. Sie befand sich ehemals in der Wehrkreisbücherei München und ist inzwischen verschollen. Es existieren aber noch Reproduktionen. Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. I, S. 37f., Estampa 12. Während der Konferenz von Badajoz-Elvas 1524, versuchte die spanische Krone die beiden Reinels für ihre Dienste zu werben. Vgl. ebd., S. 20.
[54] Am 18.7.1519 schrieb der portugiesische Konsul an König Manuel: „[a] terra de Maluco eu vy asentada na poma e carta que ca fez o filho de Reynell, a qual nõ era acabada quando caa sei pay veo por ele, e seu pay acabou tudo e pos estas terra de Maluco, e per este padram se fazem todas llas cartas, as quaes faz Diogo Ribeiro, e faz as agulhas, quadrantes e esperas, porem não vay narmada, nem quer mais que ganhar de comeer por seu engenhos“. Zitiert nach ebd., S. 20, zur Karte vgl. ebd., S. 37f.
[55] Die Karte, die sich heute im Topkapi Museum in Istanbul befindet, ist weder datiert noch signiert, wird aber Pedro Reinel zugeschrieben und auf ca. 1522 datiert. Erstmals in der Geschichte der portugiesischen Kartographie wurde der Äquator für den Eintrag der Längengrade genutzt. Die durch die Molukken laufende Teilungslinie bezeichnet den Nullmeridian. In Amerika kommt die Tordesillaslinie folglich auf dem 180. Breitengrad zu liegen. Vgl ebd., Bd. I, Estampa 13.
[56] Vgl. ebd., S. 20.
[57] Vespucci leitete auf der Konferenz eine eindrucksvolle spanische Delegation, die aus Elcano, dem einzig überlebenden Piloten der Magellan-Expedition, Sebastian Caboto, Diego Ribeiro, Hernan Colón und Esteban Gómez bestand. Vgl. hierzu und zum Folgenden Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 77–79.
[58] Vgl. z.B. die von Karl V. dem päpstlichen Nuntius in Spanien Salviati zum Geschenk gemachte Planisphäre von Nuño García de Torrenos, welche die Molukken ebenfalls im Westen verzeichnet. Vgl. Barber, Buch der Karten 2006, S. 92–94, oder die Diego de Ribeiro, Kartograph der Casa de la Contratación, zugeschriebene Planisphäre aus dem Besitz der Familie Castiglioni aus Mantua (heute Biblioteca estense universitaria, Modena), welche die Molukken zwar in Ost und West zeigt, sie jedoch über eine darunter stehende spanische Fahne als Spanien zugehörig ausweist, vgl. Biblioteca estense universitaria, Modena, http://www.cedoc.mo.it/estense/img/geo/Castiglioni/index.html (eingesehen am 29.10.2009). Vgl. auch die ebenfalls aus der Feder von Ribeiro stammenden Karten, die Cortesão abbildet, Cortesão, PMC 1960, Bd. I, Estampas 38–40. Auch wenn die Überlieferung nicht lückenlos geklärt ist, sprechen die Archivorte, nämlich Weimar und der Vatikan, doch für den propagandistischen Zweck der Karten. Eine ähnliche, unvollendete Karte, wenn auch erst von 1532, befindet sich heute in Wolfenbüttel. Vgl. ebd., Estampa 41.
[59] Vgl. Vertrag von Saragossa, Portugal, Spanien, 1529 IV 22, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.
[60] Vgl. z.B. Cortesão, PMC 1960, Bd. I, Estampa 79. Die Planisphäre von ca. 1545 eines anonymen Kartographen, die sich heute in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien befindet gilt als Kopie des Padrão Real. Der in portugiesischen Diensten stehende Lopo Homem zeigte 1554 ebenso die Saragossa-Linie (vgl. ebd., Estampa 27 oder Wolff, America 1992, S. 58) wie 1573 Luis Teixeira, der die Welt in zwei saubere Hälften teilt (vgl. online unter: Vizuete Villar, La Cartografía o.J., http://www.ub.es/hvirt/expo/javi/pag14.htm [eingesehen am 2.11.2009]), oder João Teixeira in seinem 1630 fertig gestellten Atlas. Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. IV, Estampa 464.
[61] Vgl. FN 58.
[62] Vgl. Heitzmann, Europas Weltbild 2006, S. 53.
[63] Vgl. Wagner, Sancho Gutiérrez 1951, S. 47–49, online mit einer Abbildung der Karte unter http://www.jstor.org/stable/1150051 (eingesehen am 2.11.2009) Sancho Gutiérrez stand von 1553 bis 1575 in Diensten der Casa de la Contratación. Sebastián Caboto zeigte 1544 keine durchgehende Linie, sondern markierte die Position der gedachten Linie durch ein spanisches und ein portugiesisches Fähnchen. Der Abstand zwischen beiden Fähnchen zeugt von der Unentschlossenheit des Kartographen. Bis 1548 befand sich Caboto in spanischen Diensten. Zur Karte vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 106f. oder unter: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:SCabot_Mapa_Swiata_1544.jpg (eingesehen am 2.11.2009). Zu Caboto vgl. auch Bitterli, Entdeckung Amerikas 2006, S. 126.
[64] Vgl. Weindl, Wer kleidet die Welt 2007, S. 84 und 162.
[65] 1602 wurde João Teixeira I zum Kartographen an der Armazéns da Casa de Guiné e India berufen. Lediglich sein Atlas von 1648 wurde mit der Bezeichnung Chef-Kartograph unterzeichnet. Nach 1649 sind keine Karten mehr aus seiner Feder bekannt. Vgl. Library of Congress, Hispanic and Portuguese Collections, An Illustrated Guide, online unter: http://www.loc.gov/rr/hispanic/guide/iberia.html (eingesehen am 2.11.2009).
[66] Die Karte trägt die Aufschrift: „Esta terra do Peru é Brasil he maes grosa do que nesta carta semostra por que só seteue respeito As derrotas da costa do Mar do Sul e do mar do Norte pera efeito da boa navegaçaõ“ zitiert nach Cortesão, PMC 1960, Bd. IV; Estampa 466 A. Die Weltkarte siehe Estampa 464.
[67] Seixas y Lovera war Kapitän der spanischen Flotte und Verfasser mehrere geographischer Werke. Der Atlas befindet sich heute in de Library of Congress in Washington. Auf den ersten beiden Seiten erklärt Seixas y Lovera die Umstände des Erwerbs des Atlasses unter Einsatz von „List und Geld“ und weist auf den zeichnerischen „Betrug“ der Portugiesen hin. Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. IV, S. 113f.; Virga, Cartographia. Mapping Civilizations 2007, S. 177f., wo sich eine Abbildung der beiden Karten befindet. Der Band enthält auch ein Bild der Karte, die Francisco Requenamit, der spanische Leiter der nach dem Vertrag von Ildefonso 1777 eingerichteten portugiesisch-spanischen Kommission zur Vermessung der Grenze in Südamerika anfertigte. Vgl. ebd., S. 188f.
[68] Vgl. Kahle, Lateinamerika 1993, S. 58–63.
[69] Von dieser Karte existiert nur noch eine spanische Kopie in dem Manifiesto legal, cosmografico, y historico en defensa del derecho de la Magestad Catolica del muy Soberano y Poderoso Rey de las Españas Don Carlos Segundo, y de la sente[n]cia pronunciada por sus Iuezes Comissarios Plenipotenciarios en veinte de Febrero de mil seiscientos y Ochenta y dos, en el Congresso de la dos Coronas de Castilla, y Portugal, celebrada en Badajoz para la decisión de la propriedad de las demarcaciones de la America. Y sobre la situación de la nueva Colonia del Sacramento, que à la margen Septentrional del Rio de la Plata embió a fundar el Serenissimo señor Principe D. Pedro Governador, y Regente del Reyno de Portugal, en el año passado de mil seiscientos y setenta y nueve […], c. 1682, indem sich der Autor über die Verwendung der Karte beklagt. Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. IV, Estampa 552, 562.
[70] Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón, S. 128f. Eine große Auflösung der Karte kann man unter http://www.wilhelmkruecken.de herunterladen (eingesehen am 2.11.2009). Zu Apian vgl. Wolff, America 1992, S. 61f. Vgl. hierzu auch Pieper, Vermittlung 2000, S. 157, die davon ausgeht, die portugiesischen Ansprüche seien über die Kartographen des Reichs tradiert worden. Das mag für die Vorstellung über die Verteilung der Landmassen zutreffen, für die politische Zuordnung kann dem nicht gefolgt werden.
[71] Frisius veröffentlichte seine Kosmographie in Antwerpen, der Atlas Honters erschien in Zürich. Vgl. Wolff, America 1992, S. 92–94. Zu Cabotos Karte vgl. FN 63. Möglicherweise entnahmen sie die Darstellung einem Atlas von Battista Agnese, ein Genueser, der 1535–1565 in Venedig arbeitete und dessen Karten viel zur Verbreitung der Kenntnisse über die neu entdeckten Gebiete beitrugen. Ihm dienten wohl Karten des in spanischen Diensten stehenden Kartographen Diego Ribeiro als Vorlage. Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón, S. 100–101. Zu Agnese vgl. eine Karte von 1541/42 aus dem Bestand der Münchner Hofbibliothek, BSB online unter: http://codicon.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00003259,00009.html?prozent=1 (eingesehen am 4.11.2009). Ob die Darstellungsart auf verschiedene Vorlagen zurückgeht oder auf eine bewusste politische Entscheidung der Kartographen, kann nicht entschieden werden.
[72] Vgl. Die Amerikakarte von Thomas Hood aus dem Jahr 1592, die angeblich auf den offiziellen spanischen Padrón Real zurückgeht, die Linie jedoch weit im Westen verzeichnet. Vgl. Wolff, America 1992; Cortesão, PMC 1960, Bd. III, Estampa 383B: Bartolomeu Lasso-Arnoldus Florentinus van Langren 1596, in: „Itinerario de Linschoten“, wo sich das südamerikanische Flusssystem in eine natürliche Grenze verwandelt hat. Eine französische Kopie einer portugiesieschen Karte aus dem Jahr 1670 übernahm kritiklos die Linie zwischen Rio de la Plata und „Baye de Vicent Pinson“. Vgl. ebd., Bd. V, Estampa 601.
[73] Manch ein im Auftrag der portugiesischen Krone zeichnender Kartograph kannte einen ikonographischen Unterschied in der Beziehung der portugiesischen Krone nach Übersee, der über den alternativen Gebrauch von Fähnchen und Wappen angezeigt wurde. Während die Fahnen Portugals, Kastiliens und gelegentlich auch Frankreichs Handels- oder Militärstützpunkte markierten, zeigten Wappen oft das Beanspruchen der Herrschaft über großflächige Territorien, häufig ohne saubere Grenzziehungen. Mit Halbmonden geschmückte Fähnchen bzw. Wappen wiesen auf eine islamische Herrschaft, ohne auf genauere Unterscheidungen Rücksicht zu nehmen. Interessant ist, dass die kartographische Darstellung der Besitzergreifung Amerikas mit Fähnchen begann, um sehr schnell prominent platzierten Wappen zu weichen, die an der iberischen Herrschaft über die Gebiete keinen Zweifel ließen. In Afrika und Asien findet man eine wesentlich differenziertere Darstellung durch Fähnchen und Wappen gemäß den (angenommenen) politischen Verhältnissen. Vgl z.B. Fernando Vaz Dourados Portulanatlas von 1580 (Alte Welt und Terra Nova) – BSB Cod.icon. 137, online unter http://codicon.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00003364,00010.html?prozent=1 (eingesehen am 9.11.2009). Allerdings gilt das nicht für alle Kartographen und auch nicht für alle Karten eines Autors, so dass die Interpretation ein bisschen spekulativ bleibt. Vgl. hierzu auch die Karte des Franzosen Guillaume Le Testu, Kartograph der Diepper Schule, der Drake auf seine Erdumsegelung begleitet hatte. Er verzeichnete Halbmondfähnchen an der nordamerikanischen Küste. Möglicherweise ein Hinweis auf die mangelnde Missionierung des Gebietes durch die Spanier und eine ikonographische Forderung, den Missionsbemühungen der Franzosen in Amerika stattzugeben. Vgl. Vizuete Villar, La Cartografía o.J., http://www.ub.es/hvirt/expo/javi/pag1.htm (eingesehen am 11.11.2009).
[74] Vgl. z.B. Die Weltkarten von Peter Plancius von 1590 online unter: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/1590_Orbis_Terrarum_Plancius.jpg (eingesehen am 3.11.2009) oder 1594 online unter http://shakingthetree.files.wordpress.com/2009/06/antique_map_plancius_world1.jpg (eingesehen am 3.11.2009); Arnold Florentin van Langren, Süd- und Mittelamerika, Amsterdam 1596, aus: Jan Huygen van Linschoten: Itinerario. Voyage ofte Shipvaert, abgebildet in Wolff, America 1992, S. 98f.
[75] Vgl. Herrera y Tordesillas Descripción 1622, Abbildung online unter Library of Congress: http://rs6.loc.gov/intldl/brhtml/images/tordes.jpg. Möglicherweise hängt die Art der Darstellung mit dem Druckort zusammen.
[76] Vgl. z.B. Plancius’ Karte von ca. 1630, online unter Chadwick (1992–2007), http://www.ianchadwick.com/hudson/images/plancius%201637.jpg (eingesehen am 3.11.2009).
[77] Vgl. z.B. die auf Henricus Hondius zurückgehende Karte „America Septentrionalis“ (Amsterdam) von Joannes Janssonius [1641], Abb., in: Heitzmann, Weltbild 2006, S. 135. Vgl. eine etwas andere Version von 1639, in: Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Collection numériques des cartes et des plans, online unter: http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp? app=ca.BAnQ.sdx.cep&db=notice&id=0000330544&n=4&f=lieu_nav&v=amerique_du_nord%23%23% 23Am%C3% A9rique+du+Nord&sortfield=titre_trie&order=ascendant&col=america&chpp=20&dbrqp=query_notice&qid=sdx_q0 (eingesehen am 3.11.2009).
[78] Vgl. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1570_Typus_Ortelius_mr.jpg (1570) oder http://www.swaen.com/antique-map-image-of.php?id=2067 (1579) (eingesehen am 4.11.2009).
[79] Vgl. Pieper, Vermittlung 2000, bes. S. 263.
[80] Vaz Dourado wurde in Goa geboren und wahrscheinlich entstand die Mehrzahl seiner Atlanten, die zu Repräsentationszwecken für politische Würdenträger gefertigt wurden, in Indien. Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. III, S. 3–8, Estampas 253, 260, 289, 295, 316, 336, siehe auch ein Beispiel online: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brazil_vaz_dourado.JPG; Für die Darstellung von 1580 (auch als Kunstmann IX bekannt) siehe BSB Cod.icon 137, http://codicon.digitale-sammlungen.de/Blatt_bsb00003364,3bv.html (eingesehen am 3.11.2009).
[81] Vgl. z.B. eine Karte Luís Teixeiras von ca. 1586, Abb. in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e dell’Istituto Universitario Europeo: La Cartografia europea tra Rinascimiento e Illuminismo, online-Ausstellung unter: http://www.bncf.firenze.sbn.it/notizie/Cartografia%20Web/Imperi/Portolano%2027/Texeira%20G.htm (eingesehen am 3.11.2009), außerdem Cortesão, PMC 1960, Bd. V, Estampa 526, Dominges Sanchez, Atlantikkarte von 1618, Estampa 527A; ders. Planisphäre von 1623, Estampas 533, 534: Pascal Roiz Atlantikkarte 1632, 1633, Estampas 547, 548 João Teixeira Albernaz II, Weltkarte 1665, Atlantikkarte 1667; Cortesão, Bd. III, Estampas 414A Anonym – Manuel Godinho de Erédia zugeschrieben, Weltkarte ca. 1615–1622, Estampa 426 Anonym – João Baptista Lavanha e Luís Teixeira zugeschrieben, 1597 und 1612, Atlas cosmografia; 459A Anonym – João Teixeira Albernaz I c. 1628 Atlas de vinte cartas, TYPUS ORBIS TERRARUM; Estampas 487, 495, João Teixeira I, Atlas do Brasil 1640. Derselbe João Teixeira schaffte 1642 die natürliche Grenze wieder ab als er die Teilungslinie westlich der Amazonasmündung schob, vgl. ebd., Estampa 499 A.
[82] Vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd I, S. 162. Für die portugiesische Kartographie siehe z.B. die Karten von António Pereira (ca. 1545), Lopo Homem (1554), Sebastião Lopes (1558), Bartolomeu Velho 1561, für die spanische Diego Gutiérrez (1550) siehe online: The European Library, Exhibitions, Treasures http://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition/treasures/geography/geography1.html (eingesehen am 4.11.2009).
[83] Cortés ignorierte mit seiner Namensgebung „Neu-Spanien“ die zuvorige Besitzergreifung des Landes durch Grijalva und schloss damit das Territorium direkt an die spanische Krone an, nicht ohne für sich den adelantado-Titel für das neue Gebiet zu erbitten. Die Besitznahme durch Grijalva hatte eine Abhängigkeit des Gebietes von Kuba bedeutet und damit eine diesem untergeordnete hierarchische Beziehung der Konquistadoren. Der Name „Neu-Spanien“ blieb unscharf, da er auf keine bestehenden politischen oder ethnischen Grenzen rekurrierte. Damit konnte Cortés das von ihm verwaltete Gebiet ausdehnen, ohne neue Rechtstitel aus Spanien erbitten zu müssen. Von der geographischen Einheit „Neu-Spanien“ hatte man weder in Spanien noch in Amerika zunächst eine klare Vorstellung. Vgl. Hinz, Hispanisierung 2005, S. 227– 230.
[84] Die Skizze stammt von 1527, online unter http://en.wikipedia.org/wiki/File:1527-TeraFlorida.jpg (eingesehen am 4.11.2009).
[85] Vgl. Verrazzanos Karte von 1529 in Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 88–91. Sebastian Münster nannte 1540 die Landmasse schlicht Francisca (eine Fassung von ca. 1550 vgl. online unter: Library of Congress, http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?gmd:1:./temp/~ammem_Z6Q6 [eingesehen am 11.11.2009], Ortelius Nova Franza [1564], Mercator Nova Francia [1569], Jodocus Hondius Nova Francia [1589] [vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 98–99, 122–123, 126–129, 132–135]). Eine von Plancius nach Vorlagen von Bartolomeu Lasso zwischen 1592 und 1594 gedruckte Karte enthält die Aufschrift: „Nova Francia alio nomine dicta Terra nova, anno 1504, à Britonibus primum detecta circa sinum S. Laurentij, & anno 1524. à Ioanne Verrazzano Florentino, qui ex portu Diepensi 17. Martij, solvens nomine Francisci Regia Galliarum ibidem appulit ad gradum 34. circiter latidudinis sive altitudinid Polus, plenius recognita usque ad promontorium dictum Cabo de Breton“ zitiert nach Cortesão, PMC 1960, Bd. III, Estampa 381A. Zur Verwendung der Bezeichnung bei den Portugiesen vgl. auch die 1615–1622 entstandene, Manuel Godinho de Erédia zugeschriebene Weltkarte, den bereits erwähnten Atlas von Luis Teixeira von 1630 oder das Werk João Teixeira Albernaz I. et al. ebd., Estampa 414A, 464, 482, 495. Noch Diego Ribeiro benannte in den 1520–30ern die Küste ausschließlich nach iberischen Entdeckern, in: Tierra de Garay, Ayllon/Estevã Gomez, Corte Real und Lavrador, auch wenn er auf die englische Beteiligung an der Entdeckung Labradors hinwies (vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 94 und Cortesão, PMC 1960 Bd. I, Estampa 41). Wahrscheinlich Antonio Perreira, portugiesischer Seefahrer und Kartograph, wies 1545 die Küste mittels Fähnchen den Franzosen zu, online unter: Brown University, Facilities, John Carter Brown Library, online-Exhibition „Portugal and Renaissance Europe“ http://www.brown.edu/Facilities/John_Carter_Brown_Library/Portugal/Images/Larger/Item25.jpg (eingesehen am 6.11.2009). Möglicherweise zeigten sich in portugiesischen Diensten stehende Kartographen gegenüber der Frage der Zugehörigkeit Canadas, das ja in spanischem Einflussbereich lag, im Gegensatz zu ihren „spanischen“ Kollegen indifferent. Nicolas Desliens Weltkarte von 1541 weist sowohl LA NOVELLE TERRE FRANCEZE als auch ein MER DE FRANCE auf. Optisch rückte er die Landmassen des französischen Amerikas in die Nähe und auf die Höhe Frankreichs. Vgl. Hantzsch/Schmidt, Kartographische Denkmäler 1903, Tafel II. Pierre Desceliers aus der Diepper Schule verzeichnete das ›Mer de France‹ vor der Küste Canadas, dessen Entdeckung er in der Legende Franz I. zuschrieb. Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 112– 115, online unter: Historical Atlas of Canada: Online Learning Project http://www.historicalatlas.ca/website/HACOLP/national_perspectives/exploration/UNIT_05/images/Desceliers_ Original_High.gif (eingesehen am 4.11.2009). Zum Zusatzartikel vgl. Truce between France and Spain, concluded at Vaucelles, February 5, 1516 [sic!]; separate article relating to the Indies and Savoy, in: Davenport, European Treaties 1917, S. 215–218.
[86] Vgl. die Karte des in London lebenden Italieners Baptista Boazio aus dem Jahr 1588. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S.140 –143, online unter: Library of Congress, Exhibitions, The Cultures and History of the Americas: The Jay I. Kislak Collection, http://www.loc.gov/exhibits/kislak/images/kc0025_1s.jpg (eingesehen am 5.11.2009).
[87] Der erste portugiesische Kartograph scheint 1632 Pascoal Roiz gewesen zu sein, vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. V, Estampa 533. Die Abbildung einer Karte desselben Autors von 1633 unter: Library of Congress, Map Collections, General Maps, http://memory.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl?data=/home/www/data/gmd/gmd9/g9111/g9111p/ct002332.jp2&itemLink=r?ammem/gmd:@field(NUMBER+@band(g9111p+ct002332))&title= [A+portolan+chart+of+the+Atlantic+Ocean+and+adjacent+Continents].&style=gmd&legend (eingesehen am 6.11.2009). Für andere portugiesische Darstellung vgl. Cortesão, PMC 1960, Bd. IV, Estampas 482, 506, Bd. V, Estampas 547, 548. Nur gelegentlich wurde Virginia über ein Fähnchen oder Wappen eindeutig dem englischen Machtbereich zugeordnet.
[88] Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 136–139, online unter: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roanoke_map_1584.JPG (eingesehen am 6.11.2009). Letztlich konnte Spanien die Anerkennung seiner Herrschaft „hinter der Linie“ nicht durchsetzen, gleichzeitig gelang es aber eine Erwähnung der beiden Indien in dem Vertrag zu vermeiden. Noch 1607 drang der spanische Botschafter in London auf die Aufgabe Virginias, stieß aber in England auf taube Ohren. Die Spanier beschlossen daraufhin, gemäß dem Vertrag, nicht mehr auf einen freiwilligen Rückzug zu drängen und das Problem militärisch durch die Armada de Barlovento zu lösen. Vgl. Weindl, Wer kleidet die Welt? 2007, S. 87–94, Archivo General de Simancas, Estado, Leg. 2513, 10.11.1607. Wir wissen nicht, ob die Karten seitens der englischen Verhandlungsführer als Beweise angeführt wurden, es ist aber durchaus vorstellbar, ebenso wie die Verwendung der bereits erwähnten Cosa-Karte oder der verschollenen Karte, welche die Cabots auf der Grundlage ihrer Entdeckungsfahrten 1497/98 gefertigt hatten.
[89] Vgl. FN 77.
[90] Vgl. Wolff, America 1992, S. 135.
[91] Vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 104–107.
[92] Vgl. Anonymus, Golf von Mexiko, Karibik, nördl. Südamerika 1536–1540, in: Wolff, America 1992, S. 55.
[93] Vgl. Weindl, Wer kleidet die Welt? 2007, S. 72–85.
[94] Vgl. Die Jodocus Hondius zugeschriebene Weltkarte mit dem Titel „Vera Totius Expeditionis Nauticae Descriptio […]“ London 1589, in: Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S.132–135. Die Karte erschien auch als Zugabe der 1599 in Frankfurt am Main gedruckten Reiseberichte von Theodor de Bry, online unter: State Library of New South Wales 2007 http://acms.sl.nsw.gov.au/album/albumView.aspx?itemID=861199&acmsid=0 (eingesehen am 9.11.2009). Zu den handkolorierten Kupferstichen Baptistas vgl. Nebenzahl, Atlas de Colón 1990, S. 140–143, außerdem die online-Ausstellung der Library of Congress, Exhibitions, The Cultures and History of the Americas: The Jay I. Kislak Collection unter: http://www.loc.gov/exhibits/kislak/kislak-exhibit.html (eingesehen am 9.11.2009).
[95] Vgl. Dünne, Operations- und Imaginationsmatrix 2008, S. 49–69.
ZITIEREMPFEHLUNG
Andrea Weindl, Von Linien und (Stütz-)Punkten – Kartographie und Herrschaft im Zeitalter der Entdeckungen, in: Martin Peters (Hg.), Grenzen des Friedens. Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne, Mainz 2010-07-15 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 4), Abschnitt 7–28.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/04-2010.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008061836>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 8 oder 7–10.
Martin Peters *
Friedensorte in Europa – Überlegungen zu einer Topographie vormoderner Friedensschlüsse
Gliederung:
2. Der Ort als Namensgeber des Friedens
3. Die vielen Orte des Friedens
4. Orts- und Raumbildung als Instrument der Friedensstiftung
Quellen- und Literaturverzeichnis
Text:
Wo wurde Frieden in der Frühen Neuzeit hergestellt? Lassen sich Orte, in denen Frieden verhandelt und beschlossen wurde, nach bestimmten raumbezogenen Kategorien systematisieren und beschreiben? Gab es Orte, in denen Frieden besonders häufig verhandelt wurde, und gab es bestimmte Regionen, in denen diese Friedensorte lagen, so dass sogar eine Topographie der vormodernen Friedensverträge skizziert werden könnte?
In der Geschichtswissenschaft wurden bislang Friedensorte und -regionen nicht systematisch untersucht. Zwar werden in Karten, in denen historische Strukturen visualisiert werden, auch diejenigen Plätze markiert, in denen es zu militärischen Auseinandersetzungen kam, aber ein historischer „Friedensatlas“, in dem speziell befriedete Orte und Räume präsentiert werden, liegt bisher nicht vor[1]. Auch existiert ein Repertorium der Diplomaten[2], aber keines der Friedensorte. Auf die historische Friedensforschung haben dezidiert raumbezogene Perspektiven und Forschungsinteressen bislang keinen erkennbaren Einfluss ausgeübt. Dieser Befund ist deshalb erstaunlich, weil Carl Schmitt mit seinem Werk Der Nomos der Erde den zumindest völkerrechtlichen Diskurs schon 1950 eröffnete[3]. Orte und Räume werden nicht nur in den Medien – Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen – sprachlich konstruiert, sondern auch in Zeugnissen der Diplomatie und Wissenschaft. Kürzlich hat Antje Schlottmann aufgezeigt, dass über die Kategorie der „RaumSprache“ der Zusammenhang von Raum, Sprache und gesellschaftlicher – und damit auch historischer – Wirklichkeit nachvollzogen werden kann[4].
Der Fokus von Schlottmann liegt auf aktuellen politischen Ereignissen – nämlich der deutschen Wiedervereinigung – und das von ihr entwickelte Analyseinstrument kann auch für die Frühe Neuzeit fruchtbar gemacht werden. Friedensverträge, Verhandlungsprotokolle, Diplomatentagebücher sind Quellen, die zur Analyse raumbezogener Metaphern gut geeignet sind, zumal hierzu bereits begriffsgeschichtliche Studien vorliegen[5].
29
Hinsichtlich einer Topographie von Friedensorten könnte die „Geographische Konfliktforschung“ wichtige Beiträge leisten, die jedoch nicht die räumliche Friedenswahrung und -stiftung, sondern gerade die räumliche Auseinandersetzung, etwa um Grenzen, im Blick hat. Auch zur „Friedensgeographie“, die gerade im Aufbau befindlich ist, mit ihrem dezidiert ethischen Bezug könnten Schnittstellen entwickelt werden, zumal sie auch den natur- und sozialräumlichen Aspekt der Friedensforschung aufgreifen will[6]. Doch weder die „Geographische Konfliktforschung“ noch die „Friedensgeographie“ arbeiten bislang historisch.
Was könnte raumbezogene historische Friedensforschung bedeuten? An dieser Stelle kann zwar nicht annähernd ein ausgereiftes Programm für eine auf die Frühe Neuzeit fokussierte raumbezogene Friedensforschung entwickelt werden, doch sollen einige Aspekte und Fragestellungen für einen konzeptionellen Rahmen ausgeführt werden.
Raumbezogene Maßnahmen frühneuzeitlicher Friedenspolitik waren Landerwerb, Ländertausch, Landkompensationen und Arrondierung. Informationen über befriedete Räume, Orte und Grenzen sowie über deren Aufbau, Ausbau oder auch Abbau lassen sich in Friedensverträgen und diplomatischen Unterlagen herausschälen. Zu untersuchen wäre die Frage, was diese Grenzziehungen und -verschiebungen im Friedensprozess der Frühen Neuzeit bewirkten und, damit in Zusammenhang, inwieweit sich daraus friedenswahrende Motive herausfiltern lassen. Die Genese und Konstituierung „friedlicher“ – privilegierter – Räume in Krisenregionen, in denen Identität aufgebaut und politische Stabilität erreicht wurde, wäre dabei eine zentrale Frage raumbezogener Friedensforschung.
Darüber hinaus ginge es um die Frage, welche Kenntnisse von Räumen und Orten die am Friedensprozess beteiligten Akteure besaßen und woher sie ihr Wissen und Un-Wissen bezogen. Anders gefragt: Welche Selbsteinschätzungen, Profilierungen und welche Fremdwahrnehmungen bestanden am „Verhandlungstisch“? Welche Regionen und Orte waren warum interessant? Inwieweit wurden Kenntnisse über Räume während des Friedensprozesses vermittelt, bewusst abgelehnt oder in Abrede gestellt? Deckten sich die Raumvorstellungen der Vertragspartner oder gab es Missverständnisse? Wenn ja, wie wurden diese Kommunikationsblockaden gelöst?
Es geht hierbei also um die Frage, wie einzelne Orte, Regionen, Länder und Staaten in Europa in der vormodernen Diplomatie und „Wissenschaft“ bewertet, qualifiziert und konstruiert wurden, ferner um die Fremd- und Selbstbeschreibung dieser Orte und Räume im Friedensprozess sowie um die Untersuchung von Effekten raumkonstitutiver Metaphern auf die Gestaltung und Strukturierung von Wirklichkeit im vormodernen Friedensprozess.
30
Als Ausgangspunkt für die systematische Erforschung von Friedensräumen und -orten wären Raumbilder und raumbezogene Metaphern zu untersuchen. Als fruchtbar für die Analyse vormoderner Friedensverträge und -verhandlungen könnte sich z.B. die „Nachbarschaft“ erweisen, die nicht nur eine räumliche Qualität, nämlich die geographische Position, sondern auch eine spezifische zwischenstaatliche Beziehung beschreibt[7]. Gerade eine friedenshistorische Analyse europäischer Bündnisse kann ohne den sprachlich, symbolisch konstruierten Raumbezug nicht auskommen[8].
Der Grund dafür, dass in der Forschung die frühneuzeitlichen Friedensorte nur wenig beachtet wurden, könnte darin zu finden sein, dass erst seit Bestehen der Mainzer online-Datenbank „Europäische Friedensverträge der Vormoderne“, die zwischen 2005 und 2010 aufgebaut wurde, eine empirische Basis für eine solche Analyse vorliegt[9]. Denn im Rahmen dieses Projektes wurden erstmals die europäischen Friedensorte der Frühen Neuzeit identifiziert. Zwar sind noch nicht alle europäischen Friedensverträge erschlossen – die rumänische Überlieferung fehlt beispielsweise noch – doch für die hier zu erörternde Themenstellung – wo wurde Frieden in der Zeit zwischen 1450 und 1789 geschlossen? – liegt nun ein repräsentatives Arsenal von 500 europäischen Friedensorten vor.
31
2. Der Ort als Namensgeber des Friedens
Internationale sowie europäische Verträge wurden und werden noch – zuletzt der in Lissabon am 13.12.2007 geschlossene – durch das Datum der Unterschriften und den Ort identifiziert, an dem der Vertrag unterzeichnet wurde. Der Ort des Friedens ist im Friedensvertrag expressis verbis erfasst und gibt dem Frieden seinen Namen. In der Präambel des Friedensvertrags von Utrecht zwischen Frankreich und den Generalstaaten heisst es beispielsweise – und diese Formulierung ist durchaus üblich gewesen –, dass die Vertragspartner „ont consenti que la ville d’Utrecht fut choisie pour y traiter de paix, […]“[10]. Im Friedensvertrag von Nijmegen wird die in der Friedensstadt vollzogene völkerrechtliche Handlung – gegenseitiger Austausch der Vollmachten und deren Inserierung in den Vertragstext – näher beschrieben. Dort heißt es:
„Lesquels Ambassadeurs Extraordinaires et plenipotentiaires deüement instruits des bonnes intentions de leurs Maistres se seroient rendus en ladite Ville de Nimegue. Ou apres une reciproque Communication des pleins pouvoirs dont à la fin de cet traitté Les copies sont inseréés de mot a mot, seroient convenus des Conditions de Paix et d’amitié en la teneur qui ensuit“[11].
Während die Stadt Lissabon im Jahre 2007 in ihrer Funktion als Hauptstadt des die Ratspräsidentschaft der EU ausübenden Staates Portugal festgelegt war, handelte es sich in der Vormoderne hingegen nicht selten um einen komplexen Entscheidungsprozess der Vertragspartner.
Um die frühneuzeitlichen Friedensorte identifizieren zu können, muss geklärt sein, welche Urkunden als Friedensverträge bezeichnet werden. Dabei lässt sich durchaus über die Definition von vormodernen Friedensverträgen streiten. Können Friedensverträge und europäische zudem überhaupt sinnvoll erfasst werden? Konsens kann erzielt werden bei Friedenskongressen wie dem Westfälischen Frieden von 1648, der den 30jährigen Krieg in weiten Teilen beendete. Wie aber sieht es mit den vielen Verträgen, Allianzen und Bündnissen aus, die gegen eine bestimmte Dynastie und ein bestimmtes Gemeinwesen gerichtet waren? Kann auch der Polnischen Teilung von 1772 das „Label“ Europäische Friedensverträge der Vormoderne zugewiesen werden.
32
Die Frage, inwieweit Verträge, Allianzen und Bündnisse stets Frieden beförderten oder – was sehr häufig der Fall war – als Bestandteile von Machtinteressen gedeutet werden müssen, gehört in den Bereich der Auswertung, nicht der Erschließung der frühneuzeitlichen Friedensverträge. Als Friedensverträge werden daher alle Verträge zwischen zwei verschiedenen Dynastien und Gemeinwesen bezeichnet, die expressis verbis – zumeist in der Präambel – das Ziel benennen, Frieden befördern oder Kriege beenden zu wollen.
Das Beispiel der Polnischen Teilung stellt, wie auch der sogenannte Erste Rheinbund von 1658, aus einem anderen Grund eine Ausnahme dar. Denn in beiden Fällen wird der Vertrag nicht über den Ort identifiziert. Nach dem völkerrechtlich anerkannten Schema, dass Datum und Ort den Friedensvertrag benennen, wäre der Erste Rheinbund von 1658, der in Frankfurt/Main signiert wurde, als Allianzvertrag von Frankfurt/Main vom 14.8.1658 und die Erste Polnische Teilung von 1772 als Teilungsvertrag von St. Petersburg vom 25.7. (5.8.) 1772 zu bezeichnen.
Die Stadt wird mit dem Friedensvertrag und dessen Bestimmungen identifiziert. Wo dies nicht der Fall ist, treten die Städte in den Hintergrund. Ein weiteres – gut bekanntes – Beispiel dafür sind die Friedensverträge von Osnabrück und Münster vom 24.10.1648, die auch als Westfälischer Frieden in die Geschichte eingingen. Namensgebend waren hier nicht etwa die Akteure – denn an dem Kongress nahmen nahezu alle europäischen Dynastien und Gemeinwesen direkt oder indirekt teil – sowie auch nicht die beiden Friedensorte, sondern die Territorien, in denen die beiden Friedensorte lagen und die dem Westfälischen Reichskreis angehörten. Die eigentlichen Friedensorte traten damit in den Hintergrund.
Einige Städte werden so sehr mit den dort vereinbarten Friedensverträgen identifiziert, dass sie mit dem Etikett „Friedensstadt“ versehen werden, z.B. die Städte Osnabrück und Münster. Auch Augsburg, Aachen und Genf sind Städte, die sich als „Friedensstädte“ bezeichnen, weil hier Friedensverträge in der Frühen Neuzeit abgeschlossen wurden. Es gibt noch weitere europäische Friedensstädte, nämlich Tübingen, Linz und Reims, die aus ganz unterschiedlichen Motiven und historischen Kontexten als Friedensstädte ausgewiesen werden. Darüber hinaus wurden auch Orte gegründet, die man, um ihnen symbolische Bedeutung beizumessen, Friedensstadt taufte, etwa Jerusalem (Salem = Schalom), Bagdad (genannt die Friedensstadt), der Herrnhuter Missionsort Langundoutenünk (= Friedensstadt, USA), viele amerikanische Ortschaften namens Salem oder auch der Ort Friedensstadt/Ortsteil Glau in Brandenburg.
Durch die Festlegung eines Ortes als Verhandlungsort veränderte sich dieser, häufig schon, bevor die Friedensverhandlungen einsetzten – für Osnabrück z.B. ist dies sehr gut erforscht[12] –: rechtlich z.B., indem er als eine Neutralitätszone deklariert wurde[13], durch die Einrichtung temporärer „Bannmeilen“, sowie auch ökonomisch und architektonisch.
33
Friedensorte – vor allem europäische Kongressorte – symbolisieren und benennen historische Sachverhalte, etwa eine spezifische Situation. „In den Grenzen des Friedens von“ beispielsweise ist ein Topos, der eine Momentaufnahme in der Geschichte eines Staates beschreibt, und über dessen territorialen Umfang seine Identität. „Frankreich in den Grenzen des Friedens von Lunéville“[14] (1801 II 9) dahinter verbirgt sich z.B. die Inklusion aller linksrheinischen (bis dahin auch reichsständischen) Gebiete in den französischen Herrschaftsbereich. Die Städte spiegeln gleichsam als Erinnerungsorte mitunter den Friedensvertrag und seine Folgen wider und besitzen einen Bezug zum Inhalt und historischen Kontext des Vertrages.
Der Friedensvertrag von Nimwegen (1679 II 05) zwischen Frankreich, dem Kaiser und dem Deutschen Reich z.B. wurde damals von deutschen Zeitgenossen – spöttisch – umbenannt in den „Frieden von Nimmweg“, weil deutsche Orte (z.B. Kehl) der französischen Krone zugesprochen wurden. Wie sehr Weltanschauungen und politische Handlungsdirektiven aus Friedensverträgen gerechtfertigt wurden, zeigt – über die Frühe Neuzeit hinaus – besonders der Friedensvertrag von Versailles (1919), der zu einem Medienereignis und zu einer parteipolitischen Parole umgeformt wurde[15]. Für eine gewisse Zeit war der Friedensort „Versailles“ ein propagandistisches Schlagwort.
Dass der Abschluss eines Friedensvertrages in einer Stadt oder Gemeinde auch heute noch von besonderer Bedeutung für ihre Geschichte und ihr Selbstverständnis ist, zeigen zwei Initiativen. Seit 2007 besteht eine in Evora Monte (Portugal) gegründete Initiative „Places of Peace“, an der auch der Freundeskreis Schloss Hubertusburg teilnimmt und dem Ziel verpflichtet ist, diejenige Orte ins Bewusstsein zu rücken, an denen Friedensverträge abgeschlossen wurden[16]. Ebenso verbindet ein anderes europäisches Vorhaben namens „La Strada Lubecca–Roma: un percorso storico verso la Pace“ ausgewählte Friedensorte miteinander. Die Organisatoren versprechen sich von diesem Vorhaben, das auf historischen Routen und Pilgerstraßen gegründet ist, die verstärkte Ausbildung einer europäischen Identität[17].
34
3. Die vielen Orte des Friedens
Eine einzige Stadt, in der eine Dynastie grundsätzlich Friedensverhandlungen durchführte, geschweige denn eine Stadt, auf die sich mehrere europäische Dynastien generell für die Austragung von Friedensverhandlungen einigten, gab es in der Frühen Neuzeit nicht. Vielmehr läßt sich eine Vielzahl von Friedensorten identifizieren.
In der Zeit zwischen 1450 und 1789 wurden über 2.000 zwischenstaatliche Friedensverträge an über 500 Friedensorten abgeschlossen. Grundlage dieser Quantifizierung ist die Mainzer Datenbank, in die alle zwischenstaatlichen Verträge mit dem erklärten Ziel der Friedenswahrung aufgenommen wurden, also auch Bündnisse, Allianzen, Grenz-, Heirats-, Handelsverträge, Familienpakte, Waffenstillstände, Präliminarverträge, Erbfolgeregelungen und viele mehr. Nicht aufgenommen werden konnten hingegen – aus Ressourcegründen – Religionsfrieden und diejenigen Friedensverträge, die nur zwischen deutschen Reichsständen geschlossenen wurden, sowie Kolonialverträge.
Es gab wohl kaum ein Jahr, in dem nicht irgendwo in Europa über Frieden verhandelt wurde. Viele Friedensorte wurden nur einmal ausgewählt. Der westlichste europäische Friedensort dieses Zeitraums ist Lissabon (Portugal), der östlichste Waluiki (Russland), der nördlichste Wyborg (Russland) und der südlichste Nizza di Sicilia (Italien).
Auf dem Tableau frühneuzeitlicher Friedensorte finden sich Residenzstädte, Bischofssitze, Burgen, Verwaltungs- und Handelsstädte sowie Festungen, Adelssitze und Abteien. Nicht nur die Städte wurden als Friedensorte in den Friedensverträgen erwähnt, sondern auch die Räumlichkeiten, vor allem Schlösser, wie Laxenburg, Hubertusburg, Rosendale, Stegeborg, Jægersborg und viele andere. Im Friedensvertrag von Rijswijk wird in der Präambel dezidiert ausgeführt, dass die Verhandlungen im Schloss von Rijswijk stattfanden[18]. Der Vertrag von Paris 1783 zwischen Großbritannien und Nordamerika wurde im Pariser Hotel d’York unterzeichnet.
Darüber hinaus wurden in den Friedensverträgen auch entlegene Orte wie Inseln, man denke an die Fasaneninsel, dem Friedensort des Pyrenäenfriedens von 1659, oder auch Berge aufgeführt, wie der Berg Suchet in der Schweiz[19]. Auch der Grosse St. Bernhard[20] mit seinem Hospiz und der Turm Montilis-le-Tours[21] waren Orte, in denen Friedensverträge unterzeichnet wurden.
35
Weder die Größe eines Ortes noch das Alter oder die Tradition der Stadt korrespondierten mit der Bedeutung des Friedensvertrages. Stattdessen bestimmten politische, verkehrstechnische, konfessionelle, militärstrategische, repräsentative und symbolische oder auch pragmatische Motive die Wahl des Platzes, an dem ein Friedensvertrag abgeschlossen werden sollte.
Heinz Duchhardt hat erstmals Kategorien für die Auswahl europäischer Kongressorte der Frühen Neuzeit formuliert und einen Katalog von „essentials“ zusammengestellt, die die Wahl eines Kongressortes bestimmten: a) es musste die Möglichkeit gegeben werden, seinen Gottesdienst auszuüben, ausgeschlossen waren Städte mit hohem symbolischen Gehalt; b) es musste eine Anbindung an bestehende Verkehrswege und Kommunikationseinrichtungen vorhanden sein; c) die äußere und innere Sicherheit sowie Immunität der Diplomaten musste garantiert werden können; d) die Möglichkeit, sich von Publikum und Medien zurückzuziehen, musste geschaffen werden können; e) Städte mit besonders viel optischen Reizen und Unterhaltungswert galten als ungeeignet[22]. Rom, dem Zentrum des (katholischen) Christentums, London, wo eine neue anglikanische Kirche gegründet wurde, sowie auch Madrid und Wien, die damaligen Schaltzentralen der deutschen Kaiser aus dem Haus Habsburg, waren für die Durchführung europäischer Friedenskongresse nicht konsensfähig. Freilich wurden in diesen Residenzstädten dennoch Friedensverträge ausgehandelt, wie noch gezeigt werden soll.
Während Duchhardt bewusst nur die dreizehn europäischen Kongressorte im Blick hat, sollen im Folgenden darüber hinaus sämtliche in der Mainzer Datenbank erfassten europäischen Friedensorte berücksichtigt werden, wo bi- und multilaterale Friedensverträge abgeschlossen wurden. Dabei lassen sich folgende Kategorien unterscheiden: Europäische Kongressorte, Residenzstädte, Grenzorte und schließlich „kleine“ und „Nicht-Orte“.
36
Zu den Friedensorten, an denen in dieser Zeit Konferenzen mit europäischer Wirkmächtigkeit stattfanden, gehörten Cateau-Cambrésis (1559)[23], Vervins (1598)[24], Osnabrück/Münster (1648)[25], Nimwegen (1678), Rijswijk (1697)[26], Utrecht (1713)[27], Nystad (1721)[28], Soissons (1728–1731)[29], Aachen (1748)[30] und Hubertusburg (1763). Auch die Friedensverträge von Paris/Versailles (1783) gehören in diese Kategorie. Das Friedensortpaar Paris/Versailles bildet jedoch eine Ausnahme. Zwar waren die europäischen Mächte Großbritannien, Frankreich, Spanien und die Niederlande sowie als Vermittler Habsburg und Russland daran beteiligt. Es ging jedoch um außereuropäische Inhalte, nämlich die Beendigung des Nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieges.
Fünf Friedensorte waren französisch (Cateau-Cambrésis, Vervins und Soissons, Paris/Versailles), vier deutsch (Osnabrück, Münster, Aachen, Hubertusburg), drei niederländisch (Nimwegen, Rijswijk, Utrecht) sowie ein Ort schwedisch (Nystad; heute finnisch). Damit konzentrierte sich damals die Auswahl der europäischen Kongressorte auf einige wenige Regionen. Großbritannien, Dänemark, Spanien, Italien, Russland und das Osmanische Reich beherbergten keinen Kongress europäischen Ausmaßes. Ganz offenbar entschied man sich damals für Friedensorte auf dem kontinentalen Festland im „Zentrum“ Europas.
Von diesen dreizehn Friedensstädten finden sich fünf ehemalige Kaiser-, Königs- und Bischofssitze: Paris, Soisson, Aachen, Münster, Osnabrück und Utrecht. Auch Nimwegen, eine Hansestadt und Handelsmetropole, war einst eine Pfalz, allerdings schon in ottonischer Zeit. Rijswijk, Hubertusburg und Vervins wiesen keine besondere historische Tradition auf. Rijswijk war ein Ausflugsort in der Nähe Den Haags und beheimatete den oranischen Palast „Haus ter Nieuwburg“. Hubertusburg war der Name eines Schlosses, eines sächsischen Jagdschlosses, das erst 40 Jahre vor dem Friedensvertragsabschluss erbaut worden war. Für Cateau-Cambrésis, ferner für Vervins, eine verkehrsgünstig gelegene Kleinstadt, die im Laufe der Zeit sowohl von Engländern als auch von Franzosen und Spanien beansprucht wurde, und für Nystad, einer damals noch jungen, erst 1617 gegründeten Hafenstadt, sprach die geographische Lage. Vervins z.B. wurde erst durch den Friedensvertrag von 1598 bekannt. In einer französischen Enzyklopädie heißt es über Vervins:
„[…] petite ville de France, dans la haute-Picardie […] sur une hauteur au bord de la Serre, à 42 li. de Paris. Elle a le titre de châtelenie & de marquisat, & elle est fameuse par le traité de paix qui s’y conclut en 1598, entre Henri IV, roi de France, & Philipps II, roi d’Espagne. Ses marches de bled sont assez concidérables“[31].
Dass der Vertrag nicht immer dort signiert wurde, wo er verhandelt wurde, zeigt das Beispiel des Friedensvertrages von Cateau-Cambrésis. Denn zunächst trafen sich die Bevollmächtigten im Kloster Cercamp in Frévent am Ufer des Flusses Canche im Norden Frankreichs (Nord-Pas-de-Calais), gut 100km westlich vom späteren Friedens- und Vertragsort. Aus verschiedenen Gründen – der Tod Marie Tudors, die unterschiedlichen Positionen zur Restitution Calais’ – wurden die Verhandlungen unterbrochen und nach der Inthronisation Königin Elisabeths in Cateau-Cambrésis fortgeführt. Alphonse De Ruble beschreibt die Wahl des neuen Friedensortes. Seiner Darstellung zufolge besaßen beide Friedensorte keineswegs komfortable, repräsentative Ausstattungen:
„Dès les premiers jours de janvier [1559], les ambassadeurs cherchèrent un lieu de rendez-vous. On ne povait songer à Cercamp, abbaye délabrée, inhabitable pendant l’ hiver, ni à Cambrai, ville pleine de gens de guerre. La duchesse douairière de Lorraine proposa Cateau-Cambrésis. L’évêque de Cambrai y possédait un château démeublé et sans fenêtre. On y pourvut „en faisant faire, à grande diligence, fenestres de papier en chassis de latteaulx“. Ces reparations furent menées avec negligence et parcimonie. Les ambassadeurs arrivèrent à Cateau-Cambrésis dès les premiers jours de février; ils s’y trouvèrent plus mal qu’à Cercamp“[32].
Der Vorstellung von einer idealen europäischen Friedensstadt entsprach im frühen 18. Jahrhundert Utrecht, das jedenfalls war die Ansicht des Abbé de St. Pierre im Jahre 1713. Er war davon überzeugt, dass der geeignete zentrale Friedensort – ihm ging es dabei um die Etablierung einer europäischen Versammlung – in den Niederlanden zu liegen habe. Er begründet dies mit dem Handelsgeschick der Holländer sowie mit der Unabhängigkeit der Generalstaaten von monarchischen Einflüssen sowie ihrer religiösen Toleranz. Zugleich hat er das Wohlbefinden der Diplomaten und Bevollmächtigten im Auge. Er schreibt:
„Entre toutes les Villes de Hollande, Utrecht semble préférable aux autres. Elle est une de celles où les eaux sont les meilleires, & où l’air est le plus sain […] Utrecht peut être commodément fortifié; on peut même aisémemt y faire une nouvelle enceinte, où séront les Palais des Sénateurs, les Magazins & les Citadelles“[33].
Einige der genannten europäischen Kongressorte symbolisieren einen spezifischen Zustand des frühneuzeitlichen Staatensystems und sie stellen Epochengrenzen der Geschichte Europas dar. Damit sind sie ein wichtiger Baustein für die Profilbildung Europas. Heinz Schilling gliedert das frühneuzeitliche Mächteeuropa in vier Zeiträume, deren Zeitgrenzen er durch Friedensverträge veranschaulicht. Der Friede von Cateau-Cambrésis (1559) stellt bei ihm den Endpunkt der Zeit des habsburgischen Universalismus dar. Der Westfälische und Pyrenäenfrieden (1648/59) markieren den Endpunkt der spanischen Hegemonie. Der Friede von Nystad (1721) beschließt nach Schilling das sogenannte Westfälische Friedenssystem. Der Hubertusburger Friede (1763) schließlich bezeichne seiner Ansicht nach den Zenit des Balance-of-Power-Systems[34].
37
Auch in der Geschichte und Statistik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts wurde die europäische Geschichte nach den Kategorien Hegemonie und Gleichgewicht sortiert. Dabei wurden Staaten als Absteiger – z.B. Spanien und das Osmanische Reich – oder auch Aufsteiger – beispielsweise Preußen – beschrieben. Um die Einteilung der europäischen Geschichte nach Friedensverträgen, nach Hegemonie und Gleichgewicht, bemühte sich um 1800 der Göttinger Historiker Johann Gottfried Eichhorn[35]. Eichhorn sah das Gleichgewichtsprinzip als wirksames Instrument an, den Frieden in Europa zu erreichen.
In diesen Zusammenhang der hierarchischen Strukturierung Europas und Charakterisierung einzelner Gemeinwesen gehört auch die Unterscheidung von Alt- und Neu-Europa, raumzeitliche Begriffe, die eine eigene Geschichte besitzen. Während Heinz Schilling Alt-Europa mit dem Wiener Kongress beendet sieht, wurde in der kulturhistorisch akzentuierten Historie des 18. Jahrhunderts die Phase zwischen Mittelalter und Neuzeit als Epochenschwelle begriffen. Dabei wurde stets einzelnen Staaten und Gemeinwesen eine besondere herausragende und stabilisierende Funktion im Friedens- und Modernisierungsprozess zugesprochen.
August Ludwig Schlözer (1735–1789) zum Beispiel entwickelte schon 1787 das Programm eines Alt- und Neu-Europas. Er setzte den Epochenwechsel vom alten zum neuen Europa ins 15./16. Jahrhundert. Reformation, Aufklärung, Erfindungen und Entdeckungen dieser Zeit waren für ihn die Grundsäulen für das neue Europa. Die einzelnen Phasen werden bei ihm von – wechselnden – Dynastien, Staaten oder Gemeinwesen geprägt, denen er damit eine leitende Rolle zuweist. Neu-Europa war bei ihm geprägt durch Nachhaltigkeit und Stabilität. Diese neue friedliche Ordnung wurde seiner Ansicht nach durch das auf Friedensabkommen beruhende System des Gleichgewichts erreicht[36].
38
Häufiger Austragungsort von Friedensverhandlungen waren fürstliche und republikanische Residenzstädte, die Schaltzentralen der damaligen Dynastien und Gemeinwesen.
Die meisten Friedensschlüsse in der Frühen Neuzeit – jedenfalls seit dem frühen 17. Jahrhundert – wurden nicht in dem von St. Pierre favorisierten Utrecht, sondern in Den Haag (’s-Gravenhage) geschlossen. Im Folgenden soll auf der Grundlage der Mainzer Friedensvertragsdatenbank ein ungefährer Eindruck darüber vermittelt werden, wie häufig Herrschaftszentren als Orte des Friedens ausgewählt wurden. Die angegeben Zahlen können zum jetzigen Zeitpunkt der Recherchen freilich nur eine Tendenz anzeigen. Seit 1648 fungierte Den Haag als Residenzstadt der Statthalter der Republik. 147 Verträge wurden hier in der Zeit zwischen 1618 und 1781 signiert. 20 Friedensverträge davon kamen vor dem Westfälischen Frieden zwischen 1621 und 1647 zustande. In Den Haag trafen sich in diesem Zeitraum fast alle größeren und kleineren europäischen Mächte zu bi- und/oder multilateralen Verhandlungen mit den Generalstaaten: der Kaiser, Österreich, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Dänemark, Portugal, Brandenburg-Preußen, Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Köln, Pfalz, Pfalz-Neuburg, Münster, Osnabrück, Paderborn, Lübeck, Schleswig-Holstein-Gottorf, Hessen-Kassel, Sachsen-Gotha, Sachsen-Weimar, Bern, Graubünden, Lothringen, Savoyen-Piemont, Venedig, Sardinien-Piemont und Neapel-Sizilien. Auch nicht-staatliche Akteure wie die Reichskreise, Ostfriesland und die Hanse reisten nach Den Haag zu Friedensverhandlungen. Nicht in Den Haag hingegen verhandelten in diesem Zeitraum die europäischen Mächte Russland, Polen, Siebenbürgen und das Osmanische Reich.
Während in Rijswijk, Utrecht und Nimwegen europäische Friedenskonferenzen durchgeführt wurden, an denen auch die Generalstaaten teilhatten, und hier weder vorher noch nachher weitere Friedensverhandlungen abgehalten wurden, bildete Den Haag insofern eine Ausnahme, dass hier Vertragsabschlüsse zustande kamen, an denen die Generalstaaten selbst nicht beteiligt waren: am Bündnis zwischen Preußen und Schweden vom 19/29. VII 1703, am Waffenstillstand zur See zwischen Frankreich, Großbritannien und Spanien vom 29. II. 1720, am Waffenstillstand zur See zwischen Frankreich, Großbritannien, Sardinien-Piemont und Spanien vom 2. IV. 1720, an der Konvention zur Erbfolge in Jülich und Berg zwischen Frankreich und Preußen vom 5. IV. 1739 sowie am Geheimen Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Dänemark und Spanien vom 22. IX. 1757.
39
Gemessen an der Anzahl der Vertragsschlüsse sticht – Den Haag ausgenommen – die Residenz der französischen Könige in Versailles mit 98 Verträgen heraus, die im Zeitraum zwischen 1674 und 1787 signiert wurden. In Paris wurden zum Vergleich 80 Verträge zwischen 1559 und 1786 signiert. Paris blieb damit neben Versailles wichtigster Friedensort. Auch in der schwedischen Residenzstadt Stockholm wurden schon im 16. Jahrhundert Friedensverträge abgeschlossen und zwar zwischen 1534 und 1766 55 Verträge. Ebenfalls 55 Friedensverträge wurden in der kaiserlichen Residenzstadt Wien und zwar zwischen 1515 und 1770 abgeschlossen. Hier erschienen im Laufe der Zeit die Abgesandten einer Reihe europäischer Herrscher, Republiken und Stadtstaaten, wie Frankreich, Russland, Polen, Schweden, Generalstaaten, Venedig, Hannover, Sachsen-Polen, Bayern, Köln, Lothringen, Ungarn, Siebenbürgen, Böhmen, Graubünden, Sardinien-Piemont und dem Deutschen Reich sowie auch dem Osmanischen Reich. Im dänischen Kopenhagen wurden zwischen 1532 und 1769 ebenfalls 55 Verträge signiert. In der Residenzstadt der Fürsten von Savoyen, Turin, wurden zwischen 1574 und 1773 gut 45 Friedensverträge vereinbart. In Rom wurden zwischen 1455 und 1754 47 Friedensverträge signiert.
In London wurden zwischen 1510 und 1763 29 Friedensverträge abgeschlossen, dazu wurden weitere 22 in Westminster, acht in Whitehall sowie vereinzelt Verträge auch in Windsor, Kensington, Hampton Court und St. James abgeschlossen. In Mailand, Bischofssitz und Residenzstadt der Sforza, wurden zwischen 1454 und 1785 32, in Luzern, dem Vorort der katholischen Kantone der Eidgenossenschaft und Residenz des päpstlichen Nuntius, zwischen 1467 und 1705 28 internationale Verträge zur Friedenswahrung abgeschlossen.
In Berlin wurden zwischen 1682 und 1779 24 und in Cölln an der Spree zwischen 1529 und 1709 20 Verträge ausgehandelt. Potsdam erscheint als Friedensort in dieser Zeit nicht. Auch in Frankfurt/Main wurden zwischen 1489 und 1748 und ebenso in Madrid und El Pardo wurden zwischen 1526 und 1786 jeweils ca. 20 Verträge abgeschlossen. Für Warschau konnten zwischen 1585 und 1786 16 und für Lissabon zwischen 1522 und 1766 13 Verträge identifiziert werden. Hannover mit dem Schloss Herrenhausen liegt mit 17 Verträgen zwischen 1672 und 1750 sogar noch vor der polnischen und portugiesischen Residenzstadt. Allerdings erscheint Hannover recht spät und nur für kurze Zeit auf der internationalen Bühne. In München wurden zwischen 1670 und 1762 15 Verträge abgeschlossen, in Venedig zwischen 1451 und 1769 17 und in Genua, dem Regierungssitz der Dogen, zwischen 1450 und 1789 11 Verträge.
Auch das Osmanische Reich war ein Faktor im europäischen Staatensystem. Zwischen 1498 und 1784 sind knapp 50 Friedensverträge mit christlichen Mächten überliefert und zwar mit Frankreich, dem Kaiser, Polen, Russland, Schweden, Dänemark, Venedig, Genua und Spanien. Abgeschlossen wurden die Verträge vor allem auf dem Gebiet der heutigen Türkei, des heutigen Serbiens und Ungarns. Es handelt sich um Konstantinopel bzw. Istanbul (Osmanisches Reich, heute Türkei), wo allein 21 Verträge vereinbart wurden, auch der Palast Aynalikavak erscheint in einem Friedensvertrag.
Nicht selten installierte ein Königshaus oder Reichsstand eine neue zweite Friedensstadt, man denke etwa an Paris und Versailles. Am Beispiel von Moskau und St. Petersburg lässt sich zeigen, dass Orte regelrecht von anderen Orten als Friedensstädte abgelöst wurden. In Moskau, wo schon 1522 ein europäischer Friedensvertrag unterzeichnet wurde, wurde nach 1703 kein Friedensvertrag mehr vereinbart, während hingegen St. Petersburg, das 1703 gegründet wurde, dann spätestens seit 1710 mit dem Heiratsvertrag zwischen Livland und Russland als Friedensstadt in Erscheinung trat[37].
40
Werden die bislang identifizierten gut 500 europäischen Friedensstädte und -orte der Zeit zwischen 1450 und 1789 auf einer Karte markiert, so lassen sich deutlich besondere Regionen spezifizieren, in denen Frieden gehäuft geschlossen wurde. Neben den republikanischen und fürstlichen Residenzstädten waren es vor allem Grenzorte, in denen Friedensverhandlungen durchgeführt wurden. Grenzen wurden bei der Entscheidung für einen Friedensort offenbar favorisiert. Es war eine ehrwürdige mittelalterliche, ja schon in die Antike zurückreichende Tradition, Friedensverhandlungen auf Inseln von Grenzflüssen abzuhalten, weil mit diesem Ort die Gleichrangigkeit der Vertragspartner besonders anschaulich symbolisiert werden konnte.
Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass gerade in den umstrittenen und militärisch umkämpften Gebieten zumeist auch Frieden geschlossen wurde.
Es handelt sich bei diesen in Grenzregionen verorteten „Ballungszentren“, erstens, um die Niederlande, zweitens um die Dänisch-Schwedische Grenz- und Küstenregion, drittens, die heutige Französisch-Schweizerische Grenze um den Genfer See und nördlich davon, viertens, die Schwedisch-Russische Grenzregion, und, fünftens, das Piemont im Nordwesten Italiens. Schließlich befinden sich auch auf dem Balkan, in der heutigen Ukraine, in Serbien und Ungarn, durch die damals die Habsburgisch-Osmanische Grenze verlief, gehäuft Friedensorte.
41
Grenzregion Niederlande
Die niederländische Grenze war für französisch-spanische Friedensabkommen ein bevorzugter Friedensort. Zwischen 1577 und 1789 waren die Generalstaaten, einschließlich der Westindischen Kompagnie, an 252 Friedensverträgen beteiligt. Die niederländischen (spanische und österreichische Niederlande) Friedensorte waren Amsterdam, Den Haag, Rijswijk, Nimwegen, Utrecht, Breda, Venlo, Gorkum (Gorinchem), Heejswijk, Antwerpen, Mecheln, Gent, Brüssel, Groenendaal, Maastricht, Namur, Lüttich, Mons und Lennik. Die Orte liegen entlang der französisch-niederländischen Grenze, gleichmäßig verteilt im Landesinneren und an der Westküste, zwei Städte, Venlo und Nimwegen, liegen an der niederländisch-deutschen Grenze. Auch Cambrai, Crépy-en-Laonnais, Vaucelles, Cateau-Cambrésis und Vervins waren Friedensorte, die entlang der französisch-niederländischen Grenze gelegen waren.
Eine Ausnahme bildete die Fasaneninsel im Grenzfluss Bidossa in den Pyrenäen, der als Friedensort für den 1659 abgeschlossenen Friedensschluss zwischen Frankreich und Spanien auserwählt wurde.
Dass die französisch-spanische Grenze in den Niederlanden als bevorzugter Ort für die Friedenswahrung angesehen wurde, wurde bereits im 17. Jahrhundert erörtert und reflektiert, wie aus dem Theatrum Europaeum deutlich wird. Hier findet sich der folgende kurze Abriss über die Friedensverträge zwischen Frankreich und Spanien bis zur Zeit Karls V., der 1516 die kastilische und aragonische Krone vereinte. Die zuvor geführten Verhandlungen – etwa Aragons mit Frankreich – wurden in dieser Textpassage ausgeblendet. Dort heißt es:
„Jenund nun / da die so lang gewünschte Wahl[38] dermaleins glücklich vorüber / war es an dem / daß die hieroben von Chur-Maynz und Chur-Cölln angestrenget / nachmals aber ins stecken gerathene Friedens-Handlung und Vermittlung zwischen den zween Krieg führenden Cronen Spanien und Franckreich solte wieder vor die Hand genommen werden. […] Die gedachten Gesandten haben vor der Andere betrachtet / daß ausser den Tractaten zu Madrit im Jahr 1526[39]. die sich nirgends besser konten schliessen / als an dem Ort / da beyde contrahirende Partheyen zugegen waren; wie auch der Stillstand zu Nice[40] / und in der Province[41] / wobey Papst Paulus der Dritte in seinem hohen Alter hat wollen persönlich erscheinen[42] / eine Vergleichung zwischen beyden Königen zu treffen / die sich beyde allda eingefunden; Alle andere Tractaten ins gemein / es seyen Friedens- oder Stillstands-Handlungen gewesen / so seithero vor hundert und dreissig Jahren vorgegangen / zwischen Franckreich und Spanien / in Abwesenheit der Könige / als nemlich die Tractaten zu Cammerich[43] / zu Crespt[44] / zu Vauchelle[45] / zu Chasteau Cambresi[46] / und zu Vervins[47] / sind alle an den Gränzen Franckreich und Niderland / und nicht ein einiges in den Gebürgen Pyreneen abgehandelt und geschlossen worden“[48].
Ergänzend sei erwähnt, dass Frankreich und Spanien beziehungsweise der Kaiser zwischen 1516 und 1659 außer in den erwähnten Grenzorten auch in Madrid Frieden schlossen, sowie ferner in Nizza, Bomy, Noyon, Barcelona, Breda, Monzon (2 mal), Paris (Fontainebleau; 3 mal) und Asti.
42
Dänisch-Schwedische Grenz- und Küstenregion
Ein zweites europäisches Ballungszentrum war der westschwedische Küstenstreifen[49]. Insgesamt wurden zwischen Dänemark und Schweden 42 Friedensverträge abgeschlossen. Davon wurden sechs in Kopenhagen (nach 1660) unterzeichnet und sechs in Stockholm (nach 1690). Die anderen 18, nach 1660 abgeschlossenen Verträge verteilen sich auf die Friedensstädte Malmö, Lödöse, Brömsebrö, Roskilde, Stettin, Ulfsbäck, Flabäck und Knäred. Zwischen 1661 und 1689 wurden weitere acht Verträge zwischen Dänemark und Schweden unterzeichnet, nämlich in Malmö und Lund, wo allein vier Verträge ausgehandelt wurden. Drei Friedensverträge, an denen Schweden und Dänemark beteiligt waren, wurden außerhalb Skandinaviens in Nimwegen und Fontainebleau signiert. Besonders augenfällig ist, dass viele dänisch-schwedische Friedensorte entlang der schwedischen Westküste am Kattegat und Skarregat, nämlich in Ängelholm, Varberg, Göteborg/Älvsborg und Strömstadt lagen, sowie am Öresund, nämlich Malmö, Kopenhagen und Frederiksborg.
Strömstad, wo am 2.10.1751 der dänisch-schwedische Grenzvertrag unterzeichnet wurde, war ein kleiner schwedischer Grenzort in Richtung Norwegen. In der Hafenstadt lebten um 1750 ca. 300 Einwohner und um 1815 ca. 1.500. Erst 1676 wurden dem Ort Stadtrechte verliehen. Bekannt war Strömstad wegen seines Gesundbrunnens und Salzseebades. Als Basis für die Kampagnen Karls XII. besaß sie im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts eine militärische, strategische Funktion. War Strömstad in erster Linie wegen seiner geographischen Lage interessant, sprach für Älvsborg, dort am 27.8.1561 ein dänisch-schwedisches Abkommen zu schließen, die Existenz der schon im 13. Jahrhundert erbauten und 1523 neu errichteten Festung. Seit dem Hochmittelalter bis ins 17. Jahrhundert wurde die Festung von Norwegern, Dänen und Schweden beansprucht. Während Älvsborg an Bedeutung verlor und schließlich sogar abgerissen wurde, wuchs die Bedeutung des 1619 gegründeten Göteborgs im 17. Jahrhundert und zwar nach 1731 vor allem als Hafenstadt für den China- und Indienhandel. Hier wurde am 9.10.1788 der Erste Waffenstillstand zwischen Dänemark und Schweden unterzeichnet.
Ebenso wie Älvsborg handelt es sich auch bei Varberg um eine Festung, ebenso aus dem 13. Jahrhundert, die zeitweise in Besitz der Dänen und zeitweise in Besitz der Schweden war. Am 8.8.1530 wurde hier der Rezess zwischen Dänemark und Schweden signiert. Zu den jüngeren Neugründungen gehört schließlich auch Ängelholm in Schonen, das 1516 von König Kristian II. von Dänemark errichtet wurde. Hier schlossen Dänen und Schweden am 29.10. (8.9.) 1644 den Präliminarrezess ab. Zu den dänisch-schwedischen Friedensorten mit einer Handelstradition gehört auch Malmö, die seit 1116 erwähnt wird. Als Landungsstelle und Hafenstadt besaß sie strategische Bedeutung, wurde von Schweden und Dänen belagert und durch das Kastell „Malmöhus“ geschützt. Während Malmö seit dem 15. Jahrhundert an Bedeutung zunahm, ist die Blütezeit Lunds ins 13. und 14. Jahrhundert zu datieren. Die von einem Wikingerkönig 990 gegründete Stadt wurde dänischer Bischofs- und später Erzbischofssitz. Durch den Frieden von Roskilde kam Lund – wie Schonen überhaupt – an Schweden. Erst wieder durch die Universität und die Wirkung Pufendorfs sowie als europäischer Friedensort am Ende des Großen Nordischen Krieges gewann Lund an Reputation. Im Jahr 1679 wurden hier allein vier Friedensverträge zwischen Dänemark und Schweden, darunter auch ein Waffenstillstand, abgeschlossen.
43
Der Genfer See als Grenzregion
Eine weitere Region, in der gehäuft Friedensorte zu finden sind, kann entlang des Genfer Sees und weiter gen Norden davon an der französisch-schweizerischen Grenze ausgemacht werden[50]. Die Region war Ziel vieler – auch berühmter – europäischer Reisender. Hier befinden sich überwiegend kleine und mittelgroße Friedensorte, wo Verhandlungen geführt wurden, die Angelegenheiten zwischen Frankreich und Genf sowie Frankreich und Basel betrafen. 41 Friedensverträge wurden zwischen 1453 und 1789 zwischen Frankreich und den Eidgenossen abgeschlossen; 10 Verträge davon zwischen Frankreich und dem Fürstentum Basel, 11 zwischen Frankreich und der Stadt Basel sowie sieben zwischen Frankreich und Genf.
15 verschiedene Friedensorte nahe des Genfer Sees konnten identifiziert werden. Beinahe jeder von diesen Orten war mit einer repräsentativen Burg oder einem Schloss ausgestattet. Neben Genf, Porrentruy, Lausanne und Basel waren dies auch Nyon, Divonne-les-Bains mit dem Château de Divonne, Biederthal, Thonon-les-Bains mit Schloss Ripaille, Leymen mit der Burg und Festung Landskron, Gex mit der Burg der Herren von Gex sowie der nahe des Orts gelegenen Burg Florimont. Auch bei Versoix befinden sich die zwei Schlösser Ecogia und St. Loup. Versoix sollte nach Plänen des französischen Ministers Choiseul 1763 zu einer Hafenstadt ausgebaut werden, um Genf Konkurrenz zu bieten. In Ferney lebte zwischen 1753 und 1778 Voltaire in einem repräsentativen Haus.
Eine Ausnahme bilden der Berg Suchet und der Grenzübergang Damvant, wo es keine repräsentativen Gebäude gab. Am Berg Suchet an der französisch-schweizerischen Grenze trafen sich Gesandte des französischen Königs und des Kantons Bern, wo sie am 13. Oktober 1741 eine Grenzkonvention unterzeichneten. Es ist überliefert, dass die Diplomaten den fünfthöchsten Gipfel des Schweizer Juras betraten, wenn auch nicht selbst bestiegen[51]:
„Nous sommes transportés a la Montagne de Suchet, apres savoir examiner avec plus de circonspection l‘ Emplacement actuel de la d[ite]. borne, dont les dits de Jougne [französische Gemeinde im Département Doubs/Franche-Comté] le plaignent pour […] constater Si elles Se trouve au juste dans le lieu ou elle fut posée en execution du recez, de 1648 […]“[52].
In Damvant trafen sich am 21. Februar 1725 die bevollmächtigten Kommissare des französischen Königs und des Erzbischofs von Basel, um die Grenzen zwischen beiden Gemeinwesen festzulegen. Drei Tage später wurde der Vertrag signiert und am 15. Januar 1727 vom französischen König ratifiziert. „[…] le dossier“, schreibt l’Abbé Vautrey, „de ce long procès est presque le seul titre historique du village de Damvant“[53].
Doch nicht jeder dieser Orte ist speziell als Friedensort in Erinnerung geblieben. Thonon z.B., wo 1569 eine Konvention zwischen Savoyen-Piemont, dem Fürstbistum Sitten und Wallis unterzeichnet wurde, wird 1788 beschrieben als hübsche Stadt in Savoyen mit einem schönen Schloss, aber einen Hinweis auf den Friedensschluss gibt es hier nicht. Thonon, heisst es nur, sei eine „jolie petite ville de Savoie, capitale du Chablais, sur le lac de Genève. On y voit un très-beau-palais, six couvens, tant d’hommes que femmes, un collège de Barnabites […]“[54].
44
Schwedisch-Russische Grenzregion
Die meisten frühneuzeitlichen Friedensorte im schwedisch-russischen Grenzbereich gruppieren sich um den Finnischen Meerbusen, in Narva, Valiesar, St. Petersburg, Wyborg, Teusina und Åbo sowie Nystad (am Bottnischen Meerbusen). Kardis und Dorpat im heutigen Estland sind indes im Landesinneren gelegen.
Narva war eine mittelalterliche Festungs- und Handelsstadt, gelegen am gleichnamigen Fluss, und bis 1346 in Besitz der Dänen, später der Schweden. Zar Peter I. erlitt 1700 in der Schlacht von Narva gegen Karl XII. eine empfindliche – legendäre – Niederlage. Schon vier Jahre später gelang es dem Zaren jedoch, diese Stadt erfolgreich zu belagern und das Russische Reich bis ins Baltikum auszudehnen. Narva war deshalb von strategischer Bedeutung für die angrenzenden Dynastien – Russland, Schweden und Sachsen – weil sie für die einen – nämlich Sachsen – die Grenze sicherte und für die anderen – nämlich Russland – den Handel förderte. So heißt es beispielsweise bei dem Biographen des schwedischen Königs Karl XII., Anders Fryxell, der sich zu Geheimabsprachen zwischen Zar Peter von Russland und Fürst August von Sachsen wie folgt äußerte:
„Der schwerste Punkt bei der Einigung zwischen den beiden geheimen Unterhändlern war indessen der künftige Besitz der Festung Narwa, worauf August […] eifrig bestand, um an dem Flusse Narowa eine dereinstige feste Grenze gegen Rußland zu haben, die aber auch Peter nicht fahren lassen wollte, um an der Narowa eine Stütze für den künftigen russischen Ostseehandel zu gewinnen“[55].
Russland setzte sich letztlich durch und Narva wurde russisch. Schon im 16. Jahrhundert, am 10.8.1583, wurden hier ein Waffenstillstand zwischen Russland und Schweden und am 19./30.8.1704 ein Angriffs- und Schutzbündnis zwischen Russland und Sachsen-Polen abgeschlossen. Nicht weit davon entfernt liegt der Ort Valiesar, wo Russen und Schweden am 20.12.1658 einen Stillstandsvertrag unterzeichneten.
Dass Friedensschlüsse Bestandteil vormoderner Stadtplanung sein konnten, zeigt die Geschichte des russischen Schlotburg, das heute zu St. Petersburg gehört. Die 1611 von den Schweden erbaute Festung Nyenschantz fiel 1702 im Verlauf des schwedisch-russischen Krieges einem Brand zum Opfer. Im Mai 1703, einen Tag nach Einnahme des Ortes durch die Russen, benannte Peter der Große die Festung in Schlotburg um, das – je nach Sprache – an Schornstein, Schloss oder auch Schlüssel erinnert. Im Rahmen der Bemühungen des Zaren, den Ort neu zu beleben und für den Seehandel interessant zu machen, kam es hier nur einen Monat nach der Neubenennung der Festung zum Abschluss des Friedensvertrages von Schlotburg (1703 VI 28) zwischen Russland und Sachsen-Polen[56].
45
Eine vom vormodernen Friedensprozess geprägte Region war das sogenannte „Russische Finnland“ mit den Orten Wiborg, Åbo (Turku) und Nystad, die auf einem gemeinsamen Küstenstreifen liegen. Wiborg, eine mittelalterliche Handelsstadt, die von den Schweden gegründet wurde und ihnen als Grenzfestung diente, wurde 1710 von den Russen erobert. Hier wurden zwei schwedisch-russische Verträge vereinbart und zwar ein Bündnisvertrag am 28.2.1609 und ein Grenzvertrag am 30.3.1723.
Åbo (Turku), im 13. Jahrhundert gegründet, war schon in seinen Anfängen ein Markt. 1249 wurden das Schloss und das Kloster errichtet, um 1300 die Kathedrale. Turku war Sitz des Bischofs und später des Erzbischofs. 1676 trafen sich hier die finnischen Stände.
In Nystad (Uusikaupunki), eine Hafenstadt, die 1617 durch Gustav II. Adolf von Schweden aufgebaut wurde, wurde am 30.8.1721 der Große Nordische Krieg beendet.
Das sogenannte „Russische Finnland“ mit Wiborg, Åbo und Nystad war im 18. Jahrhundert ein begehrtes Reiseziel. Damals wurde diese Region als umkämpfte, eroberte und vor allem privilegierte Region wahrgenommen. So heißt es in einer Reisebeschreibung aus dem Jahr 1790:
„Das russische Finnland, welches theils 1721 durch den Frieden zu Nystad, theils durch den Vertrag zu Abo 1743 von Schweden an Rußland abgetreten wurde, hat noch meist seine alten Freyheiten. […] Wiburg hat seinen eigenen bürgerlichen und peinlichen Gerichtshof […]. Im Gerichtshofe des Gouverneurs werden die Geschäfte in deutscher, schwedischer und russischer Sprache verhandelt: […] Die im Lande übliche Religion ist die lutherische; doch haben die Russen auch die griechische Religion eingeführt“[57].
An der ehemaligen Grenze zwischen Russland und Schweden im heutigen Finnland wurde in Zusammenhang mit den damaligen Friedensbemühungen, die stets von den Interessen der beteiligten Mächte gesteuert wurde, eine Zone mit spezifischen Ausprägungen in Kultur, Sprache, Rechtswesen und Religionsausübung gebildet.
46
Das Piemont als Grenzregion
Eine weitere besonders markante Region, in der häufiger Friedensverhandlungen geführt wurden, war der französisch-savoyische Grenzsaum. Zwischen 1450 und 1789 wurden 103 Friedensverträge mit französischer und savoyischer Beteiligung abgeschlossen.
Es konnten folgende Friedensorte der Region Piemont auf italienischer Seite (heutige Provinz Turin) identifiziert werden: die Residenzstadt Fossano, der Sitz der Fürsten von Carignan namens Carignano, der Bischofssitz Vercelli, der Bischofssitz Asti, die Diozöse Acqui, die Abtei Arona, das französische Lager bei Susa mit der Festung in Exilles (später Brunetta), die Festung von Verrua, die Festung Pinerolo, die Gemeinde Candia mit dem Schloss Castelfiorito sowie die Grenzorte und Gemeinden Perosa (Argentina), Bruzolo, Ghemme, Mirabello (Montferrato) und Chivasso; auf französischer Seite sind zu nennen Briançon (heute Hautes-Alpes) mit seinem Festungssystem und Pont-de-Beauvoisin (Isère).
Eine Besonderheit ist Pont-de-Beauvoisin, das sich als Friedensort deshalb besonders eignete, weil er in zwei verschiedene Herrschaftsbereiche geteilt war. In der Reisebeschreibung von Mylius heißt es:
„Pont de Beauvoisin ist eine kleine Stadt, die eine mahlerische Lage an den beiden Ufern des Guyer hat; dieser Strom war einst die Grenze zwischen Frankreich und Savoyen, und theilte die Stadt in die französische und savoyische Hälfte […]“[58].
47
Der Balkan als Grenzregion
Auch soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich mehrere vormoderne Friedensorte in den Gebieten der heutigen Ukraine, Serbiens und Ungarns befinden. Nicht selten waren hier Kriegsschauplatz und Friedensort identisch, wie z.B. in Peterwardein. Die Akteure waren Habsburg, Venedig, das Osmanische Reich und Siebenbürgen.
Die Friedensorte waren neben Konstantinopel z.B. Edirne (Osmanisches Reich, heute Türkei), Chocim/Khotyn (Siebenbürgen, Moldavien, Polen, Osmanisches Reich, Russland, heute Ukraine), Lemberg (Polen, heute Ukraine), Buczacz (Polen, Osmanisches Reich, Österreich, heute Ukraine), am Fluss Pruth (Russland, Osmanisches Reich, heute Ukraine), Belgrad (Osmanisches Reich, Österreich, heute Serbien), Karlowitz (neutrales Gebiet, heute Serbien), Passarowitz (Osmanisches Reich, Österreich, heute Serbien), Gyarmat (Ungarn), Szöny (Ungarn), Vasvár (Ungarn) sowie Zsitvatorok/Žitavská Tona (Ungarn, heute Kroatien), Kütschük Kainardschi/Küçük-Kainarca (Osmanisches Reich, Russland, heute Bulgarien) Wien (Österreich) und Andrusovo (Polen-Littauen, heute Russland).
Davon liegen mehrere Orte an Grenzflüssen, nämlich Chocim am Dnister, Belgrad an Save und Donau und auch Karlowitz an der Donau. Auch der Pruth ist ein Grenzfluss zwischen Rumänien und Moldavien.
Außerhalb des Osmanischen Reiches oder der Grenzgebiete wurde Frieden in Wien und Candia geschlossen. Von diesen Friedensorten besitzen neben Wien vor allem Konstantinopel (Istanbul), Edirne, Lemberg, Karlowitz und Belgrad, eine der ältesten Städte Europas, eine besondere historische Bedeutung. Bei der Mehrzahl der Friedensorte handelt es sich um kleinere und mittelgroße Orte. Chocim mit seiner Festung war 1621 Schauplatz der bekannten Schlacht zwischen Polen-Littauen und den Osmanen. Offenbar war ein Ort, der von den Kriegsparteien umkämpft war, als Friedensstadt besonders geeignet. Vasvár, Szöny, Gyarmat (heute Balassagyarmat), Zsitvatorok und Andrusovo sind Grenzorte, die in umstrittenen Gebieten gelegen waren.
48
Erstaunlicherweise sind nicht nur „bedeutende“ oder verkehrsgünstig gelegene Orte als Friedensorte ausgewählt worden, auch nicht nur Grenzorte oder umkämpfte Orte, sondern in großer Zahl auch kleine Dörfer. Stolbovo, ein kleines Dorf im russischen Gouvernement St. Petersburg am Sjaß, wo Zar Michael I. und der schwedische Heerführer Jakob de la Gardie am 27. Februar 1617 einen Friedensvertrag unterzeichneten, existiert heute nicht mehr[59].
Friedensverhandlungen konnten dem Ort neue Impulse für seine Entwicklung geben. Auch der Bekanntheitsgrad des Friedensortes stieg immens, man denke etwa an das bis dahin nur wenigen, zumeist Einheimischen, bekannte kleine Dorf Passarowitz bei Belgrad, auf das aufgrund des dort ausgehandelten Friedensschlusses 1718 zwischen Habsburg und dem Osmanischen Reich ganz Europa schaute und sogar den Eingang in Zedlers Universal-Lexikon fand[60].
Friedensorte wurden sogar eigens nur für den Zweck des Friedensschlusses hergestellt, d.h. sie war nicht nur für kurze Zeit Verhandlungsort, sondern als Orte selbst nur für den Frieden existent. Zu diesen „Nicht-Orten“, gehören Feldlager, wie z.B. das bei Stettin[61], die für Friedensorte ausgewählt wurden. Es musste noch nicht einmal ein Feldlager vorhanden gewesen sein, denn ein bestimmter Ort wurde im Friedensvertrag am Fluss Pruth zwischen dem Osmanischen Reich und Russland vom 22.7.1711 nicht erwähnt[62].
Nicht immer waren in den Friedensstädten die üblichen Räumlichkeiten wie Burg, Festung, Schloss oder Rathaus vorhanden. Passarowitz ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie Friedensorte für den Zweck des Friedensschlusses mangels geeigneter Räumlichkeiten eigens gestaltet wurden. Passarowitz, wo für die Friedensverhandlungen Zelte aufgeschlagen wurden, ist zugleich ein Gegenbild zu den aufwändigen Friedenskongressen. Es nahmen die Bevollmächtigten des Kaisers und des Osmanischen Reiches sowie Venedigs daran teil sowie als Vermittler England und die Niederlande. Andreas Lazarus von Imhof veröffentlicht im Neu-Eröffneten Historien-Saal folgenden Bericht, aus dem hervorgeht, wie man sich damals beholfen hat:
„Unweit Passarowitz (des kleinen Ortes unterhalb Semendia an der Morava liegend) solte zwar ein Conferentz-Hauß erbauet werden, weil aber die Zeit von beyden Partheyen menagirt werden wolte, so beliebte man unter einem grossen der kayserl. Bottschafft zugehörigen Zelt den Congreß zu halten, unter Zelten zu logiren, auf jeder Seite der Bevollmächtigtenn eine Bedeckung von teutscher und Türckischer Militz zu stellen, und einen District von 2. Meilen abzustechen, der von keiner Parthey durffte betretten werden; und nach dieser Verordnung langten die Ambassadeurs und Mediateurs nach und nach zu Passarowitz an, hielten ihre Einzüge, legten ihre Visiten gegen einander ab, regulirten das Caeremoniel, so man gleichfalls auf das möglichste zusammen zoge, und den 5. Juny wurde in dem erwehnten grossen Gezelt die erste Zusammenkunft gehalten“[63].
49
4. Orts- und Raumbildung als Instrument der Friedensstiftung
Friedensorte wurden als neutrale und befriedete Orte privilegiert und waren somit ein wichtiger Baustein der Friedenswahrung. Die Privilegierung von Orten für die Wahrung und Stiftung von Frieden reicht zurück bis ins Mittelalter. François Ragueau und Eusèbe Laurière erläuterten 1785 die Bedeutung von „Ville de paix“ in ihrem Glossaire du droit françois für Frankreich wie folgt:
„En laquelle n’étoit permis aux sujets user de droit de guerre ny se venger. Telle étoit la ville de Paris, comme appert par une commission qui est es registres de la Cour de Parlement du 26. May 1344. mais devoient poursuivre leurs differens en Justice dont l’auditoire s’appelle aussi Maison de Paix en la Coutume de Mons, chap. 12. comme aussi en un Arrest de Paris du 3. Juillet 1352. il est narré que droit de guerre n’avoit lieu es Bailliages de Chartres & d’Orléans“[64].
Es wurden im vormodernen Friedensprozess aber nicht nur Städte und Orte mit spezifischen rechtlichen Merkmalen versehen, sondern auch Räume. Durch die in Friedensverträgen fixierten Vereinbarungen und Bestimmungen wurden bestimmte Herrschafts-, Handels- oder auch Rechtsräume, -regionen und -zonen völkerrechtlich beschrieben, gestaltet und geschaffen. Dass ganze Bezirke und Zonen völkerrechtlich beschrieben wurden, soll im Folgenden aufgezeigt werden.
So lassen sich Räume beschreiben, die in Friedensverträgen, wenn auch nicht immer befriedet, so doch aber wenigstens gegenseitig – man würde heute sagen: auf internationaler Ebene – anerkannt wurden. In der Münsteraner Ausfertigung des Westfälischen Friedens von 1648 wurden z.B. Krisenregionen bestimmt (der Burgundische Kreis, Lothringen, Elsass) und sogar – § 119 – ein Kriegsschauplatz völkerrechtlich definiert (nämlich Italien, wo Savoyen das Recht auf Kriegsführung erhält); Rechtsgrenzen beschrieben (Basel und die Schweiz werden fortan in keiner Hinsicht den Gerichtshöfen und Gerichten des Reiches unterworfen, siehe § 61); neue Herrschaftsbereiche geschaffen (z.B. Metz, Toul, Verdun gehören fortan nicht mehr zum Deutschen Reich, sondern zu Frankreich, siehe § 71); neue Neutralitätsräume errichtet (Zabern, siehe § 82) sowie spezifische grenzüberschreitende Vereinbarungen getroffen (wie z.B. § 68 Freiheit des Handels, ferner das Recht auf Durchzug durch Orte, Reisefreiheit[65].
Weitere Beispiele raumbezogener Friedensstiftung lassen sich ausmachen. In einem Vertragsentwurf, den die französischen Unterhändler Campagnol und Richardot im Rahmen der Friedensverhandlungen von Vervins 1596 konzipierten, wurden Frontdistrikte beschrieben, in denen die Bewohner Ruhe und Wohl genießen sollten. Auch wurden Wohnbezirke von Geistlichen erwähnt, in denen Handelsfreiheit garantiert werden sollte[66].
Mit dem Ziel der Konfliktvermeidung wurden zudem gemeinschaftlich kontrollierte Räume und Sicherheitszonen festgelegt. Ein Beispiel: Auf der (großen) Haager Allianz (1701 IX 7) zwischen dem Kaiser, England und den Generalstaaten wurden Sicherheitszonen in den spanischen Provinzen eingerichtet (Artikel 5), um Frieden zwischen Frankreich und den Generalstaaten zu wahren. Die frühneuzeitliche Sicherheitspolitik verstand sich zudem bereits mit der Schaffung von Pufferzonen und Korridoren zur Vermeidung und besseren Kontrolle von Konflikten. Hierzu ist z.B. Ingermanland zu rechnen, an dem Schweden strategische Interessen hatte, um Angriffe Russlands auf Finnland abwehren zu können. Gerade hier errichteten die Russen die üppige Schlossanlage Zarskoje Selo, die im 17. Jahrhundert noch schwedisch war, und präsentierten sie 1756 medienwirksam. 17 Jahre später überließ die Zarenfamilie im Friedensvertrag von Zarskoje Selo ihre Holsteinischen Besitzungen zugunsten des langjährigen Rivalen der Schweden, Dänemark. Die Wahl des Friedensplatzes konnte somit ein Baustein politischer Machtdemonstrationen sein.
50
Ein frühneuzeitliches Beispiel, durch Allianzen einen bestimmten Raum zu befrieden, ist der Rheinbund. Dieses Bündnis dürfte maßgeblich an der Bildung einer neuen Kulturlandschaft, dem Rheinland, mitgewirkt haben.
Der sogenannte „Erste Rheinbund“ wurde am 14. August 1658 in Frankfurt am Main geschlossen. Vertragspartner waren deutsche Reichsstände, u.a. Braunschweig-Lüneburg, Hessen-Kassel, Köln, Mainz und Pfalz-Neuburg. Auch Schweden schloss sich dem Rheinbund an. Einen Tag später trat Frankreich in Mainz dem Rheinbund bei. Es folgten darauf hin noch die Beitritte einer ganzen Reihe deutscher Reichsstände, wie Brandenburg-Preußen, Hessen-Darmstadt, Württemberg, Münster, Trier, Pfalz-Zweibrücken und Hohenlohe. Der Rheinbund gehört zu den wenigen Allianzen, bei denen nicht der Ort der Unterzeichnung namensgebend wirkte, sondern die Lage der beteiligten Dynastien, hier am Rhein. Doch bei näherem Hinsehen fällt auf, dass keineswegs die Territorien aller Akteure am Rhein lagen.
Der Rheinbund von 1658 war Streitpunkt französischer und deutscher Historiker. Durch die Verwendung bestimmter Raumbilder und Metaphern wurden (und werden noch) Friedensverträge bewertet und konstruiert. Nicht immer setzt sich eine einzige Interpretation durch. Der französische Historiker und Geograph Bertrand Auerbach (1856–1942) benutzt für den Rheinbund die Metapher des Puffers zwischen den Mächten Frankreich und Habsburg. Auerbach imaginiert eine Fläche zwischen zwei Polen, so dass der Rheinbund für ihn ein homogenes Gebilde darstellt. Der französische Historiker Henri Vast, der den Rheinbundvertrag 1898 edierte, sieht in ihm hingegen ein Instrument der französischen Krone, die deutschen Fürsten in politische Abhängigkeit zu bringen. In der Darstellung von Vast ist der Rheinbund ein punktueller, aus einzelnen Gliedern bestehender und kein arrondierter Verbund. Er prägt daher das Bild von der „chaine ininterrompue de confédérés“, die einsteigen „dans la clientèle du roi de France“. Diese beiden Beispiele aus der Historiographie zeigen, wie sehr Wissenschaften mit räumlichen Vorstellungen operieren.
51
- Friedenswahrung und Friedenspraxis hatten – und dieser Aspekt wurde in der historischen Friedensforschung bislang kaum beachtet – in der Frühen Neuzeit eine topographische Dimension: Die Orte identifizieren einen Friedenskongress und -vertrag, denn sie geben ihm überhaupt erst den Namen.
- Die Vereinbarungen sowie ihre Auswirkungen auf die europäische Geschichte sind eng mit dem Friedens- und Vertragsort verknüpft. Zugleich besitzen vormoderne Friedensabschlüsse auch Rückwirkungen auf die Entwicklung des Friedensortes. Nicht selten fungieren Friedensverhandlungen und -abschlüsse als Impulse für die Entwicklung des Friedensorts.
- Gut 500 Friedensorte konnten für den Zeitraum 1450 bis 1789 identifiziert werden. In dem vorliegenden Beitrag wurden anhand dessen vier Kategorien typischer Friedensorte unterschieden: Kongressorte, Residenzstädte, Grenzorte sowie „kleine“ und „Nicht-Orte“. Die Kongressorte sind geographisch in Frankreich, im Deutschen Reich, in den Niederlanden und – in einem Fall – in Schweden (Nystad, heute Finnland) angesiedelt, also im geographischen „Zentrum“ Europas.
- Residenzstädte fungieren häufig als Orte, in denen bi- und multilaterale Friedensverhandlungen durchgeführt wurden, aber sie beherbergen keine europäischen Friedenskongresse.
- Viele Friedensverträge sind im Untersuchungszeitraum in Grenzorten abgeschlossen worden. Dabei handelt es sich um Orte – häufig Festungen – die in umkämpften Gebieten liegen und von mehreren Parteien beansprucht wurden.
- Es konnten bestimmte Regionen in Europa herausgeschält werden, in denen sich Friedensorte häuften: die Niederlande mit der damaligen französisch-spanischen Grenze, der Grenfer See mit der französisch-schweizerischen Grenze, das Piemont mit der französisch-savoyenischen Grenze, Kattegat und Skarregat mit der schwedisch-dänischen Grenze, der finnische Meerbusen mit der schwedisch-russische Grenze und der Balkan mit der osmanisch-habsburgische Grenze.
- Unter „kleine“ und „Nicht-Orte“ – eine bislang in der Forschung nicht berücksichtigte Kategorie – wurden hier Friedensorte begriffen, die erst für die Friedensverhandlungen eigens hergerichtet werden mussten. Ein Beispiel ist das Dorf Passarowitz, wo man die Verhandlungen in Zelten durchführte, die nur für die Friedensverhandlungen benutzt wurden.
- Interessanterweise korrespondierte die Größe der Friedensstädte nicht mit der Bedeutung der Verhandlungen. Friedensverhandlungen konnten ebenso in einem repräsentativen Schloss, einem Rathaus, sogar einem Hotel, auf einer Insel, einem Berg, einem Feldlager oder an einem Fluß durchgeführt werden. Mitunter mussten die Gebäude – man denke an Cateau-Cambrésis – erst renoviert werden.
- Im Lauf der Frühen Neuzeit wurde Neutralität auf unterschiedliche Weise verortet. In der Regel erhielten die ausgewählten Orte dieses Merkmal durch Privilegien. Im Westfälischen Frieden konnte Neutralität offenbar nur durch zwei Orte – nämlich das katholische Münster und das evangelische Osnabrück – hergestellt werden. 1783 entschieden sich die Akteure für einen gewerblich genutzten Ort, ein Hotel.
- Seit dem frühen 18. Jahrhundert sahen viele gelehrte Zeitgenossen auf Grund ihrer republikanischen Staatsform sowie ihres intensiven Handels in den Niederlanden die geeignete Region für Friedensschlüsse.
- Der Ort, an dem zwischen 1450 und 1789 die meisten frühneuzeitlichen Friedensschlüsse signiert wurden, ist die niederländische Residenzstadt Den Haag.
- Doch nicht Den Haag, sondern Utrecht wurde gegenüber allen anderen europäischen Friedensorten für europäische Friedenskonferenzen – und zwar auf Grund der vorhandenen Gebäude, Befestigungsanlagen und der guten Luft – favorisiert.
- Friedensräume im europäischen Friedensprozess der Vormoderne werden auch durch multilaterale Bündnissysteme generiert, wie z.B. durch den Rheinbund. Durch Bündnisse werden Territorien miteinander vernetzt und in einen politischen sowie eventuell auch kulturellen Zusammenhang gebracht. Der Rheinbund könnte an der Ausbildung des Rheinlandes als Kulturlandschaft maßgeblich mitgewirkt haben.
-
Neben den Friedensorten wurden auch spezifische privilegierte Bezirke und (Sicherheits-)Zonen eingerichtet. Das Ingermanland ist so ein Puffer zwischen Russland und Schweden. Es wurden in den Friedensvereinbarungen somit Räume gebildet, um Frieden zu wahren oder herzustellen, und im Rahmen einer strategischen Sicherheitspolitik instrumentalisiert. Diese völkerrechtlichen Friedens- und Sicherheitszonen wurden bislang weder erforscht noch visualisiert.
52
Quellen- und Literaturverzeichnis
Choiseul, Base, M.A.E. Traités. Suisse 17410004: 1741, 13. Octobre, Convention de délimitation avec la république de Berne (Suchet; montagne de), in: Base Choiseul: Traité, Documents 61/272, http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/choiseul/desktop/choiseul/DDW?M=61&K=17410004&W=PAYS+%3D+%27Suisse%27+ORDER+BY+EVERY+DATEEXACTE/Ascend (eingesehen am 2.11.2009).
Duchhardt, Heinz/Peters, Martin: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 2.10.2009).
- Friedensvertrag von Montilis-le-Tours (1489 X 30), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
- Friedensvertrag von Cambrai zwischen Frankreich und dem Kaiser (1529 VIII 5), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
- Waffenstillstand von Vaucelles zwischen Frankreich und dem Kaiser (1555/56 II 5), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
- Friedensvertrag von Cateau-Cambrésis zwischen Frankreich und Spanien (1559 IV 3), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
- Friedensvertrag von Vervins zwischen Frankreich, Spanien, dem Vatikan und Savoyen-Piemont (1598 V 2), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
- Friedensvertrag von Stolbovo zwischen Russland und Schweden (1617 II 27_III 9), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
- Bündnis von Schlotburg (1703 VI 28), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 10.11.2009).
- Friedensvertrag, geschlossen am Fluss Pruth zwischen dem Osmanischen Reich und Russland (1711 VII 22 / 1123 AH), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
- Bündnisvertrag gegen Schweden auf dem Feldlager bei Stettin zwischen Hannover und Preußen (1715 V 30), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
- Grenzkonvention vom Berg Suchet (1741 X 13), in: Heinz Duchhardt/Martin Peters: http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
http://www.freundeskreis-hubertusburg.de/places.htm (eingesehen am 13.11.2009).
http://www.laziobeniculturali.it/portal/page/portal/drl/drl_attivita/progetti/lubecca/LubRoma_-Progetto%20regionale.pdf (eingesehen am 2.02.2010).
Kunz, Andreas: ieg-maps, in: http://www.ieg-maps.uni-mainz.de (eingesehen am 2.10.2009).
Ders. (Hg.): AtlasEuropa – Digitaler Atlas zur Geschichte Europas seit 1500, in: http://www.atlas-europa.ieg-mainz.de (eingesehen am 2.11.2009).
Schaffner, Franz: Friedensgeographie. Konzepte-Projekte-Perspektiven, in: http://www.friedensgeographie.de (eingesehen am 26.02.2010).
Theatrum Europaeum, Bd. 8, 1693, S. 456–459.
53
Bély, Lucien: Diplomates et diplomatie autour de la paix d’Utrecht, Paris 1988.
Bittner, Ludwig/Santifaller, Leo: Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden 1648, Oldenburg 1936–1965.
Carlsson, Einar: Freden i Nystad. Fredrik I:s personliga politik och dess betydellse för förhållandet mellan Sverige och England sommaren 1720, Uppsala 1932.
Duchhardt, Heinz/Jakobi, Franz-Josef (Hg.): Der Westfälische Frieden. Das Münstersche Exemplar des Vertrags zwischen Kaiser/Reich und Frankreich vom 24. Oktober 1648, 2 Teile, Wiesbaden 1996.
Duchhardt, Heinz (Hg.): Der Friede von Rijswijk 1697, Mainz 1998 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Beiheft 47).
Ders. (Hg.): Städte und Friedenskongresse, Köln u.a. 1999.
Ders.: The Missing Balance, in: Journal oft he History of International Law 2 (2000), S. 67–72.
Ders.: ›Europa‹ als Begründungs- und Legitimationsformel in völkerrechtlichen Verträgen der Frühen Neuzeit, in: Wolfgang E. J. Weber/Regina Dauser (Hg.): Faszinierende Frühneuzeit. Reich, Frieden, Kultur und Kommunikation 1500–1800 (Festschrift für Johannes Burkhardt zum 65. Geburtstag), Berlin 2008, S. 51–60.
Ders.: „Europa“ als Begründungsformel in den Friedensverträgen des 18. Jahrhunderts: von der „tranquillité“ zur „liberté“, in: Heinz Duchhardt/Martin Peters (Hg.): Instrumente des Friedens. Vielfalt und Formen von Friedensverträgen im vormodernen Europa, Mainz 2008-06-25 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 3), Abschnitt 5–11, URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/03-2008.html.
Fisch, Jörg: Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses, Stuttgart 1979.
Fryxell, Anders: Lebensgeschichte Karl’s des Zwölften, Königs von Schweden. Nach dem schwedischen Original frei übertragen von G. F. von Jenssen-Tusch. In fünf Theilen, 1. Theil, Braunschweig 1861.
von Hessen, Rainer (Hg.): Wir Wilhelm von Gottes Gnaden. Die Lebenserinnerungen Kurfürst Wilhelms I. von Hessen 1743–1821, Frankfurt u.a. 1996.
Imhof, Arthur Erwin: Der Friede von Vervins 1598 (Diss. Phil.), Aarau 1966.
Kern, Ronny: Der Friedenskongress von Soissons 1728–1731, o.O. 2009.
Kraus, Thomas R: Aachen und der Aachener Friede von 1748, in: Heinz Duchhardt (Hg.): Städte und Friedenskongresse, Köln u.a. 1999, S. 117–133.
Krumeich, Gerd/Fehlemann, Silke: Versailles 1919: Ziele, Wirkung, Wahrnehmung, Essen 2001.
Labourdette, François u.a. (Hg.): Le Traité de Vervins, Paris 2000.
Imhof, Andreas Lazarus von: Neu-Eröffneter Historien-Saal, Bd. 4, Basel 1736.
Mylius, Christian Friedrich: Malerische Flussreise durch das südliche Frankreich und einen Theil von Ober-Italien, Bd. 1, Teil 2, Carlsruhe 1818.
Passarowitz/Passarowitzer Friede, in: Johann Heinrich Zedlers Grosses vollständiges Universallexicon aller Wissenschafften und Künste, Bd. 26 , S. 1160–1185.
Peters, Martin: Europäische Friedensverträge der Vormoderne (1500–1800) – rezipiert von Johann Gottfried Eichhorn, in: Heinz Duchhardt/Martin Peters, Kalkül – Transfer – Symbol. Europäische Friedensverträge der Vormoderne, Mainz 2006-11-02 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 1), Abschnitt 122–131 (eingesehen am 5.01.2010).
Ders.: August Ludwig Schlözer, in: Heinz Duchhardt u.a., Europa-Historiker, Bd. 1, Göttingen 2006, S. 79–105.
De Saint–Pierre, Charles Irénée Castel: Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe, Bd. I, Utrecht 1713.
Ribera, Jean-Michel: Diplomatie et espionnage. Les ambassadeurs du roi de France auprès de Philippe II du traité du Cateau-Cambrésis (1559) à la mort de Henri III (1589), Paris 2007.
Ragueau, François/Laurière, Eusèbe: Glossaire du droit françois. contenant l’explication des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances des roys de France […], Paris 1704.
De Ruble, Alphonse: Le Traite de Cateau-Cambresis: 2 Et 3 Avril 1559, Paris 1889.
Scharfe, Martin: Berg-Sucht. Eine Kulturgeschichte des frühen Alpinismus 1750–1850, Wien 2007.
Schilling, Heinz: Formung und Gestalt des internationalen Systems, in: Peter Krüger (Hg.): Das europäische Staatensystem im Wandel: strukturelle Bedingungen und bewegende Kräfte der Frühen Neuzeit, München 1996 (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 35), S. 19–46.
Schilling, Lothar: Zur rechtlichen Situation frühneuzeitlicher Kongreßstädte, in: Heinz Duchhardt (Hg.): Städte und Friedenskongresse, Köln u.a. 1999, S. 83–107.
Schlottmann, Antje: RaumSprache. Ost-West-Differenzen in der Berichterstattung zur deutschen Einheit. Eine sozialgeographische Theorie, Wiesbaden 2005 (Sozialgeographische Bibliothek, Bd. 4).
Schmitt, Carl: der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 4. Auflage, Berlin 1997.
Frehland-Wildeboer, Katja: Treue Freunde? Das Bündnis in Europa 1714–1914, München 2010.
Sellin, Volker: Die geraubte Revolution. Der Sturz Napoleons und die Restauration in Europa, Göttingen 2001.
Steinwascher, Gerd: Osnabrück und der Westfälische Frieden. Die Geschichte der Verhandlungsstadt 1641–1650, Osnabrück 2000.
Vautrey, L‘ Abbé: La Jura Bernois. Notices Historiques sur les villes et les villages du Jura Bernois, Bd. 1, Porrentruy 1863.
54
[*] Martin Peters, Dr., Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
[1] Die Visualisierung von Friedensverträgen durch Karten siehe http://www.ieg-friedensvertraege.de und http://www.ieg-maps.de.
[2] Bittner/Santifaller, Repertorium der diplomatischen Vertreter 1936–1965.
[3] Schmitt, Nomos der Erde 1997.
[4] Schlottmann, RaumSprache 2005.
[5] Fisch, Krieg und Frieden im Friedensvertrag 1979; Duchhardt, The Missing Balance 2000, S. 67–72; ders., ›Europa‹ als Begründungs- und Legitimationsformel 2008, S. 51–60; ders., „Europa“ als Begründungsformel in den Friedensverträgen 2008.
[6] Schaffner, Friedensgeographie, in: http://www.friedensgeographie.de (eingesehen am 26.02.2010).
[7] Weitere raumbezogene Metaphern, die zu untersuchen wären, könnten „separieren“, „trennen“, „teilen“, „Zentrum/Rand“, „oben/unten“, „nah/fern“ sein.
[8] Kunz (Hg.), AtlasEuropa (eingesehen am 2. 11. 2009). Im Themenbereich 1 „Die politische Landkarte Europas“ ist die Serie Staatenbünde, Unionen und Allianzen (1806–2008) u.a. der Rheinbund 1806–1813 sowie der Deutsche Bund 1815–1865 aufgeführt. Ohne die raumbezogene Dimension kommt zwar aus Frehland–Wildeboer, Treue Freunde? 2010; sie operiert mit kulturhistorischen Kategorien des Missverständnisses und Vertrauens.
[9] Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 2.10.2009).
[10] Friedensvertrag von Utrecht (1713 IV 11) zwischen Frankreich und den Generalstaaten, in: Duchhard/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 13.11.2009).
[11] Friedensvertrag von Nijmegen (1678 VIII 10), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[12] Steinwascher, Osnabrück und der Westfälische Frieden 2000.
[13] Vgl. hierzu Schilling, Zur rechtlichen Situation 1999, S. 83– 107.
[14] Sellin, Die geraubte Revolution 2001, S. 75.
[15] Krumeich/Fehlemann, Versailles 1919 2001.
[16] http://www.freundeskreis-hubertusburg.de/places.htm (eingesehen am 13.11.2009).
[17] http://www.laziobeniculturali.it/portal/page/portal/drl/drl_attivita/progetti/lubecca/LubRoma_-Progetto%20re gionale.pdf (eingesehen am 2.02.2010).
[18] Friedensvertrag von Rijswijk (1697 IX 20) zwischen Frankreich und den Generalstaaten, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[19] Grenzkonvention vom Berg Suchet (1741 X 13), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[20] Konvention vom Großen St. Bernhard (1778 IX 5), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[21] Friedensvertrag von Montilis-le-Tours (1489 X 30), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[22] Duchhardt, Vorwort, in: Städte und Friedenskongresse 1999, S. IX.
[23] Ribera, Diplomatie et espionnage 2007.
[24] Labourdette u.a. (Hg.), Le Traité de Vervins 2000; Imhof, Vervins 1966.
[25] Steinwascher, Osnabrück und der Westfälische Friede 2000.
[26] Duchhardt (Hg.), Friede von Rijswijk 1998.
[27] Bély, Diplomates et diplomatie 1988.
[28] Carlsson, Freden i Nystad 1932.
[29] Kern, Friedenskongress von Soissons 2009.
[30] Kraus, Aachener Friede 1999, S. 117–133.
[31] Encyclopédie Méthodique […], 3. Bd. 1788, S. 554.
[32] De Ruble, Le Traite de Cateau-Cambresis 1889, S. 48.
[33] Saint-Pierre, Projet pour rendre la paix, Bd. I 1713, S. 360–361.
[34] Schilling, Formung und Gestalt 1996, S. 19–46, bes. S. 21.
[35] Peters, Europäische Friedensverträge 2006, Abschnitt 122–131.
[36] Peters, Schlözer 2006, S. 79–105.
[37] Heiratsvertrag von St. Petersburg zwischen Livland und Russland (1710 VI 10/21), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[38] Kaiserwahl, M.P.
[39] Friedens- und Heiratsvertrag von Madrid zwischen Frankreich und Spanien (1526 I 14), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[40] Waffenstillstands- und Bündnisvertragvertrag zwischen Frankreich, Kaiser, England, Geldern, Schottland und Spanien (1530 IV 1), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[41] Waffenstillstand von Bomy zwischen Frankreich und Spanien (1537 VII 15), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[42] Papst Paul III. (Alessandro Farnese), geboren 1468, gestorben 1549, war 1537 im Jahr des Abschlusses des von ihm vermittelten Waffenstillstands von Bomy 69 Jahre alt.
[43] Friedensvertrag von Cambrai zwischen Frankreich und dem Kaiser (1529 VIII 5), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[44] Friedensvertrag von Crépy-en-Laonnais zwischen Frankreich und dem Kaiser (1544 IX 18), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[45] Waffenstillstand von Vaucelles zwischen Frankreich und dem Kaiser (1555/56 II 5), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[46] Friedensvertrag von Cateau-Cambrésis zwischen Frankreich und Spanien (1559 IV 3), in: Duchhardt/Peters, http://www.www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[47] Friedensvertrag von Vervins zwischen Frankreich, Spanien, dem Vatikan und Savoyen-Piemont (1598 V 2), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[48] Theatrum Europaeum, Bd. 8, 1693, S. 456–459.
[49] Siehe ausführlich den Beitrag von Bengt Büttner in diesem online-Sammelband.
[50] Vgl. den Beitrag von Peter Seelmann über Savoyen in diesem online-Sammelband.
[51] Vgl. zur bürgerlichen Geschichte des Bergsteigens seit 1750, Scharfe, Berg-Sucht 2007. Ein Beleg adeligen Bergsteigens um 1800 bei Hessen (Hg.), Wir Wilhelm 1996, S. 533.
[52] M.A.E. Traités. Suisse 17410004: 1741, 13. Octobre. Convention de délimitation avec la république de Berne (Suchet; montagne de), in: Base Choiseul, Traité, Documents 61/272, http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/choiseul/desktop/choiseul/DDW?M=61&K=17410004&W=PAYS+%3D+%27Suisse%27+ORDER+BY+EVERY+DATEEXACTE/Ascend (eingesehen am 02.11.2009).
[53] Vautrey, La Jura Bernois 1863, S. 384. Hierin findet sich sogar der Vertragstext.
[54] Encyclopédie méthodique 1788, S. 380.
[55] Fryxell, Lebensgeschichte Karl’s des Zwölften 1861, S. 77.
[56] Bündnis von Schlotburg (1703 VI 28), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 10.11.2009).
[57] Sammlungen der besten und neuesten Reisebeschreibungen in einem ausführlichen Auszuge […] 1790, S. 363.
[58] Mylius, Malerische Flussreise 1818, S. 105.
[59] Friedensvertrag von Stolbovo zwischen Russland und Schweden (1617 II 27_III 9), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[60] Passarowitz/Passarowitzer Friede, in: Zedler, Universallexicon, Bd. 26, S. 1160– 1185.
[61] Bündnisvertrag gegen Schweden auf dem Feldlager bei Stettin zwischen Hannover und Preußen (1715 V 30), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[62] Friedensvertrag, geschlossen am Fluss Pruth zwischen dem Osmanischen Reich und Russland (1711 VII 22 / 1123 AH), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.11.2009).
[63] Imhof, Historien-Saal 1736, S. 585.
[64] Ragueau/Laurière, Glossaire du droit françois, S. 455.
[65] Duchhardt/Jakobi (Hg.), Der Westfälische Frieden 1996.
[66] Imhof, Vervins 1598 1966, S. 15–16.
Martin Peters, Friedensorte in Europa – Überlegungen zu einer Topographie vormoderner Friedensschlüsse, in: Martin Peters (Hg.), Grenzen des Friedens. Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne, Mainz 2010-07-15 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 4), Abschnitt 29–54.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/04-2010.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008061836>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 30 oder 29–32.
Peter Seelmann *
„… zu einer Bestendigen rechten und heytern March gesetzt und benambset …“ – Grenzen und Räume in Savoyen-Piemont
Gliederung:
1. Aktualität, Relevanz und grundsätzliche Fragen
2. Savoyen-Piemont – ein Grenzraum?
4. Territoriale Grenzen – territoriale Räume
6. Konkrete Grenzbeschreibungen
7. Grenzlinien und linear begrenzter Räume
Text:
1. Aktualität, Relevanz und grundsätzliche Fragen
»Spatial Turn« oder nicht, unbestreitbar ist, dass seit etwa 20 Jahren dem Raum als Erkenntniskategorie in den Geisteswissenschaften größtes Interesse entgegengebracht wird, wie die kaum noch überschaubaren Publikationen und zahlreichen Konferenzen bezeugen[1]. Impuls für dieses verstärkte Interesse gab unter anderem der Fall des »Eisernen Vorhangs«. Im Zuge dessen rückten Länder des »einstigen Ostens« in die Mitte Europas[2], wurden nationale Grenzziehungen in Frage gestellt und stand der europäische Einigungs- und Integrationsprozess vor neuen Herausforderungen. Es sind diese Veränderungen, die eine Neuorientierung verlangen und Fragen aufwerfen, wie sich nicht-nationale politische Räume im Vergleich zu nationalen politischen Räumen definieren, wie sie entstehen bzw. konstruiert werden und wie sie funktionieren. Welche Rolle spielen dabei andere, beispielsweise soziale, wirtschaftliche, kulturelle, religiöse bzw. konfessionelle, ethnische Räume und wie verlaufen ihre Grenzen? Wo werden solche Räume im Hinblick auf bestehende Nationalstaaten verortet, wie werden sie wahrgenommen, welchen Veränderungen sind sie unterworfen und schließlich welche Bedeutung haben sie bei der Konstruktion neuer Räume, z.B. der EU?
Zwar kann die Geschichtswissenschaft nur sehr bedingt Antworten auf die aktuellen Herausforderungen des sich bildenden und entwickelnden politischen Raums »Europa« geben, aber ihr kommt bei der Konstruktion einer Europäischen Geschichte bzw. für das Entwerfen neuer europäischer Geschichtsbilder eine zentrale Funktion zu. Was jedoch noch wichtiger ist: Sie kann und muss solche Entwürfe kritisch begleiten und kommentieren. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, ist es von grundlegender Bedeutung historische Erfahrungen zu erschließen und zur Verfügung zu stellen, d.h. im konkreten Fall analoge Fragestellungen anhand früherer politischer Räume zu untersuchen.
55
2. Savoyen-Piemont – ein Grenzraum?
Für derartige Fragestellungen erscheint der Herrschaftsraum der Herzöge von Savoyen[3] als geradezu ideal, auch wenn die jüngere Forschung darauf aufmerksam gemacht hat, dass der »stato di frontiera« nicht als exzeptioneller Sonderfall aufzufassen ist, sondern, wie zahlreiche frühneuzeitliche Staatswesen, aus einem mittelalterlichen Konglomerat von Rechten, Herrschaften und Privilegien, die eine Herrscherfamilie akkumulierte, gebildet und geformt wurde[4]. Trotz dieser zweifelsohne richtigen Feststellung, die zu einer relativierenden und zugleich kritischen Sicht auffordert, steht außer Frage, dass sich Savoyen-Piemont in vielerlei Hinsicht auch aus heutiger Perspektive als Grenzraum darstellt und zudem – was im Rahmen einer historischen Betrachtung nicht weniger wichtig ist – in der Vergangenheit als solcher begriffen wurde. Das Gebiet der Herzöge von Savoyen erstreckte sich dies- und jenseits des westlichen Alpenbogens. Es lag damit auf dem Rücken jenes Gebirges, das vor allem seit dem späten 18. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. als »natürliche Grenze« zwischen Frankreich bzw. Deutschland und Italien in einem angeblich grenzsetzenden Sinne proklamiert wurde[5], ein Konzept, das bereits bei Zeitgenossen wie Friedrich Engels auf Kritik stieß[6]. Ob seiner geographischen, aber auch territorial-politischen Lage und der damit verbundenen Kontrolle der Alpenpässe bedachte die Historiographie Savoyen-Piemont mit griffigen Bezeichnungen wie »Seigneurie de route«, Grenz-, Puffer-, Pass- oder Sattelstaat, das Herrschergeschlecht selbst als »Portiers des Alpes«[7].
Grenzstaat war Savoyen-Piemont im politischen Sinne, weil es als Teil des Reiches an der Grenze zu Frankreich lag. Grenzstaat – noch besser passt hier der Begriff Grenzraum – war dieses Land aber auch, weil in ihm kulturelle und sprachliche Räume aneinanderstießen. So herrschten im Westen vor allem französische und im Osten italienische Dialekte vor, während es im Norden, wenn auch wenig ausgreifend, deutsche Sprachräume gab. Selbst heute haben sich trotz veränderter politischer Grenzen diese alten Sprachräume in Teilen erhalten, so dass die sprachlichen Grenzen keineswegs mit den nationalstaatlichen korrespondieren[8].
56
Auch die Zuordnung zu den politisch-kulturellen, um nicht zu sagen »nationalen«, Großräumen ist alles andere als eindeutig. Bei einem Blick in frühneuzeitliche Literatur ist Savoyen, wie beispielsweise bei Martin Zeiller (1589–1661), mitunter als ein zu »Teutschland« gehörendes Herzogtum verzeichnet, bisweilen allerdings ohne das Reichsitalien zugerechnete Fürstentum Piemont, welches klar abgegrenzt wurde[9]. Dementsprechend nennt Zeiller – gleichwohl die Herzöge von Savoyen zu jener Zeit längst im piemontesischen Turin residierten – Chambery als »die Hauptstatt im Herzogthumb Savoya / welches von Mitternacht gränzet mit den Landschaften von Vaux, und Gez, so der Zeit Franckreich gehören / und dem Genffer See: von Morgen mit Piedmont, so aber auch Savoysch«[10]. Grund für diese Zuordnung Savoyens ist die besondere Bindung seiner Herrscher an das Reich. Seit 1361 Reichsfürsten, wurde den Grafen von Savoyen 1365 das Reichsvikariat für Arelat übertragen und seit der maximilianschen Reichsreform 1512/21 gehörten die inzwischen zu Herzögen aufgestiegenen Savoyer dem Oberrheinischen Reichskreis an. Zudem kultivierte das Haus Savoyen seit seiner Erhebung in den Herzogsstand 1416 die Legende, mit den Ottonen verwandt zu sein, verstand sich also als ein deutsches Fürstengeschlecht. Diese Selbstsicht, mit welcher der Vorrang vor den italienischen Fürsten begründet wurde, manifestiert sich auch heraldisch: So enthält beispielsweise das Wappen Emanuels Filiberts (1553–1580) heraldische Reminiszenzen an Sachsen, Westfalen, Enger und Meißen[11].
Zu Frankreich gab es hingegen neben engsten sprachlichen und kulturellen Bindungen auch dynastische. Solche Argumente, führte Frankreich neben historischen und juristischen ins Feld, um Ansprüche auf das Herzogtum bzw. Teile des Herzogtums zu erheben[12]. Zudem wurde Savoyen mit Rückgriff auf antike Vorstellungen auch geographisch Gallia zugeordnet. So setzt Sebastian Münster (1489–1552) in seiner Cosmographei die »Sophoier« mit den »Allobroges« gleich und verzeichnet sie unter Gallia, allerdings ohne die Zugehörigkeit zum Reich zu verschweigen. Durch Heinrich IV., so Münster, hätten sie »vom reich zuo eigen die verwaltung und die bevoegtung über […] die […] bisthumbmen […] Sitten / Losan[n] / Augst / Genff / und Granoble, do mit ward inen auch ein feder vom adler«[13].
Doch der Herrschaftsraum der Herzöge bestand nicht nur aus dem gleichnamigen Herzogtum, sondern eben auch aus dem Fürstentum Piemont, dem Herzogtum Aosta sowie zahlreichen anderen in Italien gelegene Territorien, so dass, wenn es um besagte Zuordnung zu einem Großraum geht, auch Italien zu nennen ist. Dies gilt umso mehr, nachdem Mitte des 16. Jahrhunderts Turin Hauptstadt jener Dynastie geworden war, unter der sich rund 300 Jahre später der italienische Nationalstaat formen sollte. Hinsichtlich der Hauptstadtverlegung erklärt Giuseppe Bastiano Malatesta um 1600:
»J Duchi di Sauia sono non più Francesi ma Jtaliani, per che lasciato già tanti anni l’asprezza, et sterilita d’oltra monti, habitano le deliciose, et fertilissime contade di Piemonte«[14].
57
Wenngleich Untersuchungen zu Savoyen-Piemont im Hinblick auf das Forschungsfeld Raum, Grenze und Grenzwahrnehmung vielversprechend erscheinen, fand dieser Herrschaftsraum in der deutschsprachigen Forschung nur wenig Beachtung, ungeachtet der Reichszugehörigkeit, der vergleichsweise guten Überlieferungssituation sowie der zahlreichen, vor allem regionalgeschichtlichen Arbeiten italienischer und französischer Historiker auf hohem Niveau[15]. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang die Publikationen, die im Rahmen des von Alessandro Pastore koordinierten Projekts Confini e frontiere nella storia. Spazi, società nell’Italia dell’età moderna[16] 2007 erschienen sind, sowie die Ergebnisse des mit EU-Mitteln geförderten Programms Interreg 1992–1996 – Le Alpi. Storia e prospettive di un territorio di frontiera[17]. Besondere Erwähnung verdient zudem der 1987 publizierte Sammelband La frontiera da Stato a Nazione. Doch auch bei diesen Veröffentlichungen wird dem 15. und frühen 16. Jahrhundert vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht, obgleich sich gerade zu jener Zeit das frühneuzeitliche Savoyen-Piemont als höchst heterogener und dynamischer Herrschaftsraum darstellt. Denn die durch Krankheit und frühen Tod der Regenten verursachte dynastische Krise, die seit der Reformation aufgebrochenen religiösen bzw. konfessionellen Gegensätze, die eidgenössischen Expansionsbestrebungen sowie der in Italien ausgetragenen Konflikt der Dynastien Habsburg und Valois stellten das Fürstenhaus vor besondere politische, militärische und diplomatische Herausforderungen, ja, drohten sogar seine Herrschaft zu vernichten[18]. Deshalb soll in vorliegender Betrachtung der Fokus auf diesen Zeitraum gerichtet sein, denn »Grenzen«, so konstatiert der Soziologe Mathias Bös, »werden erst durch ihre Überschreitung voll ins Bewusstsein gehoben«[19].
Diese allgemeine Aussage gilt im Speziellen auch bei der gewaltsamen Überschreitung von Grenzen, sprich Kriegen, die sowohl zwischen Souveränen aber auch innerhalb einer politischen Entität geführt werden können. Da mit solchen Konflikten auch das Bemühen einhergeht, diese zu unterbrechen oder zu beenden – sei es nun durch Herstellung eines wirklichen Ausgleichs oder durch die Bezwingung des Gegners – sind sie von Friedensschlüssen, Waffenstillständen aber auch Bündnisverträgen, Heiratsverträgen u.ä. flankiert. In Ihnen müssten je nach Konfliktursache Räume und ihre Grenzen benannt und definiert sein. Aufschlussreich dürften diese Quellen auch im Hinblick auf Durchlässigkeit, Linearität und Wahrnehmung frühneuzeitlicher Grenzen sein, Aspekte die schon länger in der historischen Forschung diskutiert werden und mit Axel Gotthards 2007 erschienenem Buch In der Ferne[20] neue Brisanz erhalten haben, wie sich erst kürzlich wieder auf der Tagung »Grenzen und Grenzüberschreitungen« im Rahmen des von Andreas Rutz gehaltenen Vortrags über Territoriale Grenzen gezeigt hat[21].
Beginnend mit der Regentschaft der savoyischen Herzogin Jolande von Frankreich (1469) und endend mit dem Restitutionsvertrag von Turin (1574) werden deshalb im Rahmen dieser Untersuchung Verträge ausgewertet, die Savoyen-Piemont betreffen und über die Mainzer Bilddatenbank http://www.ieg-friedensvertraege.de sowie über ältere Editionen[22] verfügbar sind. Die Auswertung der Quellen geschieht im Hinblick auf Grenz- und Raumbeschreibungen sowie entsprechende Begrifflichkeiten[23], wobei der Fokus auf das Territorium und den politischen Raum gelegt wird. Neben methodischen Argumenten spricht für den gewählten Ansatz auch die Tatsache, dass Friedensverträge[24] im Rahmen des hier behandelten Thema durchaus im Blickfeld der Forschung stehen, aber dennoch nicht umfassend ausgewertet sind. Bezeichnend hierfür ist die Äußerung von Claude Raffestin, der eine genaue Untersuchung von Friedensverträgen im Hinblick auf die Beschaffenheit von Grenzen zwar als Möglichkeit in Betracht zieht, aber ein solches Unternehmen für irrsinnig hält, zumal für ihn das Ergebnis offenbar schon feststeht:
»Uno studio minuzioso dei trattati – impresa folle sotto molti aspetti – permetterebbe, al momento degli accordi di pace, di seguire l’emergere della linearità nella definizione delle frontiere«[25].
58
4. Territoriale Grenzen – territoriale Räume
Eine Ausgangsvermutung dieser Untersuchung war, dass in Friedensverträgen Grenzen konkret beschrieben seien, da es Teil des Wesens solcher Vereinbarungen ist, Gebietsstreitigkeiten bei- und Gebietszugehörigkeiten festzulegen. Umso mehr überrascht es, dass dies nur selten der Fall ist. Genannt werden vor allem Gebiete, so dass sich Formulierungen finden wie »in hiis scilicet limitibus, videlicet per dyoceses et episcopatus Sedun[ens]em, Lausan[nens]em et Geben[nens]em«[26] oder »extraneum et extra marchas et limites Ducatus Sabaudie«[27]. Gelegentlich sind die Gebietsaufzählungen aber auch detaillierter. So im Friedensvertrag von Cateau-Cambrésis, der 1559 zwischen der französischen und spanischen Krone geschlossen wurde. Gemäß einer der Vereinbarungen überlässt König Heinrich II. von Frankreich, nachdem der Herzog von Savoyen die Schwester des Königs, Margarete von Frankreich geheiratet hat
»[…] l’entiere & pleine possession paisible, tant du Duché de Savoye, Pais de Bresse, Bugey, Veromey, Morienne, Tarentaise, et Vicairie de Barcelonette, comme de la Principauté de Piémont, Comté d’Ast, Marquisat de Ceve, Comté de Coconas, & Terres de Lannes de Gatieres, & Terres de la Comté de Nice, delà du Var«[28].
Städte, Orte oder Befestigungen finden in solchen Verträgen gleichfalls Erwähnung, dann und wann auch mit dem dazugehörigen Umland. Im Schiedsvertrag von Lausanne (1564) wird beispielsweise die »Landtschafft Waat sampt der Jetzernenten Fleckhen und Herrschaften Niews, Vivis, Thun, Chillion und Rüwenstatt In Ihrem bezirckh und begriff, ouch in Ihren Anstossen, Limiten und Marchen […]«[29] genannt. Diese zuweilen kleinteilige Nennung von Territorien größerer Herrschaftsräume trägt der ins Mittelalter zurückreichenden Entstehung des frühneuzeitlichen Herrschaftsterritoriums Rechnung, das, so formuliert Achim Landwehr prägnant, aus »einer Addition rechtlich verbürgter Herrschaftskompetenzen über Personen, Kommunen oder Flächen« bestand[30].
Landwehr, der für das Venedig des 16. und 17. Jahrhunderts gleichfalls festgestellt hat, dass Grenzen eher selten eigentlicher Gegenstand herrschaftsrechtlicher Regelung waren, erklärt seinen Befund damit, dass sich ein frühneuzeitliches Territorium nicht als geschlossenes und rechtlich einheitlich erschlossenes Staatsgebiet darstellte, sondern aus einer Akkumulation von Herrschaftsrechten bestand. Diese hätten zwar eine räumliche Dimension, seien aber vor allem über die Inhalte, weniger über die Ränder räumlicher Zugriffsrechte bestimmt worden. Zudem bewirke diese Fragmentierung, dass Grenzen eines frühneuzeitlichen Territoriums nicht durchgängig gewesen seien, sondern sich aus einer Vielzahl einzelner Grenzabschnitte zusammengesetzt haben. Lediglich in Abschnitten, in denen es politisch notwendig oder wirtschaftlich vorteilhaft erschien, versuchte man Grenzen zu etablieren[31].
59
Inhaltliche Bestimmung von Herrschaftsrechten, Addition von Herrschaftskompetenzen sowie damit einhergehende Stückelung des Territoriums in kleine Entitäten, sind bei der Behandlung frühneuzeitlicher Herrschaftsräume zweifelsohne nicht zu unterschätzende Aspekte, die auch von anderer Seite in der Forschung angeführt und hier nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden[32]. Im Gegenteil, sie können auch anhand der hier untersuchten Quellen belegt werden. Allerdings geben sie nur einen Teil der komplexen frühneuzeitlichen Realität wieder, die eben auch das kannte, was in der Forschung unter den Begriffen Territorialisierung von politischer Herrschaft[33] und staatliche Verdichtung[34] subsumiert wird, Prozesse, deren Beginn durchaus ins Mittelalter zurückreichen. Im Falle Savoyens ist sicherlich eine frühe Etappe dieses Prozesses auf das Jahr 1310 zu datieren, als Amedeus V. seine auch im politischen Sinne wenig homogene Grafschaft König Heinrich VII. schenkte, der diese zum Fürstentum erhob und 1313 rückübertrug, was Giovanni Tabacco 1965 treffend als »consecrazione ufficiale di uno stato territoriale già in via di organisazzione« bezeichnete[35].
Wenn aber personelle und territoriale Vorstellungen zwei Seiten einer frühneuzeitlichen Medaille sind, stellt sich die Frage, ob die Nennung eines Herrschaftsraums oder der darin enthaltenen kleineren Entitäten zwangsläufig die Vorstellung klar definierter, linear gedachter Grenzen ausschließt. Um das Problem mit einer provokanten und zugleich rhetorische Frage zu verdeutlichen: Schließt eine moderne Formulierung wie »in den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland« oder »Die gesamte Bundesrepublik, sowohl Bayern, Baden Württemberg … usw. … wie auch Berlin und Brandenburg …« eine lineare Grenzvorstellung aus? – Natürlich nicht! Die Nennung konkreter Grenzen in völkerrechtlichen Verträgen ist auch in der Gegenwart, d.h. in einer Zeit, in welcher nationalstaatliche Grenzen vor allem linear gedacht werden und welche die technischen Möglichkeiten einer präzisen Kartographie besitzt, keineswegs notwendig. Entgegen Cornelia Jöchners Aussage, dass das frühneuzeitliche Territorium im Gegensatz zum späteren Nationalstaat stehe, »der seine Souveränität gerade aus einer durch exakte Grenzen definierte Landesfläche bezieht«[36], erklärt der Staatsrechtler Stefan Hobe:
»Während heute die Grenzen zwischen den staatlichen Hoheitsräumen typischerweise genau bestimmt sein werden, fordert das Völkerrecht für das Vorliegen von Staatlichkeit keine solche detaillierte Festlegung«[37].
Wenn dies aber für den modernen Staat gilt, ist im Umkehrschluss aus der Nennung eines Territoriums oder einer Teilherrschaft in frühneuzeitlichen Verträgen nicht zwangsläufig davon auszugehen, dass dies aufgrund mangelnder Konkretheit geschieht. Auch durch das Zusammenfügen von einzelnen konkret begrenzten Teilherrschaften, die sich wiederum aus kleineren Entitäten zusammensetzen, kann ein größeres Territorium erzeugt werden, das nach außen hin eine klar definierte Grenze besitzt. Eine solche (Zer-)Gliederung lässt sich bis in kleinste Einheiten, d.h. einzelne Grundstücke oder Äcker fortsetzen, was aufgrund der beschränkten Vermessungs- und Darstellungstechniken auch gar nicht anders machbar war. Dass Grenzen, die durchaus linear begriffen wurden, im kleinräumigen Maßstab bekannt waren, darf vorausgesetzt werden, denn ihre technische Fixierung bereitete selbst in mittelalterlicher Zeit kaum Schwierigkeiten und ihr Verlauf ist aus Urbaren, Weistümern, Bannbegehungen, zum Teil auch aus Kaufverträgen und ähnlichen Quellen bekannt[38].
Nun ist unbestritten, dass im frühneuzeitlichen Territorium parallele, oft konkurrierende rechtliche, politische und administrative Einheiten bestehen. Doch ist auch zu bedenken, dass dennoch der Souverän oder Landesfürst in vielen Fällen die Oberhoheit oder eine vergleichbare Machtkompetenz besaß[39]. Ausdrücklich heißt es beispielsweise im Schiedsvertrag von Lausanne (1564) im Hinblick auf die von Bern an den Herzog von Savoyen zu restituierenden Gebiete, dass
»alle derselben Heerschafften und Landen Inwonere und Underthanen der Hulldigungen und Eidts Pflichten, die Si Inen gethan haben mochtenn, ledigen und entschlachen, Und dieselben Heerschafften Jetzgehorter gstallten der Hochgenanten Fürstl. Duchl. zu Savoy Inrumen, ubergeben und zustellen sollen […]«[40].
Zudem konnte ein Souverän je nach politischem Geschick und Durchsetzungsfähigkeit auch die Herrschaft über Enklaven, die auf seinem Gebiet lagen, ausüben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Besetzungen des Bischofsstuhls in der freien Stadt Genf während des 15. und frühen 16. Jahrhunderts, wodurch Personen, die den savoyischen Herzögen nahestanden – und das meist in einem verwandtschaftlichen Verhältnis – de facto die Stadtherrschaft ausübten. Auch widerspricht die Existenz von En- bzw. Exklaven keineswegs prinzipiell der klaren Umgrenzung eines Territoriums. Das belegen zumindest für die heutige Zeit der Vatikansstaat, San Marino oder die auf Schweizer Staatsgebiet gelegen Exklaven Büsingen (Deutschland) und Campione d’Italia, um nur einige zu nennen.
Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen, stellt sich die Frage, wann Grenzen eines Territoriums oder einer Teilherrschaft konkret beschrieben wurden? Die Antwort ist nach dem Quellenbefund so eindeutig wie banal: Immer dann, wenn es notwendig war, das heißt, wenn aufgrund von Teilung bzw. Neudefinition eines Gebiets oder Grenz-, nicht unbedingt Gebietsstreitigkeiten (!), die Definition der Grenze(n) unerlässlich wurde. Dabei taucht der Grenzbegriff oder sein Äquivalent oft gar nicht auf, sondern nur die Beschreibung der Grenzlinie.
60
Der Heiratsvertrag zwischen Karl I. von Savoyen und Bianca von Montferrat (1485) ist trotz seiner Ambivalenz ein Beispiel hierfür[41]. Neben einer Mitgift von 80000 Dukaten wird der Braut zusätzlich, falls ihr Onkel Markgraf Bonifazius III. von Montferrat ohne männliche Nachkommen sterben sollte, »omnes terras loca jurisdictiones, homagia, superioritates et Jura quae habet ultra Padum« in Aussicht gestellt[42]. Ausdrücklich behält sich jedoch der Markgraf weiterhin zu seiner freien Verfügung vor
»reliquum dominii[43] Marchionatus, videlicet civitates castra terras loca jurisdictiones iura et dominia mediata et i[m]mediata existentes et existentia citra Padum ubicumq[ue], et tam in Monteferrato quam in partibus ultratanagru[m] et in quibuscu[m]q[ue] aliis p[ar]tibus«[44].
Während zunächst in allgemeiner Form Grundstücke, Orte und Herrschaftskompentenzen genannt werden und eine räumliche Dimension nur wage zu erkennen ist, wird später vom Rest der markgräflichen Herrschaft gesprochen und zwar diesseits, d.h. rechts des Pos oder sonst wo, sowohl in Montferrat als auch jenen Teilen jenseits, d.h. rechts des Tanero und in anderen Teilen. Montferrat wird hier eindeutig als Gebietsbezeichnung im Rahmen einer Beschreibung gebraucht. Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Grenzen dieses Gebiets bekannt sind. Es stellt sich allerdings die Frage, warum ausgerechnet dieses Gebiet explizit genannt werden musste. Wenn es lediglich um das Herrschaftsrecht gegangen wäre, hätte es ausgereicht festzulegen, dass Orte, Rechte, Herrschaft usw. links des Pos an Bianca gehen sollen, ansonsten aber alles rechts des Pos durch den Vertrag nicht berührt wird. Grund für die genaue Formulierung sind die Ansprüche, welche Savoyen seit dem Geheimvertrag von Thonon 1432 im Hinblick auf Montferrat anmeldete. Damals erklärte sich der massiv bedrängte Markgraf Giangiacomo Paläologos bereit, Amadeus VIII. von Savoyen als Gegenleistung für die Rückgabe seiner von Mailand und Savoyen besetzten Territorien, die Markgrafschaft Montferrat abzutreten, und zwar das Gebiet links des Pos wie auch links des Tanaros. Amadeus VIII. wiederum sollte dann dieses Territorium dem Thronfolger Johann von Montferrat zu Lehen geben. Ob des Vertrags, der letztlich nicht eingehalten wurde, kam es in der Folgezeit zu zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen den Kontrahenten[45]. Um eventuellen Ansprüchen aus dem Vertrag von Thonon entgegenzutreten, war es folglich seitens des Markgrafen Bonifazius notwendig, unmissverständlich klar zu machen, dass nur links des Pos die Oberhoheit (superioritas) über Montferrat auf Bianca übertragen werden soll. Alle andere Herrschaftsrechte, insbesondere die über den zwischen Po und Tanero gelegenen Teil von Montferrat, bleiben weiterhin in der Verfügungsgewalt Bonifazius’. Im Prinzip geht es hier um die Teilung des ursprünglichen Gebiets der Markgrafschaft, deren Grenzen offensichtlich als bekannt vorausgesetzt wurden; neu zu definieren war deshalb nur der Grenzverlauf, der durch die Teilung entstand.
61
Auch in der bereits zitierten Passage aus dem Vertrag von Cateau-Cambrésis findet sich die Nennung eines Grenzflusses. Nach einer einfachen Aufzählung verschiedener zu restituierenden savoyischen Territorien, werden am Ende die »Terres de la Comté de Nice« genannt und zwar »delà du Var«[46]. Die Notwendigkeit eine Grenzlinie zu nennen, um Missverständnissen oder Ansprüchen vorzubeugen, bestand auch in diesem Fall. Denn Nizza war einst Teil der Provence und kam 1388 gemeinsam mit dem dazugehörigen Gebiet sowie der Grafschaft Beuil an Savoyen, während die übrige Provence 1481 an Frankreich ging und somit aus dem Heiligen Römischen Reich ausschied[47]. Der Erwerb der »Terra nova Provinciae in partibus Niciae et aliis locis provinciae«[48], der künftigen Grafschaft Nizzas[49], durch die Herzöge von Savoyen war eine Zäsur, die laut Joseph Napoléon Fervel (1811–1877) »coûtera quatre cents ans de guerre sur le Var«[50]. Auch Wilhelm Heinrich Schinz bemerkt 1842:
»In der That lässt sich der Küstenstrich von Antibes bis Nizza nur künstlich trennen, daher auch in älterer Zeit Nizza nicht sowohl als eine italienische, sondern mehr als eine zwischen Italien und der Provence liegende Stadt betrachtet und Nizza di Provenza genannt wurde«[51].
Auf der anderen Seite kannte bereits Petrarca im Rückgriff auf die Antike den Var als Grenzfluss zwischen »Frankreich« und »Italien«[52]. Er schreibt 1336 an den Dominikaner Giovanni Colonna:
»Eine ungemein lästige Verzögerung, so schreibst Du recht entrüstet, habest du in Nizza erlebt und einen ganzen Monat lang darauf gewartet, dass dich irgendein Schiff nach Italien bringe. Und doch bist Du, während Du Dich nach Italien sehntest, bereits in Italien gewesen, so sage ich, wenn wirklich – gemäss der Auffassung der Dichter und der Kosmographen – der Fluss Varo die Grenze Italiens bildet«[53].
Anhand des Gezeigten, dürfte deutlich geworden sein, dass auch im Falle Nizzas als ehemaliger Teil der Grafschaft Provence und aufgrund der währenden Differenzen um die westliche Grenzziehung eine einfache territoriale Nennung im Vertrag nicht eindeutig gewesen wäre.
Die bisherigen Beispiele deuten darauf hin, dass die Nennung von Herrschaftsräumen meist ausreichend war und deren Grenzen, weil bekannt, nur in seltenen Fällen beschrieben werden mussten. Allerdings handelt es sich nicht um Grenzbeschreibungen im eigentlichen Sinne, sondern um Kurznennungen von Grenzverläufen, die deshalb genügten, weil sie einem Flusslauf folgten. Anders verhält sich das bei dem bereits mehrmals erwähnten Lausanner Schiedsvertrag.
62
6. Konkrete Grenzbeschreibungen
Der 1564 zwischen Savoyen und Bern geschlossene Lausanner Schiedsvertrag ist ein wahrer Quell konkreter, linearer Grenzbeschreibungen. Geschlossen wurde er im Beisein französischer und spanischer Gesandter unter Mediation von elf der dreizehn eidgenössischen Orte. Bern als Kontrahent sowie Freiburg fehlten. Vertragsgegenstand war im weiteren Sinn die Beilegung der seit rund hundert Jahren währenden Territorialstreitigkeiten zwischen Bern und Savoyen, im engeren Sinn die Rückgabe eines Teils der im Jahre 1536 von der Stadt Bern eroberten savoyischen Länder. Nach einer sehr ausführlichen Einleitung, welche die Geschichte der Verhandlungen seit 1560 dokumentiert[54], folgen dann die eigentlichen Vertragspunkte. Sie beginnen zunächst mit zwei grundlegenden Bestimmungen ohne Nummerierung[55] und werden dann mit zwanzig präzisierenden, nummerierten Artikeln fortgesetzt[56].
Entsprechend der Hauptbestimmung sollen Pays de Gex vollständig sowie die jenseits, d.h. südlich des Genfer Sees und der Rhone gelegenen Gebiete des Chablais und das Genvois an den Herzog zurückgegeben werden. Dagegen soll die Landschaft Waadt, die Herrschaft und Vogtei Nyon sowie die Flecken und Herrschaften Vevey, Tour-de-Peilz, Chillon, Villeneuve in »Ihrem Bezirckh und Begriff, ouch In Iren anstossen, Limiten und Marchen […] Denselben Herren der Statt Berrn alls Ir recht eygenthumb plieben«[57].
Der Genfer See, den bereits Sebastian Münsters Cosmographei »ein Scheidmauer zwüschen den Helvetiern und […] Saphoier«[58] nennt, wird Grenzgewässer. Die Rechte an ihm sollen sich gemäß Artikel 20 beide Vertragspartner entsprechend der von ihnen gehaltenen Herrschaften und Flecken teilen, d.h. die Grenzen zwischen zwei Territorien setzen sich im Wasser bis zur Gewässermitte hin fort. Es handelt sich hierbei um ein frühes Beispiel für eine Grenzziehung, in dem ein Gewässer nach dem auch heute noch im internationalen Recht gültigen Prinzip der Proportionalität geteilt wurde. Dieses Prinzip, das erst ca. hundert Jahre später durch Samuel von Pufendorf (1632–1694) abstrahiert und konkret ausformuliert wurde, sollte im 19./20. Jahrhundert maßgeblich für die Ziehung von Seegrenzen werden[59]. Doch wird nicht nur die der Uferlänge entsprechende Breite des Gewässerabschnitts, die jeder Vertragsparnter innehaben soll, festgelegt, sondern auch, wie weit in den See sich das »Gebiet« erstreckt. Die »mitte des Sews« soll aber, so heißt es weiter im Lausanner Schiedsvertrag,
»gegen yedentheils daranstoßender und gelegner Landen und Herrschaften, so wyt die In Irem zirckh un begriff reichen, zu einer bestendigen / rechten und heytern March gesetzt und benambsset sin«[60].
Nun könnte, wie bei Sebastian Münster, der den gesamten See als Scheidmauer bezeichnet, mit dem im Vertragswerk verwendeten Begriff »Mark« ein Grenzsaum gemeint sein. Dem widerspricht jedoch zum einen das Adjektiv »heiter« im Sinne von »klar«, »eindeutig«, zum anderen die weitere Bestimmung der Grenzlinie »zu verhütung künfftiger Spennen und Irthumben«[61]. Dieser Bestimmung zufolge setzt die Grenzlinie »von der mitte des Sews richtig ze Landt In ein Pfad oder weg zu Braillies«[62] zwischen Coppet und Versoix fort. Über eineinhalb Seiten wird dann der konkrete Grenzverlauf zwischen dem Pays de Gex und der Waadt samt Nyon beschrieben. Zum Teil werden dabei Wege und Flussläufe als Grenze genannt. Dabei bleibt unklar, ob diese durch eine abstrakte Mittellinie geteilt werden oder ob sie als neutraler »Grenzstreifen« wahrgenommen werden. Selbst wenn letzteres zuträfe, scheint es jedoch aufgrund der geringen Breite dieser Grenzstreifen übertrieben, von einem Grenzsaum zu sprechen, zumal die Linearität der Grenzlinie an anderer Stelle wieder sehr deutlich hervortritt. So heißt es zum Beispiel: »Hus und guter eines Landtmans, Arcangier genant, so Bysenhalb gelegen, plibend samt der großen Straß obstat in der Waat […].« Und an anderer Stelle ist zu lesen:
»An wellichem Ort […] gat die March durch dieselbe große Landtstraß Bysenhalb bis under die Brugck Crassiers Sews halb […] so uber das Wasser gat, Le Boyron genant, Da dieselb gemein straß windtshalb gegen demselben wasser Le Boyron In der Heerschafft Gex plibt, Und was Sews und Bysenhalb ist, In der Waat«[63].
Offensichtlich werden selbst Straßen, denen der Grenzverlauf folgt, eindeutig einer Herrschaft zugeordnet, so dass von einer linearen Grenzvorstellung auszugehen ist. Sogar bei der Beschreibung des Grenzverlaufs anhand von Wäldern bleibt die Vorstellung linear und der Wald wird einer Herrschaft zugesprochen:»[…] und wieder uß dem wasser des Boyrons gat Si [die March] an und zwüschen einen Holltz hin, genant Recredoz, wollich Holltz […] In der Waat soll bliben«[64].
Ein anders Beispiel für einen Vertrag, in dem ein Grenzabschnitt aufgrund einer Gebietsteilung konkret beschrieben werden muss und der zudem in engem Zusammenhang mit dem vorherigen Vertrag steht, ist der 1569 zwischen Savoyen-Piemont und dem Wallis geschlossene Bündnisvertrag von Thonon. Bei ihm handelt es sich um eine Erneuerung der Allianz von 1528 sowie um die partielle Restitution der von den sieben Zenden des Wallis 1535/36 besetzten Gebiete. Hintergrund hierfür war die Okkupation des savoyischen Waadtlands sowie der Stadt Genf durch das reformierte Bern. Als Berner Truppen nun weiter ins Chablais vorzustoßen drohten, baten die 43 Gemeinden östlich der Dranse von Monthey bis Evian, welche unter der stark bedrängten savoyischen Herrschaft standen, die katholischen Walliser möchten sie besetzen, damit sie bei ihrem katholischen Glauben bleiben könnten. Sobald jedoch ihr Fürst wieder über seine Lande verfügen würde, wollten sie unter seine Herrschaft zurückkehren. Die Sieben Zenden kamen der Bitte gerne nach, da sie wenig Interesse hatten, von zwei Seiten von der Berner Herrschaft umschlossen zu werden, und darüber hinaus auf Gebietszuwachs hofften. Sie wollten die besetzten Gebiete allerdings erst an Savoyen zurückzugeben, wenn Bern dies ebenfalls tun würde. Als mit dem Lausanner Schiedsvertrag Bern nun die Gebiete südlich des Genfersees an Savoyen restituierte, weigerten sich die Walliser zunächst, ihr Versprechen einzulösen. Erst mit dem Bündnisvertrag von Thonon, kam es zu einer Einigung: Die Landvogteien Evian und das Hochtal erhielt Savoyen zurück, während die Landvogtei Monthey, welche dem Wallis den Zugang zum Genfersee sicherte, Untertanenland der Sieben Zenden blieb[65]. Entsprechend ist der Grenzverlauf beschrieben:
»Dicti Domini septe[m] Desenorum patriae Vallesii restituent et remittent effectuabliliter dicto Serenissimo Domino Duci Gubernamentum Aquiani a ponte Dranciae usq[ue] ad finem pontis S[anc]ti Gingolphi et aquam nuncupatum de la Morge transeuntem subtus dictum pontem inclusive: sic quod pons et aqua erunt et pertinebunt integre dicto Serenissimo Domino Duci et suis Successoribus cum omnibus et quibuscunq[ue] Juribus et pertinetiis dictarum patriarum restituendarum, sine aliqua retensione et reservatione«[66].
Der Herzog hingegen überlässt den Wallisern »sine reservatione aliqua In gubernamento et ressortu Montheoli a fine pontis Sacti Gingolphi ultra, tam in planis quam In montibus et lacu[…]«[67]. Die Morge wird Grenzfluss, wobei die Rechte an dem Gewässer des Herzogs sind, womit erneut ein Grenzfluss einer Herrschaft zugeordnet wird, so dass die eigentliche Grenze aus einer gedachten Linie jenseits des Flusses entlang dessen Lauf besteht.
63
7. Grenzlinien und linear begrenzter Räume
Eine Ausgangsüberlegung war, dass die Nennung von Herrschaften und Orten nicht unbedingt aufgrund des Mangels an konkreten, linearen Grenzverläufen erfolgt sein muss[68]. Wie kompliziert und umständlich sich eine konkrete Grenzbeschreibung darstellen kann, hat der Lausanner Schiedsvertrag, von dem hier nur kleine Fragmente wiedergegeben wurden, gezeigt. Im Vergleich hierzu ist es weit einfacher, ökonomischer und zugleich nicht weniger genau, wenn Herrschaften, Orte mit ihrem Territorium oder vergleichbaren Entitäten genannt werden, stets vorausgesetzt, dass deren Grenzen bekannt sind. Dass so verfahren wurde, darauf weisen die bisher genannten Beispiele hin. Sie zeigen, dass Grenzverläufe in den Friedensverträgen nur dann Erwähnung fanden, wenn sie umstritten oder unklar waren bzw. neu definiert wurden. Doch letztlich fehlt bisher noch ein konkreter Beleg, dass die Nennung von Gebieten ebenso präzise sein konnte, wie die Beschreibung von konkreten Grenzverläufen. Dass dem tatsächlich so ist, zeigen zwei Bündnisverträge, die zwischen dem Herzog von Savoyen einerseits und Mitgliedern der Eidgenossenschaft andererseits geschlossen wurden.
In der Berner Bündniserneuerung von 1477[69] verpflichtet sich Jolande von Frankreich, Herzogin von Savoyen, als Vormund und im Namen ihres Sohnes bei einem entsprechenden Hilfegesuch innerhalb eines Monats Bern und Freiburg (Schweiz) gegen Angreifer beizustehen und zwar in
»[…] hiis scilicet limitibus, Videlicet tendendo ab urbe Bernen[si] vel Friburgen[si] usq[ue] ad Thuregum, sequendo flumen vulgo Limmagd nuncupatum et usq[ue] ad flumen Ararum, Inde tenendo ad montem vulgo Howenstein, et de hinc ad petram dictam pierre pertuis […]«[70].
Im korrespondierenden Artikel, der Bern und Freiburg in gleicher Weise zur militärischen Hilfe verpflichtet und der vergleichbar formuliert ist, heißt es hingegen lediglich »in hiis scilicet limitibus, videlicet per dyoceses et episcopatus Sedun[ens]em, Lausan[nens]em et Geben[nens]em ubicumq[ue] […]«[71].
Während der in Savoyen-Piemont liegende Verteidigungsraum durch die Nennung der Diözesen Sitten, Lausanne und Genf, ausreichend präzise beschreiben werden kann, ist das für den bernisch-freiburgischen Verteidigungsraum nicht ohne weiteres möglich, da dieser über das Territorium der beiden Städte hinausreicht. Den komplexen Herrschaftsverhältnissen in der Eidgenossenschaft, die sich aus den eigentlichen Mitgliedsorten[72], deren jeweiligen Untertanengebieten sowie den zugewandten Orten und den gemeinen Herrschaften zusammensetzte, wird damit Rechnung getragen. Das gleiche gilt für den Bündnisvertrag von Solothurn aus dem Jahre 1502[73]. Dieser nennt für den savoyischen Verteidigungsraum erneut die drei besagten Diözesen.[74]. Dagegen wird zuvor für den Solothurner Verteidigungsraum der Lauf der Verteidigunslinie definiert:
»[…] hiis scilicet limitib[u]s, videlicet ab urbe Solodoren[si] In et ad dominia n[ost]ra Baechburg, Olten, Gösken, Erlispach, Werd, Kyemberg, Büren, Dornegk, Pfeffingen, Tierstein, Valkenstein usque ad fontem Aure, vulagri theutonico Genssbrunnen appellatu[m], et ab eod[em] fonte montem Jecoris vulgo den Lebern, usq[ue] ad oppidum Biennensem, vulgo Byel nu[n]cupat[um] sequendo […]«[75].
Weshalb in beiden Fällen hinsichtlich des eidgenössischen Verteidigungsraums nur die westliche und nordwestliche Verteidigungslinie beschrieben wird, erklärt sich aus der Tatsache, dass nur aus dieser Richtung Angriffe zu erwarten waren; östlich und südlich grenzten an besagte Orte verbündete Herrschaften an. Von zentraler Bedeutung ist jedoch bei diesen beiden Bespielen, dass lineare Grenzen – in diesem Falle Verteidigungslinien – und Teilherrschaften im gleichen Kontext genannt werden. Da auszuschließen ist, dass im Hinblick auf die Verteidigungslinien in ein und dem selben Vertrag unterschiedliche Grenzvorstellungen existiert haben, lassen sich die beiden Bündnisverträge als eindeutiger Beleg anführen, dass die Nennung von Herrschaften oder Teilherrschaften durchaus mit der Vorstellung von konkreten und linearen Grenzen einhergegangen war.
64
Die hier vorliegende Betrachtung, die lediglich den kleinen Aspekt Herrschaftsräume und territoriale Grenzen in Savoyen-Piemont beleuchtet hat, zeigt bereits, welches Potenzial der sorgfältigen Analyse von Friedensverträgen als Quelle für die Grenz- und Raumforschung innewohnt. Als grundlegende Erkenntnis kann festgehalten werden, dass die räumliche Dimension für das Verständnis frühneuzeitlicher Territorien nicht zu unterschätzen ist, auch wenn diese in kleine und kleinste Entitäten gegliedert waren. Herrschaftsräume und deren Umgrenzung unterliegen zum großen Teil sehr konkreten Vorstellungen, sind allerdings auch häufig sehr komplex aufgrund des besonderen Charakters frühneuzeitlicher Territorien. Dementsprechend kann Christine Rolls These[76], dass die Frühe Neuzeit als eine Epoche besonders komplexer und dynamischer Grenzen zu gelten habe, im Falle dieser freilich zeitlich und räumlich stark begrenzten Untersuchung bestätigt werden. Das Nennen von Territorien und Teilherrschaften ist schließlich weniger darauf zurückzuführen, dass die Ränder räumlicher Zugriffsrechte nur geringe Relevanz gehabt hätten, sondern kann vielmehr als eine Ökonomisierung von oft komplexen Grenzbeschreibungen gesehen werden. Zumindest die hier untersuchten Quellen belegen, dass die Zeitgenossen nicht nur im Lausanner Schiedsvertrag Wert auf eine »bestendige, rechte und heytere March« legten.
65
Balbo, Cesare: Delle speranze d’Italia, Paris 1844.
Barberis, Walter (Hg.): I Savoia. I secoli d’oro di una dinastia europea, Turin 2007 (Bibliothec die cultura storica 260).
Ders.: I Savoia. Quattro storie per una dinastia, in: Ders. (Hg.): I Savoia. I secoli d’oro di una dinastia europea, Turin 2007 (Bibliothec die cultura storica 260), S. XV–LI.
Bätzing, Werner: Kleines Alpenlexikon: Umwelt, Wirtschaft, Kultur, München 1997 (Beck’sche Reihe 1205).
Ders.: Die Alpen: Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft, 2. Auflage, München 2003.
Bertrand, Régis: Art et histoire, in: Ders. u.a.: Provence. Encyclopédies Régionales Christine Bonneton, Paris 2002, S. 9–64.
Burckhardt, Carl Jacob: Gesammelte Werke, Bd 1: Richelieu, Bern u.a. 1971.
Conrad, Christoph (Hg.): Mental Maps, Göttingen 2002 (Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft 28/3).
Cerino Badone, Giovanni: »I portinai delle Alpi«. Strategie, tattiche e dottrine di impiego dell’esercito sabaudo nella Guerra di Successione Austriaca (1742–1748), in: Armi Antiche o.Nr. (2007), S. 105–165.
Comoli, Vera u.a. (Hg.): Le Alpi. Storia e Prospetive di un territorio di frontiera, Torino 1997.
DBI; Dizionario biografico degli italiani, hg. v. Alberto M. Ghisalberti u.a., bisher erschienen 71 Bde, Rom 1960ff.
Dotzauer, Winfried: Die deutschen Reichskreise (1383–1806): Geschichte und Aktenedition, Stuttgart 1998.
DUM; Dumont, Jean Baron de Carelscroon: Corps universel diplomatique du droit des gens; contenant un recueil des traitez d’alliance, de paix, de treve, de neutralité, de commerce, qui ont eté faits en Europe, depuis le Regne de l´Empereur Charlemagne jusques à présent, 8 Bde., 2 Suppl.-Bde., Amsterdam 1726–1739.
Endres, Rudolf: Adel in der frühen Neuzeit, München 1993 (Enzyklopädie deutscher Geschichte 18).
Exterbrink, Sven: Le Coeur du Monde. Frankreich und die norditalienischen Staaten (Mantua, Parma, Sacoyen) im Zeitalter Richelieus 1624–1635, Münster 1999 (Geschichte 23).
EA; Amtliche Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede, hg. v. Jakob Kaiser u.a., 8 Bde., Luzern u.a. 1856–1876.
Engels, Friedrich: Savoyen, Nizza und der Rhein, in: Richard Bernstein (Hg.): Po und Rhein/Savoyen, Nizza und der Rhein. Zwei Abhandlungen, Stuttgart 1915 (Kleine Bibliothek 32).
Fervel, Joseph Napoléon: Histoire de Nice et des Alpes Maritimes Pendandt Vingt et un Siècle, Paris 1862.
Gentile, Luisa Clotilde: Lo stemma e le sue variazioni specchio della politica dei Savoia in età moderna, in: Walter Barberis (Hg.): I Savoia. I secoli d’oro di una dinastia europea, Turin 2007 (Bibliothec die cultura storica 260), Bildteil mit Texten im Anschluss an die Einleitung S. LI.
Goria, Axel: Bonifacio III., in: DBI, Bd. 12, Roma 1970, S. 128–131.
Gotthard, Axel: In der Ferne. Die Wahrnehmung des Raume in der Vormoderne, Frankfurt 2007.
Greyerz, Hans von: Nation und Geschichte im bernischen Denken: vom Beitrag Berns zum schweizerischen Geschichts- und Nationalbewußtsein. Festschrift zur Gedenkfeier des sechshundertsten Jahrestages des Eintritts Berns in den ewigen Bund der Eidgenossen, Bern 1953.
Guichenon, Samuel: Histoire Généalogique De La Royale Maison De Savoie, Bd. IV.12, Turin 1780, S. 434–435.
Heller, Hermann/Niemeyer, Gerhart: Staatslehre, 6. überarb. Auflage, Tübingen 1983.
Hobe, Stephan/Kimminich, Otto: Einführung in das Völkerrecht, 9., akt. u. erw. Auflage, Tübingen u.a. 2008 (UTB 469: Rechtswissenschaften, politische Wissenschaft).
Jöchner, Cornelia: Der Außenhalt der Stadt. Topographie und politisches Territorium in: Turin, in: Dies. (Hg.): Politische Räume: Stadt und Land in der Frühneuzeit, Berlin 2003 (Hamburger Forschungen zur Kunstgeschichte 2), S. 67–90.
Just, Leo: Das Haus Savoyen und der Aufstieg Italiens, Bonn 1940 (Kriegsvorträge der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn a. Rh. 19).
Landwehr, Achim: »Die Zeichen der Natur lesen. ›Natürliche‹ Autorität im habsburgisch-venezianischen Grenzgebiet«, unveröffentlichtes Skripts des am 24. September 2009 gehalten Vortrages im Rahmen der Aachener Tagung »Grenzen & Grenzüberschreitungen«.
Ders.: Die Erschaffung Venedigs: Raum, Bevölkerung, Mythos 1570–1750, Paderborn u.a. 2007.
Ders.: Der Raum als »genähte« Einheit: Venezianische Grenzem im 18, in: Jahrhundert/Behrisch/Lars (Hg.): Vermessen. Zählen, Berechnen: die politische Ordnung des Raums im 18. Jahrhundert, Frankfurt/Main 2006 (Historische Politikforschung 6), S. 45–64.
Leo, Heinrich: Geschichte der italienischen Staaten, Bd. 3, Hamburg 1829 (Allgemeine Staatengeschichte Abt. 1, Werk 3 [vielmehr 2], Bd. 3).
Le Roy Ladurie, Emmanuel: Histoire de France des régions: la périphérie française des origines à nos jours, Paris 2001.
Mayer, Theodor (Hg.): Die Alpen in der Europäischen Geschichte des Mittelalters. Reichenau-Vorträge 1961–1962, Sigmaringen 1965 (Vorträge und Forschungen/Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte 10).
Ders. (Hg.): Die Alpen als Staatsgrenze und Völkerbrücke im europäischen Mittelalter, in: Theodor Mayer (Hg.): Die Alpen in der Europäischen Geschichte des Mittelalters. Reichenau-Vorträge 1961–1962, Sigmaringen 1965 (Vorträge und Forschungen/Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte 10), S. 7–14.
Meuthen, Erich/Märtl, Claudia: Das 15. Jahrhundert, 4. überarb. Auflage, München 2006 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte 9).
Münster, Sebastian: Cosmographei oder beschreibung aller laender, herschafften, fürnemsten stetten, geschichten, gebreuche[n], hantierungen etc. […], Basel 1550 [Nachdr. Amsterdam 1968].
O.A. [Schinz, Heinrich Rudolf?]: Nizza und die Meeralpen/geschildert von einem Schweizer, Zürich 1842.
O.A.: Hernach volgend die Zehen Krayß, wie und auff welliche art die inn das gantz Reych aufgethaylt und im 1532. jar Röm. Kay. Maye. hilff wider den Türckeu zuo geschickt haben. Auch welliche Ständ in yeden Krayß gehörend nach altem herkommen, [Augsburg] 1532.
Oresko, Robert/Parrott, David: The sovereignty of Monferrato and the citadel of Casale as european problems in the early modern period, in: Daniela Ferrari (Hg.): Stefano Guazzo e Casale tra Cinque e Seicento (Atti del convegno, Casale Monferrato, 1993), Roma 1997, S. 11–86.
Ossola, Carlo u.a. (Hg.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte, Rom 1987 (Biblioteca del Cinquecento 33).
Petrarca, Francesco: Familiaria: Bücher der Vertraulichkeiten, hg. v. Berthe Widmer, Bd. 1. Berlin u.a. 2005.
Pallière, Johannès: La question des Alpes: aspects de la question des Alpes occidentales jusqu’à 1760, Montmélian 2006 (De la Savoie au Comté de Nice en 1760, Bd. 2).
Pastore, Alessandro (Hg.): Confini e frontiere nell’età moderna. Un confronto fra discipline, Mailand 2007.
Peters, Martin: Friedensverträge der Vormoderne; Kapitel: Definition. in: historicum.net, http://www.historicum.net/themen/friedensvertraege-der-vormoderne/definition (Fassung vom 23.8.2006; eingesehen am 15.1.2009).
Pichard Sardet, Nathalie: Grosser Sankt Bernhard (Pass), Kap. 2: Vom Mittelalter bis heute, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Fassung vom 23.02.2009 (übersetzt aus dem Französischen, http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8852-1-2.php; eingesehen am 15.1.2009).
Pollak, Martha D.: Turin: 1564–1680: urban design, military culture, and the creation of the absolutist capital, Chicago u.a. 1991.
Raffestin, Claude: L’evoluzione del Sistema delle Frontiere del Piemonte dal VI Al XIX secolo, in: Carlo Ossola u.a. (Hg.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte, Rom 1987 (Biblioteca del Cinquecento 33).
Raviola, Blythe Alice (Hg.): Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, Mailand 2007.
Dies.: Introduzione, in: Dies. (Hg.): Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, Mailand 2007, S. 9–17.
Rhee, Sang-Myon: Sea Boundary Delimitation between States before World War II, in: The American Journal of International Law 76.3 (Jul. 1982), S. 555–588.
Ricuperati, Giuseppe: Frontiere e territorio dello stato sabaudo come archetipi di una regione europea: fra storia e storiografia, in: Blythe Alice Raviola (Hg.): Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, Mailand 2007, S. 31–55.
O.A. [Schinz, Heinrich Rudolf?]: Nizza und die Meeralpen/geschildert von einem Schweizer, Zürich 1842.
Schmale, Wolfgang/Stauber, Reinhard (Hg.): Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit, Berlin 1998 (Innovationen 2).
Schmale, Wolfgang: »Grenze« in der deutschen und französischen Frühzeit, in: Wolfgang Schmale/Reinhard Stauber (Hg.): Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit, Berlin 1998 (Innovationen 2), S. 50–75.
Schmidt-Funke, Julia: Tagungsbericht: Grenzen und Grenzüberschreitungen. Stand und Perspektiven der Frühneuzeitforschung. 8. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft »Frühe Neuzeit« im Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. 24.09.2009–26.09.2009, Aachen, in: H-Soz-u-Kult, 09.12.2009, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2899 (eingesehen am 15.1.2010).
Settia, Aldo: Giangiacomo Paleologo, in: DBI Bd. 54, Rom 2000, S. 407–410.
Tabacco, Giovanni: La formazione della potenza sabauda come dominazione alpina, in: Theodor Mayer (Hg.): Die Alpen in der Europäischen Geschichte des Mittelalters. Reichenau-Vorträge 1961–1962, Sigmaringen 1965 (Vorträge und Forschungen/Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte 10), S. 233–244.
Thevenon, Luc: Frontières du comté de Nice: »A la recherche des bornes perdues« sur l’ancienne limite des royaumes de France et de Piémont-Sardaigne, Nizza 2005.
Theatrum Europaeum; Merian, Matthaeus (Hg.)/Abelinus, Johann Philipp (Verf.): Theatrum Europaeum, oder ausführliche und warhafftige Beschreibung aller […] denckwürdiger Geschichten, so sich […] in der Welt, fürnemblich aber in Europa, und Teutschlanden […] vom Jahr […] biß auff das Jahr […] sich zugetragen haben, Bd. 8, Frankfurt/Main 1693.
Trapp, Thomas: Die französischen Enquêtes von 1387 und 1390. Ein Beitrag zur Linearität mittelalterlicher »Staatsgrenzen«, in: Wolfgang Haubrichs (Hg.), Grenzen erkennen – Begrenzungen überwinden (Festschrift für Reinhard Schneider zur Vollendung seines 65. Lebensjahrs), Sigmaringen 1999.
Tromsdorff, Johann Samuel: Accurate neue und alte Geographie von ganz Teutschland […], Frankfurt u.a. 1711.
Tuaillon, Gaston: Le frontiere linguistiche (Il caso Piemonte), in: Carlo Ossola u.a. (Hg.): La frontiera da stato a nazione. Il caso Piemonte, Rom 1987 (Biblioteca del Cinquecento 33).
Zeiller, Martin: Tractatus de X circulis Imperii Romanorum Germanici oder Von den 10 des H. Römischen Teutschen Reichs-Kraisen, Ulm 1660.
Ders.: Itinerarii Germaniae nov-antiquae compendium, das ist, Teutschlandes neuverkürtztes Räisebuch, oder, Dess in denen Jahrn 1632. und 40. in zweyen Theilen ausgegangnen Räisebuchs, Ulm 1662.
Zwierlein, Cornel: Discorso und Lex Dei: die Entstehung neuer Denkrahmen im 16. Jahrhundert und die Wahrnehmung der französischen Religionskriege in Italien und Deutschland, Göttingen 2006.
66
[*] Peter Seelmann, M.A., Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
[1] Allein in der historischen Informations- und Kommunikationsplattform H-Soz-u-Kult werden zwölf Tagungen besprochen, die 2009 stattfanden und dezidiert den Themenkomplex Raum, Grenze und »Spatial Turn« ins Zentrum ihres Interesses stellen. Bezeichnend ist auch, dass 2010 die 2. Schweizerischen Geschichtstage ebenso wie auch der 48. Deutsche Historikertag unter das Thema »Grenzen« gestellt sind.
[2] Über die Wahrnehmung und Zuordnung von Räumen sowie kognitive Landkarten bietet das im Rahmen der Zeitschrift Geschichte und Gesellschaft erschienene Heft Conrad (Hg.), Mental Maps 2002 einen guten Überblick. Besonders hervorgehoben seien in diesem Kontext der Beitrag von Hans-Dietrich Schulz (S. 343–377) und der Literaturbericht von Frithjof Benjamin Schenk (S. 493–514).
[3] Dieser Herrschaftsraum der Herzöge von Savoyen in Bezug auf das gesamte Territorium wird künftig als Savoyen-Piemont bezeichnet. Zum Problem der Benennung siehe auch Zwierlein, Discorso 2006, S. 299.
[4] In Bezugnahme auf den Sammelband Ossola u.a. (Hg.), La frontiera 1987 schreibt Raviola, Introduzione 2007, S. 9: »A lettura ultimata dei vari saggi, la sensazione è che, pur senza intenzioni programmatiche, gli autori siano lasciato alle spalle l’ancora saldo pregiudizio di un Piemonte Stato di frontiera per eccellenza e in quanto tale differente, anomalo, eccezionale.« Wenngleich Raviola diese Aussage aufgrund des Referenzwerks, in dem laut Titel lediglich der Fall Piemont untersucht wird, nur für das Piemont trifft, kann sie auf den gesamten savoyischen Herrschaftsraum bezogen werden.
[5] Dass Grenzlinien für politische Entitäten vom Menschen gemacht und nicht natürlich durch topographische oder geografische Gegebenheiten (Gebirge, Flüsse usw.), die ja selbst auch Veränderungen unterliegen, gegeben sind, gilt in der neueren Forschung als Konsens. Vgl. hierzu Heller/Niemeyer, Staatslehre 1983, S. 162–163; Raffestin, L’evoluzione 1987, S. 102 und Landwehr, Raum 2006, S. 54–55, der jedoch darauf aufmerksam macht, das diesem Konzept des Grenzenmachens das frühneuzeitliche Konzept des Grenzenfindens gegenübersteht. Schmale, Grenze 1998, S. 58–59 weist darauf hin, dass erst im späten 18. Jahrhundert »natürliche Grenzen« als gegeben und nicht verhandelbar begriffen wurden, wenngleich sie wegen ihrer visuellen Zweckmäßigkeit durchaus bereits zuvor zu finden sind, dann allerdings ausdrücklich im Rahmen einer vertraglicher Vereinbarung.
[6] Bereits 1860 polemisierte Friedrich Engels, Savoyen 1915, [2. Abhandlung], S. 3–4, 10–11 gegen die Vorstellung von natürlichen Grenzen, auf die Frankreich und Österreichs in Bezug auf die Grenzziehung zu Italien zurückgriffen. Auf S. 11 schreibt er: »Jetzt begannen die widerwärtigen Manöver bonapartischer Agenten in Savoyen und Nizza und das Geschrei der bezahlten Pariser Presse, die piemontesische Regierung unterdrücke den Volkswillen in diesen Provinzen, der laut nach Anschluss an Frankreich rufe; jetzt endlich wurde es in Paris offen ausgesprochen, die Alpen seien die natürliche Grenze Frankreichs, Frankreich habe ein Recht auf sie.« Im Folgenden führt Engels diese Behauptung ad absurdum, indem er ein weiteres Argument der Befürworter für den Anschluss an Frankreich aufgreift, nämlich die (süd)französische Sprache Savoyens: Diese, so kontert Engels, werde allerdings auch in den oberen Tälern östlich des Alpenkamms gesprochen.
[7] Den auf Bernard Bligny zurückgehenden Begriff »Seigneurie de route« zitiert Mayer, Staatsgrenze und Völkerbrücke 1965, S. 11. Die Bezeichnung Grenzsstaat findet sich bei Just, Das Haus Savoyen 1940, S. 5, 20. Ricuperati, Frontiere 2007, S. 31 spricht von einem »territorio di frontiera«, kritisch hierzu Raviola, Introduzione 2007, S. 9. Die Funktion Savoyens als Pufferstaat sehen u.a. Greyerz, Nation 1953, S. 19 und Burckhardt, Gesammelte Werke I 1971, S. 324. Vom Sattel- oder Passstaat spricht ebenfalls Just, Das Haus Savoyen 1940, S. 6–7. In Bezug auf Sattelstaat greift er offenbar auf eine Formulierung von Cesare Balbo, Delle speranze 1844, S. 67 zurück, nämlich »que’ prinicipi s’eran tenuti come a cavallo dell’Alpi.« Der von Friedrich Ratzel geprägt Begriff Passstaat findet sich zudem bei Pichard Sardet, Grosser Sankt Bernhard 2009, Kap. 2., Bätzing, Alpenlexikon 1997, S. 184–185 und Bätzing, Alpen 2003, S. 113–114, 377, FN 104, 105, dort wird er allerdings in Anführungszeichen gesetzt bzw. erläutert. Le Roy Ladurie, Histoire 2001, S. 220, 226 ist es, der die Dynastie der Savoyer »Portiers des Alpes« nennt. Allerdings macht Cerino Badone, I portinai 2004, S. 105 darauf aufmerksam, dass er bereits im Zusammenhang mit dem König von Sardinien-Piemont im 3. Band der 1823 erschienenen Memoiren Napoleons verwendet wird. Jöchner, Außenhalt 2003, S. 73 benutzt den englischen Ausdruck »gatekeeper« und setzt diesen in Gegensatz zu »Paß-Staat«, um die durch die Hauptstadtverlegung bedingte, angeblich veränderte strategische Rolle Savoyen-Piemonts zum Ausdruck zu bringen. Es gilt allerdings zu bedenken, dass zwar eine sprachliche, möglicherweise auch kulturelle Neuausrichtung unbestreitbar sind, sich aber das Herrschaftsgebiet trotz Gebietsverlusten weiterhin auf beide Seiten der Alpen erstreckte. Folglich bilden die beiden Begriffe zumindest vom 16. bis ins 18. Jahrhundert keinen Gegensatz.
[8] Vgl. Tuaillon, Frontiere linguistiche 1987, S. 222–223.
[9] Zeiller, Tractatus 1660, S. 625, 643–644, 687. Bereits in der 1532 anonym verfassten Aufstellung der Reichskreise – O.A., Hernach volgend 1532 – ist Savoyen unter der Rubrik »Reynisch Krayß« genannt, allerdings sind dort Begriffe wie Deutsch, deutsche Nation o.ä. nicht zu finden.
[10] Zeiller, Tractatus 1660, S. 687. Siehe auch ders., Itinerarii Germaniae 1662, S. 383–391, bes. S. 384–385. Hier erklärt der Autor, dass, obwohl die Herzöge in Turin residieren, Chambery die Hauptstadt Savoyens sei, weil »da die Regierung / und das Parlament / oder CammerGericht ist.« Zudem ist erwähnenswert, dass Savoyen im Itinerarii Germaniae als zu »Deutschland« zugehörig ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Die italienischen Herrschaften hingegen, die gleichfalls zum Reich aber nicht zu »Deutschland« gehören, finden bestenfalls kurze Erwähnung. So verweist Zeiller im Falle Venedig (Vgl. ebd. S. 484, 509) auf das vom gleichen Autor verfasste Itinerario Italiae. Ähnlich auch Tromsdorff, Geographie 1711, S. 232–233: »Das Herzogthum a) Savoyen/ Sabaudieae Durcatus, ist vom Kayser Sigismundo An. 1417. mit dem Herzoghums-Titul beehret worden / und gränzet […] gegen Morgen an da Walliser-Land und das Herzogthum Piedmont […]. Cambery, Chamberiacum, die Haupt-Stadt dieses Herzogthums / am Laise-Fluss / 18. M[eilen] von Leyden / 27. von Turin […] hat ein berühmt Herzogl. Schloß.«
[11] Gentile, Lo stemma 2007, s.p. [nach S. LI]. Hinweise auf die ottonische Abstammung der Savoyer siehe auch Münster, Cosmographei 1555, S. CX: »[…] Saphoy / ist also mit der zeit ire herrschafft zu einer grossen graveschaft erwachsen / weliche graven[n] sollen ir ab kom[m]en haben von keyser Otten dem anderen.«
[12] Externbrink, Le Coeur 1999, S. 190–201.
[13] Münster, Cosmographei 1555, S. CXI.
[14] Extrakt aus Giuseppe Bastiano Malatesta: Storie universali de’ tempi nostri (ASTO, matrimoni, mazzo: 20, Fasc.: 4 Carlo Eman. I.o di Savoja e l’Infanta Cattarina di Spagna). Malatestas Geschichtswerk entstand Ende des 16. Anf. des 17. Jahrhunderts und kursierte offenbar nur in Form handschriftlicher Kopien. Ein komplettes Exemplar ist nicht bekannt. Zitiert nach Zwierlein, Discorso 2006, S. 494, FN 573, der das Entstehungsjahr auf 1601 ansetzt, vgl. ebd. S. 489. Zur Hauptstadtverlegung und die damit verbundene Zuordnung Savoyens zu Italien siehe auch Balbo, Delle speranze 1844, S. 67; Jöchner, Außenhalt 2003, S. 73; Pollak, Turin 1991, S. 12–13.
[15] Dass die Territorialgeschichte Savoyen-Piemonts in der deutschen Historiographie allgemein wenig präsent ist, stellt auch Zwierlein, Discorso 2006, S. 296–297 fest.
[16] Hier vor allem die Sammelbände Pastore (Hg.), Confini 2007 und Raviola (Hg.), Lo spazio sabaudo 2007.
[17] Comoli u.a. (Hg), Le Alpi 1997.
[18] Savoyen war zwischen 1536 und 1559 nahezu vollständig besetzt (Frankreich/Eidgenossen) und praktisch nicht mehr existent. Vgl. Barberis, Quattro storie 2007, S. XXXVII sowie Dotzauer, Reichskreise 1998, S. 205. Letzterer schreibt: »Von 1536 bis 1555 war praktisch ganz Savoyen als verloren anzusehen; […].« Weshalb Dotzauer die Besetzung Savoyens nur bis 1555 ansetzt, ist nicht ersichtlich, zumal der 1555 geschlossene Waffenstillstand von Vaucelles (bei Cambrai) keine Rückgabe der savoyischen Besitzungen vorsah und deshalb vom Herzog abgelehnt wurde.
[19] Bös, Ethnizität 2007, S. 53.
[20] Gotthard, In der Ferne 2007, hat anhand von Reisebeschreibungen die Wahrnehmung von Raum und Grenzen in der Vormoderne untersucht mit dem Ergebnis (Vgl. S. 156–162), dass sich dem frühneuzeitlichen Menschen die Erde nicht mehr wie im Mittelalter als Patchwork unterschiedlicher Rauminseln präsentiere, aber auch noch nicht wie in der Moderne als euklidischer Raumcontainer. Grenzen seien von Reisenden kaum wahrgenommen worden, große Räume wie »Länder« oder »werdende Nationen« fanden in den untersuchten Quellen keine Erwähnung, kleine Räume blieben sekundär und auch die deutsche Sprach- und Reichsgrenze sei wenig präsent gewesen. Gotthards differenzierte Betrachtung, liefert zwar im Detail Diskussionsstoff, rechtfertigt jedoch nicht die verallgemeinernde und zugespitzte Behauptung, der Autor negiere im Hinblick auf die Frühe Neuzeit grundsätzlich die Erwähnung von Grenzen in Reisebeschreibungen oder zweifle an deren Dinglichkeit. So weist Gotthard auf S. 102 durchaus auf Grenznennungen in Reisebeschreibungen hin, bemerkt aber: »Doch fällt die einstellige Zahl solcher Halbsatznotierungen in dem langen Text kaum auf, nie ist so eine Grenze Einschnitt […]. Grenzlinien werden bei Wedel, anders als in vielen anderen Aufzeichnungen, zwar sporadisch erwähnt – aber unter hundert anderen Nebensächlichkeiten […].«
[21] Schmidt-Funke, Tagungsbericht 2009. Der Autorin sei hier für ihre weitergehenden Informationen und kritischen Anregungen gedankt.
[22] EA (= Amtliche Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede, hg. v. Jakob Kaiser u.a., 8 Bde., Luzern u.a. 1856–1876) und DUM (= Dumont, Jean Baron de Carelscroon: Corps universel diplomatique […], 8 Bde., 2 Suppl.-Bde., Amsterdam 1726–1739.)
[23] Grenze, Mark, Limites, Confinium, Frontiera etc. beziehungsweise Gebiet, Territorium, Spacium etc.
[24] Der Begriff Friedensvertrag wird hier in einem erweiterten Sinne gebraucht, d.h. nicht nur als Mittel zur Beendigung eines Kriegs oder Waffengangs, sondern auch als Mittel zur Konsolidierung, Ausweitung und Verlängerung des Friedens zwischen den Vertragspartnern, womit auch Bündnis-, Territorial-, Heiratsverträge u.ä. darunter fallen. Vgl. hierzu Peters, Friedensverträge – Definition 2006.
[25] Raffestin, L’evoluzione 1987, S. 101. Es sei allerdings erwähnt, dass Raffestin einen wesentlich größeren Zeitabschnitt (16.–19. Jahrhundert) in seiner Betrachtung berücksichtigte.
[26] 1477 VIII 20 Berner Erneuerung des Bündnisvertrags Bern zwischen Freiburg (Schweiz), Savoyen-Piemont, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege (eingesehen am 15.1.2010 Grafik 3, Zeile 15–16).
[27] 1509 III 19 Bündniserneuerung von Bern zwischen Bern, Freiburg (Schweiz), Savoyen-Piemont, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege (eingesehen am 15.1.2010), Grafik 2, Zeile 17.
[28] 1559 IV 3 Friedensvertrag von Cateau-Cambresis zwischen Frankreich und Spanien, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege (eingesehen am 15.1.2010). Für die franz. Fassung siehe dort unter der Rubrik »Ausfertigungen« den Link zur Base Choiseul sowie DUM V.1, S. 39.
[29] 1564 X 30 Schiedsvertrag von Lausanne, Bern, Frankreich, Savoyen-Piemont, in: EA 4.2., S. 1499.
[30] Achim Landwehr in seinem Vortrag Die Zeichen der Natur lesen. ›Natürliche‹ Autorität im habsburgisch-venezianischen Grenzgebiet, gehalten am 24. September 2009 im Rahmen der Aachener Tagung »Grenzen & Grenzüberschreitungen«. Dem Autor sei an dieser Stelle herzlich gedankt für die Zurverfügungstellung seines Skripts. Vgl. auch Raffestin, L’evoluzione 1987, S. 102.
[31] Landwehr, Zeichen 2009 zu Grenzfindung im Veneto siehe auch ausführlich die Habilitationsschrift des gleichen Autors; ders., Erschaffung Venedigs 2007.
[32] Ebd.; Jöchner, Außenhalt 2003, S. 67–68; Raffestin, L’evoluzione 1987, S. 101–103, um nur einige zu nennen.
[33] Gotthard, In der Ferne 2007, S. 157 spricht von einem möglichen longue-durée-Trend der Territorialisierung politischer Herrschaft.
[34] Meuthen/Märtl, 15. Jahrhundert 2006, S. 147; Endres, Adel 1993, S. 60.
[35] Tabacco, La formazione 1965, S. 244.
[36] Jöchner, Außenhalt 2003, S. 67.
[37] Hobe/Kimminich, Völkerrecht 2008, S. 78.
[38] Trapp, Enquêtes 1999, S. 318.
[39] Die komplexe Frage, inwieweit die Herzöge von Savoyen souverän waren oder nicht, kann hier nicht ausführlich behandelt werden, spielt aber in diesem Zusammenhang auch nur eine untergeordnete Rolle, weil ihr Herrschaftsbereich auch als Teil des Reiches genau begrenzt sein kann. Zur Frage der Souveränität Savoyens siehe Externbrink, Le Coeur 1999, S. 192, der darauf hinweist, dass die Herzöge auch von Zeitgenossen als souverän angesehen wurden, was andere, so Jean Bodin (1529/30–1596), bestritten, weil sie Vasall und Vikar des Reiches waren. Das Problem Oberhoheit und konkurrierende Lehnsordnungen wird auch von Kohler, Das Reich 1990, S. 80–81 angerissen.
[40] EA 4.2, S. 1499.
[41] 1485 IV 1 Heiratsvertrag zwischen Karl I. von Savoyen und Bianca von Montferrat zwischen Montferrat und Savoyen-Piemont, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege, Grafik 4 (eingesehen am 15.1.2010).
[42] Artikel 2 (= Grafik 4, Zeile 40–44). Leo, Italienische Staaten 1829, S. 588 behauptet, dass es bei dem Bianca versprochenen Gebiet um die rechts des Pos gelegenen Territorien gegangen sei. Begründet wird diese Aussage mit dem Hinweis, dass die Urkunde in Turin aufgesetzt und unterschrieben worden sei. Folglich wäre »ultra Padum« von der Seite Savoyens zu sehen. Zum einen ist jedoch als Ausstellungsort Casale genannt, zum anderen geht aus dem 3. Artikel klar hervor, dass Bonifazius vorbehält, über das Gebiet zwischen Po und Tanero (wie auch andere Gebiete) zu verfügen, was sinnlos wäre, wenn er es seiner Nichte versprochen hätte.
[43] In DUM III.2, S. 145 und Guichenon, Histoire Généalogique 1780, S. 434–435 ist »dicti Marchionatus« statt »dominii Marchionatus« zu lesen.
[44] Artikel 3 (= Grafik 4, Zeile 44–46).
[45] Vgl. hierzu Oresko/Parrott, The sovereignty 1997, S. 20; Goria, Bonifacio III. 1970, S. 128–131 und Settia, Giangiacomo Paleologo 2000, S. 407–410.
[46] Vgl. oben Abschnitt 59.
[47] Pallière, La question 2006, S. 47–50; Bertrand, Art 2002, S. 10.
[48] Zitiert nach Pallière, La question 2006, S. 49.
[49] Die Bezeichnung »Comté de Nice« findet sich offenbar nicht vor dem 16. Jahrhundert, vgl. ebd.
[50] Fervel, Histoire 1862, S. 327.
[51] Schinz [?], Nizza 1842, S. 2–3 (insbesondere die Anmerkung).
[52] Beide Begriffe sind hier freilich in einem geographischen und nicht in einem politischen oder gar staatlichen Sinne gemeint.
[53] Petrarca, Familiaria I 2005, S. 92.
[54] EA 4.2, S. 1477–1498.
[55] Ebd., S. 1498–1499.
[56] Ebd., S. 1499–1506.
[57] Ebd., S. 1499.
[58] Münster, Cosmographei 1550, S. CCCCX. Vollständig heisst es: »Es ist dieser See ein Scheidmauer zwüschen den Helvetiern und Allobrogen / das seind die Saphoier.« In der weiteren Beschreibung wird auch der Konflikt zwischen den »Helvetiern« und Savoyen thematisiert.
[59] Rhee, Sea Boundary 1982, S. 555–558.
[60] EA 4.2, S. 1503–1504.
[61] Ebd., S. 1504.
[62] Es dürfte sich um den Chemin de Braille handeln.
[63] EA 4.2, S. 1505.
[64] Ebd.
[65] Biel, Beziehungen 1967, S. 52–58.
[66] 1569 III 4 Bündnisvertrag von Thonon mit Konvention über den Unterhalt von Soldaten zwischen Savoyen-Piemont, Sitten (Fürstbistum), Wallis, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege, Grafik 3, 5.–3. Zeile von unten (eingesehen am 15.1.2010).
[67] Ebd. Grafik 4, 11. Zeile von unten.
[68] Vgl. oben Abschnitt 60.
[69] 1477 VIII 20, Berner Erneuerung des Bündnisvertrags zwischen Bern und Freiburg (Schweiz) einerseits und Savoyen-Piemont anderseits, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege (eingesehen am 15.1.2010).
[70] Ebd., Grafik 3, Zeile 11–13.
[71] Ebd., Grafik 3, Zeile 15–16.
[72] Zu jener Zeit waren das die acht Orte Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus und Zug. 1481 kommen noch Solothurn und Freiburg, 1501 Basel und Schaffhausen und 1513 schließlich Appenzell hinzu.
[73] 1502 VIII 22, Bündnisvertrag von Solothurn zwischen Savoyen-Piemont und Solothurn, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege (eingesehen am 15.1.2010).
[74] Ebd., Grafik 3, Zeile 10.
[75] Ebd., Grafik 3, Zeile 7–8.
[76] Vgl. Schmidt-Funke, Tagungsbericht 2009.
Peter Seelmann, »… zu einer Bestendigen rechten und heytern March gesetzt und benambset …« – Grenzen und Räume in Savoyen-Piemont, in: Martin Peters (Hg.), Grenzen des Friedens. Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne, Mainz 2010-07-15 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 4), Abschnitt 55–66.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/04-2010.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008061836>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 56 oder 55–58.
Andrea Schmidt-Rösler *
Grenzraum und Staatlichkeit. Zur Wahrnehmung des Fürstentums Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit
Gliederung:
I. Raumund Grenze: Siebenbürgen – Transilvania. Ein Raum und seine Begrifflichkeit im Wandel
I.1 Siebenbürgen – Transilvania. Bemerkungen zur Begriffsgeschichte
I.2 Frühneuzeitliche Kartographie über und aus Siebenbürgen
I.3 Der »Raum Siebenbürgen« in den außenpolitischen Verträgen des Fürstentums
II.1 Siebenbürgen in zeitgenössischen Druckschriften
Text:
Siebenbürgen hat viele Namen: lateinisch Transylvania, rumänisch Transilvania, ungarisch Erdély, deutsch Siebenbürgen oder Transilvanien und türkisch Erdel. Im Südosten Europas gelegen war es stets Grenzraum: zwischen Orient und Okzident, Rom und Konstantinopel, Wien und Istanbul, Ungarn und Rumänien (bzw. den rumänischen Fürstentümern) und nicht zuletzt in unserer Zeit bis 2006 der Europäischen Union.
Während multiethnische, -kulturelle und -konfessionelle Aspekte dieses Grenzraums für die Frühe Neuzeit zeitgenössisch und wissenschaftlich breite Beachtung gefunden haben, steht eine Betrachtung der Staatlichkeit des Fürstentums Siebenbürgen (1526 bzw. 1541 bis 1699) unter dem Gesichtspunkt der zeitgenössischen Raumwahrnehmung aus. Anhand zeitgenössischer Druckschriften, Landkarten und Reisebeschreibungen sowie der Analyse der zahlreichen (Friedens-)Verträge unter dem Gesichtspunkt der Raumkonstruktion[1] soll die Frage nach der Grenz- und Raumwahrnehmung des Fürstentums Siebenbürgen im Geflecht der staatlichen Konstituierung und der Entwicklung des politischen Raums untersucht werden. Dabei werden folgende Bereiche dargestellt:
I. Raum und Grenze: Siebenbürgen – Transilvania. Ein Raum und seine Begrifflichkeit im Wandel.
I.1 Siebenbürgen – Transilvania. Bemerkungen zur Begriffsgeschichte.
I.2 Frühneuzeitliche Kartographie über und aus Siebenbürgen.
I.3 Der Raum »Siebenbürgen« in den außenpolitischen Verträgen des Fürstentums.
II. Das Fürstentum als Grenzraum. Seine Rezeption in deutschsprachigen Druckschriften der Frühen Neuzeit.
II.1 Siebenbürgen in zeitgenössischen Druckschriften.
II.2 Topoi eines Grenzraumes: Siebenbürgen als »Antemurale Christianitatis« und als »Anti-Propugnaculum«
67
I. Raumund Grenze: Siebenbürgen – Transilvania. Ein Raum und seine Begrifflichkeit im Wandel
I.1 Siebenbürgen – Transilvania. Bemerkungen zur Begriffsgeschichte
Geographisch betrachtet bildet Siebenbürgen eine beinahe dreieckige Hochebene im Osten des spätmittelalterlichen ungarischen Königreichsreiches. Begrenzt durch die Karpaten im Osten und Süden sowie durch Hügelketten im Norden und Westen bildet es einen relativ geschlossenen geographischen Raum.
In den zeitgenössischen lateinischen Quellen wird für diesen Raum der Begriff »Transilvania« verwendet; er bezeichnete seit dem Mittelalter die Teile Ungarns, die »jenseits des Waldes« lagen (»partes translivanicae Regni Hungariae«) und deren sieben Komitate in einer zur Stephanskrone gehörenden Verwaltungseinheit (»Woywodat«) zusammengefasst waren. Dieses »historische Siebenbürgen« war bis 1526 auf den Raum zwischen den Bergketten der Karpaten begrenzt. Für die Zeit des Fürstentums Siebenbürgen muss territorial jedoch weiter gedacht werden; im Süden erstreckte sich sein Gebiet in das spätere Banat und im Norden in das Gebiet Oberungarns, der heutigen Slowakei.
Nach der Aufteilung der Gebiete der ungarischen Krone 1541 zwischen dem Osmanischen Reich, Habsburg und Siebenbürgen erweiterte letzteres sein Territorium. Zum Fürstentum Siebenbürgen wurden nun auch die östlich der Theis gelegenen Komitate Krassó, Temes, Zaránd, Bihar, Kraszna und Szolnok sowie das nördlich gelegene Maramaros gerechnet. Diese Gebiete werden in den zeitgenössischen Quellen als »Partium«, d.h. Teile Ungarns, die zum Fürstentum Siebenbürgen gehören, bezeichnet. Desweiteren dehnte sich das Fürstentum nach Norden aus und umfasste auch die sieben Komitate Szatmár, Szabolcs, Köszég, Ugocsa, Bereg, Borsod und Zemplén, die nominell ebenfalls weiter zu Ungarn, realiter aber zum Fürstentums Siebenbürgen gehörten.
Ein lineares Grenzverständnis ist für diese Gebiete nicht vorauszusetzen. Da das jünge Fürstentum in permanenter politischer und militärischer Konfrontation mit dem Osmanischen Reich und Habsburg stand und zudem wie ein Puffer zwischen den Konkurrenten Wien und Istanbul lag, änderten sich Grenzen und Grenzverläufe – je nach militärischer und politischer Lage – ständig[2].
Das Begriffspaar Siebenbürgen – Transilvanien wird heute oft parallel gebraucht[3]. Dies war jedoch eine Entwicklung, die erst zu Beginn der Frühen Neuzeit ihren Abschluss fand, zeigen doch zeitgenössische Landkarten ein vielschichtiges Namensbild. Nicolaus Cusanus verzeichnet 1439 ein »Regnum Dominorum Septem Castrum« in der Donauebene. Martin Waldseemüller verortet 1507 »Septemcastra« zwischen den Karpaten und der Donau. Auch die Schedelsche Weltchronik 1493 zeigt »Transilvania« und Siebenbürgen als zwei getrennte Gebiete. »Transilvania« findet sich auch hier im innerkarpatischen Raum, »Septemcastra« südlich der Karpaten[4]. Darüberhinaus gibt es auch Kartenbeispiele, die beide Begriffe für dasselbe Gebiet gebrauchen und es südlich der Karpaten lokalisieren, so etwa Ortelius oder Enea Silvio Piccolomi (Cosmographia).
Festzuhalten ist, dass sich »Transilvania – Siebenbürgen« bis zum Beginn der Frühen Neuzeit nicht unbedingt deckten. Nachgewiesen ist bereits, dass auch in schriftlichen Quellen beide Bezeichnungen nebeneinander und für verschiedene Räume benutzt wurden[5].
Erst im 16. Jahrhundert ist von einer parallelen und gleichbedeutenden Verwendung auszugehen, über die ein allgemeiner Konsens bestand. So trägt eine Karte Sebastian Münsters ausdrücklich den Titel: Die Siebenbürg, so man sunst auch Transsyluaniam nennt (1542).
68
I.2 Frühneuzeitliche Kartographie über und aus Siebenbürgen
Einleitend ist zu fragen, ob und inwieweit sich Veränderungen in der Vorstellung von Raum auf Landkarten manifestierten. Als Leitthese mag hier – die nicht nur geographisch gedachte – Frage dienen (analog dazu, wie Márta Fata es für Ungarn getan hat ): Siebenbürgen? Aber wo liegt es[6]? Welche Wahrnehmung des geohistorischen Raums prägte das Bild von Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit?
Ein Blick auf zeitgenössische Landkarten ergibt Aspekte, die zum Verständnis des Raumes beitragen. Es kann hierbei nicht um die mathematische Genauigkeit einer Karte, sondern um ihre auf die Konstruktion des Raumes bezogene Aussage gehen. Analysiert werden hier Karten aus dem 16. und 17. Jahrhundert; dabei liegt das Hauptaugenmerk vor allem auf der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, auf der Zeitspanne also, in der sich die Konstituierung des Fürstentums vollzog[7]. Dies ist zum einen wegen der Umsetzung geographischer Räume in anschauliche Bilder von Interesse. Zum anderen prägten diese Karten das kartographische Bild Siebenbürgens bis ins 18. Jahrhundert, das heißt so lange, bis Habsburg nach dem Frieden von Karlowitz 1699 eine Landesaufnahme durchführte[8].
Als sich im 16. Jahrhundert die geopolitische Lage in Südosteuropa änderte, hatte dies Bedeutung für ganz Europa. Dementsprechend bestand allgemeines Interesse an der Darstellung dieses Raumes[9]. In diesem Zusammenhang wurde Siebenbürgen seit dem 16. Jahrhundert von der zeitgenössischen Kartographie rezipiert. Seine Position als ein »Bollwerk« gegen das Osmanische Reich steigerte offenbar seine Wichtigkeit und sein Ansehen in Europa[10]. Auch in den im 16. Jahrhundert erscheinenden Atlanten ist Siebenbürgen vertreten. So findet es sich bei Sebastian Münster und Heinrich Petri als eigene Karte in den Tabulae modernae (1540). Eine weitere Karte Münsters trägt den Titel Die Siebenbürg, so man sunst auch Transsyluaniam nennt (1542). In seiner Cosmographia universalis (1541) zählt er in einer Beschreibung vom »Regiment und Wesen des Türckischen Reiches« alle »Königreiche so vnder demm Türcken ligen« auf; in seiner Auflistung von Daciam, Serviam und Thraciam (usw.) fehlt Siebenbürgen. Dies zeigt, dass sich Münster und seine Kartographen der Abstufung der Vasallität in Südosteuropa bewusst waren und Siebenbürgen nicht eindeutig der osmanischen Machtsphäre unterordnete.
69
1528 gaben die Wiener Kartographen Lazarus[11] und Tanstetter[12] bei Peter Apian (Ingolstadt) eine Karte heraus Chorographia Hungariae. Eine kurtze und wahrhafftige Beschreibung des Ungarlands (Tabula Hungariae), auf der Siebenbürgen noch selbstverständlich als Teil Ungarns erscheint. Abgebildet ist das gesamte Regnum Tripartitum, d.h. das Gebiet der Krone Ungarns mit den Nebenländern Kroatien, Slawonien und Dalmatien. Dass diese Karte politisch motiviert war, zeigt ihr Untertitel: Cum Caesareis Maiestatis gratia… und ihre Veröffentlichungsabsicht »ob reipublice Chriatianae usum«. Damit wird der Zusammenhang und die Stellung der Kartographen deutlich: Nach der Doppelwahl 1526/27 in Siebenbürgen hatte Ferdinand 1527 den siebenbürgischen Prätendenten Johann (János) Szapolyai aus Ungarn vertrieben. Die beiden dem kaiserlichen Hof nahestehenden Herausgeber verbildlichten den Habsburger Anspruch auf Ungarn, Siebenbürgen inbegriffen[13]. In einen ähnlichen Zusammenhang ist Wolfgang Lazius Hungaria Descriptio[14] einzuordnen. Lazius, Hofrat am Hofe des Kaisers, sieht Siebenbürgen ebenfalls als Teil Ungarns und verleiht damit dem Anspruch seines Hofes Legitimität.
Die Basis für die meisten Atlanten, vor allem für Münsters meinungsbildende Karten, war die Landkarte des aus Siebenbürgen stammenden Reformators Johannes Honterus[15], die 1532 in Basel gedruckt wurde und als erste Detailkarte Siebenbürgens gilt[16]. Sie trug den Titel Chorographia Transilvaniae, Sybembürgen und ist ein weiteres Beispiel für die synonyme Verwendung beider Namen. Zehn Jahre später erschien Honterus Dacia-Karte (1542), auf der nicht nur Siebenbürgen, sondern der gesamte Donauraum zu sehen ist. In gleich großen Lettern sind hier die Bezeichnungen »Ungaria«, »Dacia«, »Thracia«, »Macedonia«, in kleineren Typen »Transsylvania«, »Valachia«, »Moldovia«, »Seruia« und »Podolia« eingetragen. »Transylvania« ist – ohne weitere Namenszugabe – im Karpatenbecken lokalisiert.
Interessant ist die Karte von Matthias Zündt[17], die 1567 in Nürnberg mit dem Nova Totius Ungariae Descriptio erschien. Siebenbürgen ist hier farblich deutlich von der »osmanischen« Tiefebene und vom »Habsburger« West- und Oberungarn abgegrenzt. Der Autor betrachtete es offenbar als eigenen Staat und bildet damit die politische Entwicklung seit der Dreiteilung Ungarns 1541 ab. Zündt benennt das Karpatenbecken mit dem Namen »Transylvania Sybenburgen«. »Ungaria« hingegen erscheint als Länderbezeichnung nicht mehr. Diese Karte verbreitete sich über Europa, da sie in den Atlas Speculum Orbis Terrarum, der von Gerard de Jode in Antwerpen herausgegeben wurde, Aufnahme fand.
Ähnlich stellt Johannes Sambucus[18] Siebenbürgen dar. In gleich großen Lettern mit »Poldoliae, Bulgariae« etc. ist es im Karpatenbogen positioniert. Auch Sambucus verwendet den Begriff Ungarn nicht; in der Tiefebene finden sich lediglich geographische Bezeichnungen, während der westliche Teil des Stephansreichs Habsburg zugeordnet ist.
70
Spätere Karten bilden die Verselbständigung des Fürstentums ab. So reicht die Hungaria-Karte des Geographen Gerhard Mercator (1512–1595) in seinem Atlas aus dem Jahr 1585 nur bis an die Karpaten und trägt am Rand die Bemerkung »Transylvania pars«. Dies verdeutlicht, dass Siebenbürgen nicht mehr selbstverständlich als Teil der ungarischen Krone gesehen wurde. Einen ähnlichen Befund finden wir in der Karte Map of Hungary (1626) von John Speed (1552–1629), der den Beginn des Karpatenbogens mit »Part of Transilvani« beschreibt. Auch der niederländische Kartograph Johannes Blaeu lässt seine Hungaria Regnum-Karte (1647) am östlichen Rand mit dem Vermerk »Transilvaniae pars« enden.
Der Kupferstecher Jacob van Sandrat (1630–1708) verwendet in seiner Karte Neueste Tafel von Hungarn und dessen incorporierten Königreichen und Provinzien« (1664) die in gleich großen Lettern gesetzten Bezeichnungen »Hungarn«, »Siebeburgen«, »Walachia«. Den Rand der Karte zieren zahlreiche Details aus den Türkenkriegen. Auch findet sich dort eine Liste ungarischer Könige, die – mit Ausnahme »Johannes Zepul 1553« nach 1526 alle dem Haus Habsburg angehören. Auch die Namen der türkischen Sultane sind aufgeführt; Süleiman ist mit dem Zusatz versehen »Den Gott bekehr oder zerstör!«. Seine Karte hat eine didaktische Funktion, die sich in einem gerahmten Textfeld am rechten unteren Rand findet:
»Ungarn, willst du Türkisch werden: / Ungern! doch ich muß ans Joch / Christus wird die Christen retten. / Wann sie würden einig noch. / Ich muß dieses Joch zerbrechen. / Was nun drücket, droht dir / Teutschland soll nur Gott obsiegen / …«.
Die analysierten Beispiele zeigen, dass die zeitgenössischen Kartographen ihre Vorstellung vom Raum Siebenbürgen dem politischen Status anpassten und differenzierte Vorstellungen über Zugehörigkeit und Grenzlage des Fürstentums hatten.
71
I.3 Der »Raum Siebenbürgen« in den außenpolitischen Verträgen des Fürstentums
Mit der Konstituierung des Fürstentums 1541 begann eine Phase, in der Siebenbürgen eher als Subjekt denn als Objekt politischer Raumgestaltung in Erscheinung trat. Es etablierte sich schrittweise außenpolitisch und völkerrechtlich[19] und bestand bis zur Neuordnung Südosteuropas nach dem Frieden von Karlowitz 1699 als souveränes, wenn auch dem Osmanischen Reich tributpflichtiges Fürstentum.
Das seit 1541 osmanisch besetzte Mittel- und Zentralungarn mit der früheren ungarischen »Hauptstadt« Buda schob sich wie ein Keil zwischen die Gebiete West- und Oberungarns und Siebenbürgens. Dass Westungarn unter die Herrschaft der Habsburger kam, war nicht nur das Ergebnis (nur zum Teil umgesetzter) früherer Erbverträge, sondern natürlich auch Folge der geographischen Nähe. Für Siebenbürgen bedeutete der »osmanische Korridor« eine geographische Abgrenzung zum Habsburger Herrschaftsgebiet und zugleich einen gewissen Schutz vor den von der politisch-geographischen Entwicklung erschwerten Habsburger Ansprüchen.
Nachdem der kinderlose ungarischen König Ludwig (Lájos) in der Schlacht von Mohács ums Leben kam, war der ungarische Thron vakant. Die ungarischen Stände wählten den aus Siebenbürgen stammenden Magnaten Johann (János) Szapolyai auf dem Landtag von Stuhlweissenburg zum König. Kaiser Ferdinand I., der Schwager Ludwigs, hingegen berief sich auf die Erbverträge von 1491 und 1507 und ließ sich ebenfalls zum König wählen. Dieser Doppelwahl folgte ein Krieg um die Stephanskrone und um den ungarischen Königstitel, verbunden mit dem Anspruch auf die Herrschaft über Siebenbürgen. Siebenbürgen als Raumbezeichnung taucht in dieser frühen Phase in völkerrechtlichen Verträgen noch nicht auf, denn die konkurrierenden Parteien sahen es noch als integralen Bestandteil der Stephanskrone. So führen Ferdinand I. und Johann Szapolyai (beispielsweise im Waffenstillstand vom 26. März 1527) Titel, die den Anspruch auf die Herrschaft in ganz Ungarn ausdrücken und sich lediglich in ihrer Legitimationsableitung unterschieden: »[…] Ferdinandum Dei gratiae Ungariae […] regem« und »Joannem coronatum regem Hungariae«[20].
Um seine Ansprüche durchsetzen zu können, paktierte Szapolyai gerade in dieser Anfangsphase der Staatlichkeit immer wieder mit dem Osmanischen Reich und unterwarf sich 1528 der Tributpflicht[21]. Theoretisch galt dies für alle ehemals ungarischen Gebiete, ab 1541 wurde es de facto jedoch nur noch auf Siebenbürgen und die dazugehörenden ungarischen Komitate bezogen[22]. Die erste namentliche Erwähnung »Transilvaniens« in einem völkerrechtlichen Vertrag findet sich in einem Waffenstillstand des Jahres 1531, als sich der Unterhändler Szapolyais Hieronymus a Lasko als »… waywoda Transsilvanus« bezeichnete[23]. Gleichzeitig erhöhte Szapolyai in einer einseitigen Erklärung seine Legitimation, indem er den Titel »Joannis dei gratiae Hungariae […] regem« führte.
72
Bis 1538 vollzog sich ein Wandel im Verständnis Siebenbürgens. Im Friedensvertrag von Großwardein (24. Februar 1538)[24] wurde Szapolyai als souveräner Fürst anerkannt und seine Herrschaft über Siebenbürgen sowie den momentanen Besitz bestätigt (»Transylvania … sub dicione postestateque nostra permanente«). Den Königstitel »Nos Iannes dei gratia rex Hungariae« durfte Szapolyai nur auf Lebzeiten führen, und nach dem Tod des Fürsten sollte Siebenbürgen unter Habsburger Herrschaft gestellt werden. Der Vertrag enthielt Regelungen für in Oberungarn gelegene Städte sowie für das Gebiet Maramaros (Maramures), die der historisch-administrativen Entwicklung gemäß nicht als Teil Siebenbürgens verstanden wurden. Auch sie wurden Szapolyai auf Lebzeiten zugestanden, das heißt zwar als persönlicher Besitz übergeben, nicht aber dem Fürstentum (erb-)rechtlich eingegliedert.
Als Szapolyai 1540 starb, wurde entgegen der vertraglichen Abmachungen sein Sohn Johann Sigismund zum ungarischen König (»Rex electus Hungariae«) gewählt. Dies hatte die Fortsetzung des Krieges gegen die Habsburger zur Folge, der letztlich die Einmischung des Osmanischen Reichs provozierte und zur türkischen Besetzung der ungarischen Tiefebene 1541 führte. Vor diesem Hintergrund begann 1541 die Entwicklung der Eigenstaatlichkeit Siebenbürgens, die – wie auch für alle anderen frühneuzeitlichen Staaten – von ausgeprägter Bellizität begleitet wurde. 1541 wurden im Vertrag von Gyalu erstmals »Hungaria et Transsyilvania« nebeneinander gestellt und damit der politischen Entwicklung Rechnung getragen. Nicht zum »historischen Siebenbürgen« gehörende Gebiete (vor allem in Oberungarn und jenseits der Theiss) wurden als »partes […] eidem adnexarum« bezeichnet[25].
Nach weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen zeichnete sich 1565 die Klärung der Titelfrage ab. Johann II. Sigismund Szapolyai verzichtete im Vertrag von Szatmar auf den Titel des »Rex electus« und begnügte sich mit der Bezeichnung »Joannis Sigismundi, ducis Transsylvaniae«[26]. Da beide Seiten von einer Ratifikation absahen, wurde die Frage des Titels und des Territoriums endgültig erst am 26. August 1570 im Vertrag von Speyer geklärt[27]. Die gewählten Herrscher von Siebenbürgen trugen den Titel »Princeps Transylvaniae ac partium regni Hungariae« und gaben den Anspruch auf »electus Rex« auf. Siebenbürgen und die Partes wurden weiter als »membrum« der ungarischen Krone gesehen, Siebenbürgen jedoch Souveränität zugestanden. Aus dem territorialen Bestand Ungarns blieben die Komitate Bihar, Kraszna, Szolnok und Marmaros unter siebenbürgischer Herrschaft; die Partes-Komitate Bereg, Ugocsa, Szablocs und Szatmar hingegen fielen an das Habsburger-Ungarn.
1594 nutzte das Fürstentum Siebenbürgen den »langen Türkenkrieg«, um sich der Suzeränität des Osmanischen Reiches zu entziehen und stattdessen ein Bündnis mit Wien einzugehen. Im Vertrag von Prag (28. Januar 1595)[28] wurde der »Ill.mum Transylvaniae principem d.num Sigismundum Bathori« als souveräner Fürst über Siebenbürgen und die »partes adnexae« anerkannt. Er leistete einen Treueeid, der jedoch keine Vasallität begründete (Art. 3). Das Territorium Siebenbürgens und die Partes verblieben auf Lebzeiten bei Sigismund.
Dieser Anerkennung und Festschreibung der Souveränität folgten jedoch erneute Wirren[29], die am 23. Juni 1606 im Wiener Frieden beigelegt wurden[30]. 1605 hatten die ungarischen Stände Stephan (István) Bocskai zum »Fürsten« gewählt und damit den Wunsch ausgedrückt, Ungarn und Siebenbürgen unter nicht-Habsburger Herrschaft zu vereinigen[31]. Ob dies Ausdruck realistischer politischer Einschätzung war und letztlich überhaupt im Interesse Bocskais lag, ist fraglich. Das Osmanische Reich begrüßte vor dem Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit dem Kaiser die Wahl Bocskais und das Ausscheren Siebenbürgens aus dem Krieg. Bocskai verstand seine Doppelwahl zum Fürsten von Siebenbürgen und König von Ungarn wohl eher deklaratorisch, denn er machte in den Verhandlungen mit Habsburg zu keinem Zeitpunkt Ansprüche auf ganz Ungarn geltend. Sein eigentliches Ziel war eine Vergrößerung des Fürstentums Siebenbürgen. Oberungarn mit der zentral gelegenen und wirtschaftlich bedeutenden Stadt Kaschau sollte dem siebenbürgischen Machtbereich eingegliedert werden. Statt der bisher üblichen Übergabe oberungarischer Komitate und der Partes auf Lebenszeit wollte Bocskai das ungarische Königserbrecht ablösen und diese Gebiete ohne Beschränkungen dem Fürstentum zuschlagen. Der Wiener Frieden bestätigte territorial und hinsichtlich der Titelfrage jedoch lediglich den Status quo ante. Die Selbständigkeit Siebenbürgens wurde erneut anerkannt, ohne die partielle Zugehörigkeit zur ungarischen Krone aufzugeben[32].
73
Bocskais Nachfolger Gabriel (Gábor) Báthory und Gabriel (Gábor) Bethlen setzten die territorialen Arrondierungsversuche fort. Dennoch bestätigte 1613 der Friede von Preßburg den Status Siebenbürgens in der alten Form: »D.nus Gabriel Bathory maneat princeps Transylvaniae et partium regni Hungariae«[33].
Vor allem Gabriel Bethlen gelang es, seine außenpolitische Stellung auszubauen, da sowohl das Osmanischen Reich als auch Habsburg temporäre Schwächen zeigten[34]. Die Versuche, die sieben oberungarischen Komitate definitiv in das Fürstentum einzuverleiben, scheiterten jedoch wiederholt, so in den Friedensverträgen von Nikolsburg[35], Wien[36] und Pressburg[37]. In Nikolsburg musste Bethlen den Verzicht auf den Titel eines erwählten Königs erneut hinnehmen; die offizielle Bezeichnung blieb weiter »Transylvaniae princeps, partium regni Hungariae dominus«[38].
1619 und 1633 wurden Versuche unternommen, Grenzen Siebenbürgens zu definieren, in dem man die Zugehörigkeit von Grenzorten vertraglich festlegte und so erstmals Ansätze einer linearen Grenzausformung verschriftlichte[39].
Ein letzter Beleg dafür, dass im 17. Jahrhundert eine klare Vorstellung davon existierte, was zu Siebenbürgen gehörte, findet sich im Hallerschen Diplom (28. Juni 1686). Der Kaiser und der siebenbürgische Fürst Michael I. Apafi vereinbarten den gemeinsamen Kampf gegen das Osmanische Reich. Apafi wurde ausdrücklich als Fürst anerkannt und seine Rechte bekräftigt[40]. Gebiete, die im laufenden Krieg erobert wurden und die »nachweislich« zu Siebenbürgen gehörten (»ad Transylvanos spectare«; Art. 2) sollten an das Fürstentum fallen. In Artikel 5 ist ausdrücklich die Rede von »confiniis Transylvaniae«, die offensichtlich jedoch keiner weiteren Definition bedurften.
74
Territorial schien der »Raum Siebenbürgen« ab 1541 klar abgegrenzt[41]. Das ehemalige ungarische Wojwodat entwickelte sich zu einem souveränen Fürstentum. In diesem Prozess wurden die »natürlichen Grenzen« politisch definiert. Gebiete, die über diese historisch-administrativen Trennlinien hinausgingen, standen zwar zeitweise unter der Herrschaft der Fürsten von Siebenbürgen, waren jedoch stets als territoriale Besonderheit gekennzeichnet. In der Herrschaftstitulatur wurden sie eigens als »adnexae« aufgeführt. Ihre Sonderstellung wurde dadurch ausgedrückt, dass sie im Vertragstext dem Fürsten auf Lebzeiten zugesprochen wurden.
Kleinräumige offene Grenzfragen gab es in Oberungarn. Hier kollidierten (wie erwähnt) die Ansprüche der siebenbürgischen Fürsten mit den als ungarischen Königen firmierenden Habsburgern. Durch die mehrfachen Übergaben und Rücknahmen der »Partes« und oberungarischer Komitate entstand keine lineare Grenzlinie. Vielmehr deckten sich Jurisdiktionen und Herrschaftsrechte auf der obersten, aber auch auf unteren Ebenen nicht mit den vertraglich definierten Grenzen[42].
Die Lage an den Schnittstellen zum Osmanischen Reich war komplexer. Feste Grenzen gab es hier nicht zu verhandeln, da die Grenzen nach Südosten nicht linear-statisch waren, sondern stets Festung für Festung mit wechselnden Erfolgen umkämpft waren. Ganz besonders in diesem Bereich ist von einem Grenzbegriff auszugehen, der »nicht auf die Bedeutung einer militärisch-politisch gesicherten Linie konzentriert war, sondern der vielmehr auf einen Raum sowohl diesseits wie jenseits der Scheide-Linie verwies«[43].
Eine staatliche Verdichtung, wie sie seit Beginn der Frühen Neuzeit der Entstehung staatlicher Grenzen vorausging, fand hier nicht statt.
75
Einem erweiterten Raumkonzept folgend[44] soll Siebenbürgen auch als analytische Kategorie betrachtet werden; das Wissen über den Raum soll nicht auf wissenschaftliche Erkenntnisse reduziert werden. Damit rückt der Raum als Produkt der Wahrnehmung der Akteure und Rezipienten in den Vordergrund. Zu stellen ist die Frage nach dem Wissen und den Kenntnissen der Zeitgenossen über den Grenzraum Siebenbürgen und seiner Staatlichkeit und die Frage nach ihren Vorstellungen über diesen Raum an der Peripherie der »christlichen Welt«[45]. Die Analyse von Druckschriften aus dem 16 . und 17. Jahrhundert kann eine Antwort geben auf die zeitgenössische Verortung Siebenbürgens im »Geschichtsraum Europa«.
Damals wie heute stellte sich die Frage nach einer Zugehörigkeit zu Europa versus »Europäischer Türkei« nicht; stehen doch für Siebenbürgen alle Strukturelemente, die gemeinhin als Kriterium angelegt werden, zur Verfügung. Seit dem Mittelalter hatte das Königreich Ungarn an allen wesentlichen Kultur- und Kommunikationsprozessen partizipiert. Zu nennen sind Gotik, Renaissance oder Reformation, aber auch Prozesse, die schon früher eingeleitet worden waren und in der Frühen Neuzeit fortwirkten, so die abendländisch-christliche Ausrichtung, die Verwendung des Lateinischen in Recht und Verwaltung, das Stände- und Städtewesen oder die Rechtskodifikation. Dennoch war man sich sowohl in Siebenbürgen selbst als auch in Europa der Randlage und der Funktion als Grenzraum durchaus bewusst.
76
II.1 Siebenbürgen in zeitgenössischen Druckschriften
Legt man die im VD 16 und VD 17 erfassten Druckschriften zugrunde, ergibt sich schon allein numerisch ein interessanter Aspekt[46]. VD 16 listet unter dem Stichwort »Siebenbürgen« 50 Titel, VD 17 hingegen 527 auf [47]. Selbst wenn man die allgemeine Steigerung der Druckproduktion im 17. Jahrhundert in Rechnung stellt, fällt dennoch eine offenbar enorme Steigerung des Interesses an Siebenbürgen auf. Dies ist vor allem auf die politische Rolle des Fürstentums zurückzuführen, die es ab 1595 in Europa zu spielen begann. Die Flugschriften entstanden vor allem in den protestantisch geprägten süddeutschen Druckzentren, besonders in Augsburg und Nürnberg. Auch in den allgemeinen »Zeitungen« dieser Zeit, allen voran dem Theatrum Europaeum oder Relationis Historicae Semestralis Vernalis Continuatio spielt Siebenbürgen eine Rolle. Drei Gründe, die zeitlich mit einem Anstieg der Drucke über das Gebiet korrelieren, lassen sich für das gesteigerte Interesse an Siebenbürgen ausmachen. Nach dem Zerfall des ungarischen Staates geriet Siebenbürgen in das Konfliktfeld zwischen dem Osmanischen Reich und Europa. Sein Paktieren mit der einen oder anderen Seite weckte in Europa Interesse. Zudem nahm man Siebenbürgen als protestantische Macht vor allem während des Dreißigjährigen Krieges als potentiellen Bündnispartner und Gegenspieler Wiens wahr[48].
Die Drucke des frühen 16. Jahrhunderts sehen Siebenbürgen als Teil Ungarns. So zum Beispiel schildert Nikolaus Oláh in seiner 1536 erschienenen Landesbeschreibung Hungaria Siebenbürgen als administrative Untereinheit Ungarns[49].
Frühe Druckschriften (gesehen meist im Rahmen Ungarns) stellen die – auch in den Augen der Zeitgenossen einschneidende Niederlage des ungarischen Heeres bei Mohács 1526 dar. König Ludwig, der in der Schlacht umkam, erfuhr eine Stilisierung zum positiven Helden. Auch in den deutschsprachigen Druckschriften wurde der in Ungarn bis heute fortwirkende »Mythos Mohács« bereits zeitgenössisch begründet[50]. Als Beispiele sind zu nennen: »Zwey schöne newe Lieder: Von dem König Ludwig aus Hungern und der Königin / Auch wie der Türck die Stadt Wien belagert hat« oder » Zwey schöne Lieder / eyn Geystlichs und ein Weltlichs / von der Königin von Hungern / Frawen Maria und jrem Gemahel König Ludwig«[51].
Vier newe klägliche Lieder eines unbekannten Verfassers stimmen in die Klage über den Tod des ungarischen Königs ein. Alle preisen seine ritterlichen Tugenden und werben um Mitgefühl und Unterstützung für das von den türkischen Feinden bedrohte Land.
Diese Druckschriften schufen in Westeuropa den »fiktionalen Typ des ungarischen Kämpfers«[52]. Eine weitere Flugschrift, die in vielen Exemplaren weite Verbreitung fand, war Nikolaus Jurischitz, Dess Türcken erschreckliche belegerung / der Stadt und Schloß Gunß.[53], die den Kampf gegen das osmanische Heer beschreibt. Mit nur 100 Mann habe Jurischitz[54] nicht nur die Festung Güns (Köszég) verteidigt, sondern auch in Verhandlungen mit dem militärischen Vertreter Süleimans des Prächtigen (hier bezeichnet als »König von Cathey«) erreicht, dass die Festung verschont wurde und das Heer des Sultans seinen Zug gen Wien einstellte. Ein weiteres Beispiel ist die Beschreibung der Heldentaten des Miklós Zrínyi (1566), die zum »europäischen Bestseller«[55] wurde. Der kroatische Ban und kaiserliche Feldherr Miklós Zrínyi (1508–1566) hatte 1566 die ungarische Grenzburg Szigetvár gegen das übermächtige osmanische Heer verteidigt. Als er mit seinen verbliebenen Soldaten aus der zerstörten Burg ausbrach, wurde er gefangen genommen und enthauptet.
77
Die meisten Flugschriften des 16. Jahrhunderts hatten ein konkretes historisches Ereignis zum Anlass. 1541, das Jahr der Teilung des ungarischen Königreichs, markierte einen neuen Aufschwung der Druckproduktion. Ab jetzt beschäftigt man sich dezidiert mit Siebenbürgen, dem neuen Staat an der Südostgrenze des christlichen Abendlandes.
Eines der frühesten Beispiele, das Siebenbürgen getrennt von Ungarn betrachtet, ist Veit Marchthalers Ungarische Sachen (1588)[56]. Marchthaler (1565–1641), aus Ulm stammend, verwendet in seiner Darstellung der ungarischen Geschichte für das 16. Jahrhundert die Begriffe Ungarn und Siebenbürgen nebeneinander, so z.B. in der Überschrift des 1. Teils »… von der Ungarn und Sybenbirgen Sytten« (S. 1). Einen eigenen Abschnitt (S. 117–131) widmet er allein Siebenbürgen. Die Kapitelüberschriften »Vom Land Sybenbirgen« (S. 117), »Von der Hoffhaltung des Landes Sybenbirgen« (S. 126) und »Von der Sybenbirgen Confoederation mit den Tirgen unnd dero Tribut« (S. 129) zeigt, dass Siebenbürgen als Staat (wenn auch dem Osmanischen Reich unterstellt) wahrgenommen wurde.
Einen weiteren Anstoß für die Beschäftigung mit Siebenbürgen löste der »Lange Türkenkrieg« (1595–1606) aus. In diesem zähen Konflikt zwischen Habsburg und dem Osmanischen Reich spielte das Fürstentum eine nicht unwichtige Rolle. 1595 schlossen Siebenbürgen und Kaiser Rudolf II. in Prag ein Bündnis, das zum gemeinsamen Kampf gegen die Türken verpflichtete und durch das sich der Fürst mit seinem Gebiet der Habsburger Hoheit unterstellte.
Samuel Dilbaum lobte bereits 1596 in einer Flugschrift[57] den politischen Wandel in Siebenbürgen. Das Fürstentum sieht der schwäbische Publizist als politisches Gebilde und druckt folgerichtig das seit 1593 gültige Wappen des »Princeps Transilvaniae« ab. Er bezieht sich auf eine
»Mappam darinnen […] den Situm und gelegenheit / nnit allein deß Hungerlands / sondern auch deß Sibenbürgischen Fürstenthums / der Moldaw und Walachey […] länder ordentlich beschrieben«.
In seiner Darstellung geht Dilbaum davon aus, dass Siebenbürgen als Staat verfasst ist, der »etliche Jar hero / dem Türckischen Kayser Tributar gewesen«, sich nun aber »dem Feind den Paß durch sein Land [Herv.d.Verf.] / abgeschlagen […] und sich mit aller Macht dem Türcken widersetzen wölle.«
Die Verhandlungen mit dem Kaiser über ein Bündnis 1595 schildert Dilbaum detailiert. Er erwähnt, der Kaiser und der siebenbürgische Gesandte István Bocskai hätte Gastgeschenke getauscht und suggeriert damit eine staatliche Gleichrangigkeit. Siebenbürgen übergab dem Kaiser »etliche schöne Pferd«, worauf der Kaiser »silbern und verguldten Trinck und anderen Geschirren in 6000 Thaler werth« übergeben habe[58]. In Dilbaums Wiedergabe der Verhandlungen finden sich Begriffe wie »Landschafft Siebenbürgen«, Fürstentum, Principatus oder Reich. Dilbaum notiert das siebenbürgische Drängen auf einen Titel positiv und betont besonders, dass Siebenbürgen in der christlichen Koalition bleibe, auch wenn der Sultan angeboten habe, »dass er ihne zu Hungarischem Könige machen wölle«.
78
Eine Weiterentwicklung der Raumverortung Siebenbürgens läßt sich in Johann Adam Lonicerus, Historia chronologica Pannoniae, nachvollziehen[59]. Seine Darstellung wurde 1596 in Frankfurt aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt; das Motiv dafür passt in den Zusammenhang der in Westeuropa gesehenen »Türkengefahr«: Der Herausgeber erwähnt die Notwendigkeit einer Übersetzung, damit
»dem Teutschen Mann durch den Druck mitgetheilt würde / auff daß diese wunderbarlichen sachen unnd Geschichten / auch die erschröckliche Urtheil Gottes uber die Ubertretter seiner Gebotter / menniglich bekandt wurden / und jedermann an statt eines Spiegels wären / sich vor solche Stück zu hüte«.
Abgesehen von diesem Vorwort zur deutschen Ausgabe handelt es sich um eine wohlinformierte, fundierte Informationsquelle zu politischen und militärischen Detailfragen. Politische Tendenzen pro-Habsburg oder gegen das Osmanische Reich sind kaum zu erkennen. In Lonicerius Beschreibung Ungarns firmiert Siebenbürgen bis ins 14. Jahrhundert als Komitat, danach steht an seiner Spitze der »Waywoda«: »[…] die Landschafft hat vorhin keine Könige gehabt / bis dann nach Johans König Ludwigs von Hungern todt«. Auch nach 1526 vermeidet Lonicerius die Verwendung des Begriffs »Fürstentum«; erst ab 1595 mit der Koalition mit den christlichen Mächten gibt Lonicerius den Herrschern von Siebenbürgen den Titel »Fürstliche Durchlaucht«.
Den Wandel in der Raumwahrnehmung bringt am deutlichsten Martin Fumée (geb. 1540) auf den Punkt[60]:
»Transilvania oder Siebenbürgen ist eine Landtschafft des Königreichs Hungarn gewesen / und ein theil desselbigen / allenthalben mit grossen Bergen umgeben / also dass es scheinet ein Statt zu sein. […] stösset gegen Mitternacht an Polen […] Gegen Nidergang hat sie Ungarn / endet gegen die Walachen.«
In einer erstaunlich dichten chronologischen Darstellung schildert Fumée die Entwicklung in Ungarn und Siebenbürgen 1596. Noch deutlicher wird Georg von Reichersdorff in seiner Beschreibung[61]. Er spricht wiederholt vom »Königreich Siebenbürgen«, als dessen Hauptstadt er »Cibinum« (Hermannstadt) benennt[62].
79
Eine eher negative Einschätzung erfährt Siebenbürgen nach dem Frieden von Zsitva-Torok 1606. Die Politik der Fürsten Bocskai und Bethlen sowie die Aufstände unter Rákoczi und Thököly zeigen in den Augen der aus dem deutschen Reich stammenden Beobachter und Publizisten Tendenzen einer Ausgrenzung des Fürstentums aus der »westlichen Welt«[63].
Einen erneuten Anreiz für die Siebenbürgen-Publizistik bot vor allem die große Auseinandersetzung des Kaisers mit dem Osmanischen Reich (1683–1699), die 1699 mit dem Frieden von Karlowitz endete. Dies wurde allgemein als Befreiung Siebenbürgens[64] und als »Wiedervereinigung« mit der Krone Ungarns unter Habsburger Herrschaft[65] gesehen.
80
Siebenbürgen als »Antemurale Christianitatis«
In Europa, besonders auf dem Boden des Deutschen Reich hatte seit dem Mittelalter ein negatives Bild von Ungarn vorgeherrscht. Dies fußte vor allem auf der Stilisierung der Schlacht auf dem Lechfeld, insbesondere deren Schilderung durch Regino von Prüm.
Ein Paradigmenwechsel vollzog sich erst mit der aufkommenden »Türkengefahr«. Die vorher berüchtigte Kriegstüchtigkeit wurde nun zur Tugend umgewertet. Der Topos der »Antemurale Christianitatis« wurde nicht nur im Eigenbewusstsein ein wichtiges Attribut, das das Fürstentum Siebenbürgen aus zeitgenössischer Sicht kennzeichnete[66]. Als eindrucksvolles Beispiel sei abermals zitiert aus Samuel Dilbaums Bericht und kurtze Erzehlung des Heroischen Gemüts, auch herrlicher Thaten, welche H. Sigismund Bator, Fürst in Siebenbürgen […] wider den Türken mannlich bewiesen (Augsburg 1596). Dilbaum beschreibt den Kampf gegen den Erzfeind, preist die »siebenbürgische Dapfferkeit« und endet mit Erwähnung einer päpstlichen Belobigung: »Was der Fürst in Sibenbürgen für ein dapfferer Held, ab dem sich nit allein die Christen, sondern auch die Feind verwundern.« Eine Mission zum Papst wird gelobt, der den siebenbürgischen Gesandten mit dem Ritterschlag ehrte und zur Hochzeit der österreichischen Erzherzogin Maria Christina mit dem siebenbürgischen Fürsten 1595 einen päpstlichen Nuntius schickte. Belege für diese Sicht Siebenbürgens finden sich in zahlreichen Flugblättern und -schriften. Oft stehen einzelne Ereignisse des »langen Türkenkrieges« im Mittelpunkt[67].
Die »Erlösung« sehen die Druckschriften im Jahr 1699 mit dem Frieden von Karlowitz, wie exemplarisch ein Titel mit Bezug zu Siebenbürgen ausdrückt: Fried – bestrahltes Ungarn und Freud-jauchtzendes Fürstentum Siebenbürgen / Welches / Bey Glücklich – erfolgtem Christlich – und Türckischen Friedens-Schluß / Anno 1699. Aus dem Joch Barbarischer Dienstbarkeit erlediget / und als ein von dem Königreich Ungarn abgerissenes Kleinod / Durch beygefügte Friedens-Puncta / Wieder dem Kaiserlichen Diadem einverleibet worden, das 1699 in Halle gedruckt wurde.
81
Siebenbürgen als »Anti-Propugnaculum«
Andererseits stabilisierte sich kein durchgehend positives Bild von Siebenbürgen. Der Grund war vor allem die Frontstellung gegen Habsburg, also gegen den Kaiser. Diese äußerte sich in Rivalitäten um die ungarische Krone und die Herrschaft in Siebenbürgen, militärischen Auseinandersetzungen und Aufständen und prägte von 1526 bis 1699 das Verhältnis.
So zeichnet der bereits oben zitierte Johann Adam Lonicerius in der zu Frankfurt 1596 erschienenen Historia chronologica Pannoniae ein negatives Bild der siebenbürgischen Sonderentwicklung. Er kritisiert die Hinwendung Johann Szpolyais zum Osmanischen Reich 1526 und gibt diesem sogar die Schuld an der Teilung Ungarns:
»Anno 1529 ist der Türckische Keyser Soyman durch heimliche hülff und anregen deß Wawodae in Ungarn gefallen, hat die Stadt Ofen erobert […] Der Jannes Wawod in Sibenbürg so die Türcken Erdelban nennen zog mit grossen Geschenken dem Solyman entgegen küsset ihm die Hönd unnd ward von ihm zum König in Ungarn bestettiget.«
Dem Johann Szapolyai verweigert er den Fürstentitel und nennt ihn überwiegend »Wajwod«: »[…] hat der Johan Sigismund Waywoda in Sibenbürgen ein unglückhaffter Underthan und Lehenmann Soylmanis«.
Gerade für Siebenbürgen ist nicht von einer absoluten Frontstellung gegen »den Türken« auszugehen. Notwendigerweise kam es zu Formen des kulturellen und wirtschaftlichen Transfers. Hier finden sich zeitgenössische Belege für das Spannungsfeld zwischen »Türkenfurcht« und praktischen Arrangements im gesellschaftlichen und politischen Bereich. Sie stammen vor allem aus der Adelsschicht und vom siebenbürgischen Fürstenhofe, wo man türkische Sitten adaptierte. Dazu gehörten der äußere Habitus und die Gestaltung des Umfeldes, zum Beispiel mit türkischen Teppichen. Auch für wirtschaftliche Verflechtungen lassen sich zeitgenössische Belege finden. So berichtet beispielsweise der Reisende Conrad Jacobs Hiltebrandts (1656–1658), dass es in Siebenbürgen »vile Türckisch Wahren zu kauffen« gibt. Bei ihm finden sich auch Beschreibungen weiterer osmanischer Einflüsse, so von Elementen der Tracht ungarischer Magnaten, die »Schuhe nach Türkenart« und einen »Mentke« (Überwurf) übernommen hatten. Sogar im Verhalten will Hildebrandts Adaptionen feststellen, in dem er beschreibt, dass man in Siebenbürgen mit den Fronbauern »grausam und auf türckisch« umgehe. Auch Georg von Reichersdorff weist auf den Handel mit »türckischen Waaren«[68] hin.
In den Augen der Zeitgenossen lag Siebenbürgen an der Grenze der vertrauten Welt. Je nach Grundeinstellung des Autors wurde es als bekannt mit vertrauten Merkmalen dargestellt, und trug dann meist positive Züge. Mitunter wurde es als fremd gesehen und negativ geschildert. Seine Stellung als dem Osmanischen Reich tributpflichtiges Fürstentum spiegelte sich in zeitgenössischen Dokumenten wieder und findet auch in den meisten Reiseberichten Erwähnung[69]. Ein »mentales Abdriften«, wie es Parvev für Teile des Balkans gesehen hat[70], diagnostizierte der zeitgenössische Betrachter ebenso wenig wie eine dezidierte Vorstellung kultureller Fremdheit.
82
Flugschriften und -blätter wurden an dieser Stelle nicht verzeichnet. Sie finden sich mit vollen bibliographischen Angaben in den Anmerkungen.
Bálogh, András: Literarische Querverbindungen zwischen Deutschland und Ungarn in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Wilhelm Kühlmann/Anton Schindling (Hg.): Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Stuttgart 2004 (Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62), S. 117–134.
Barta, János/Jatzlauk, Manfred/Papp, Klára (Hg.): »Einigkeit und Friedens sollen auf Seiten jeder Partei sein«. Die Friedensschlüsse von Wien und Zsitvatorok, Debrecen 2007.
Benkoe, Joseph: Beschreibung von Siebenbürgen (1778), in: Joachim Heinrich Jäck: Taschenbibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Bessarabien, Bulgarien, Servien und Bosnien, Nürnberg 1828, Bd. I, Teil 1–3, S. 251–272.
Berindei, Mihnea: Le problème transylvain dans la politique hungroise de Süleymân 1.er, in: Gilles Veinstein (Hg.): Soliman le Magnifique et son temps actes du colloque de Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 7 –10 mars 1990, Paris 1992, S. 505–511.
Capesius, Bernhard (Hg.): Sie förderten den Lauf der Dinge. Deutsche Humanisten auf dem Boden Siebenbürgens, Bukarest 1967.
Căzan, Ileana: Habsburgi şi otomani la linia dunării. Tratate şi negocieri de pace 1526–1576, Bucureşti 2000.
Cenner-Wilhelmb, Gisela: Feind oder zukünftiger Verbündeter? Zur Beurteilung der politischen Rolle des Emerikus Thököly in den grafischen Blättern seiner Zeit, in: Gernot Heiss/Grete Klingenstein (Hg.): Das Osmanische Reich und Europa 1683 bis 1789. Konflikt, Entspannung, Austausch, München 1983, S. 54–63.
Dávid, Géza/Fodor, Pál (Hg.): Ottomans, Hungarians and Habsburgs in central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest, Leiden u.a. 2000.
Depner, Maja: Das Fürstentum Siebenbürgen im Kampf gegen Habsburg Untersuchungen über die Politik Siebenbürgens während des Dreißigjährigen Krieges, Stuttgart 1938.
Dörner, Anton E.: Transilvania între stabilitate şi criză, in: Ioan-Aurel Pop (Hg.): Istoria Transilvaniei, Cluj-Napoca 2003, Bd. I, S. 283–330.
Engelmann, Gerhard: Johannes Honter als Geograph, Köln 1982 (Studia Transylvanica 7).
Etényi, Nóra: Der Friede von Zsitvatorok in der zeitgenössischen Propaganda, in: János Barta/Manfred Jatzlauk/Klára Papp (Hg.): »Einigkeit und Friedens sollen auf Seiten jeder Partei sein.« Die Friedensschlüsse von Wien und Zsitvatorok, Debrecen 2007, S. 267–280.
Faber, Richard/Naumann, Barbara (Hg.): Literatur der Grenzen – Theorie der Grenze, Würzburg 1995.
Fata, Márta: Ungarn in der deutschen Historiographie, in: Márta Fata (Hg.): Das Ungarnbild der deutschen Historiographie, Stuttgart 2004 (Schriftenreihe des Instituts für Donauschwäbische Landeskunde 13), S. 11–22.
Geier, Wolfgang: Südosteuropa-Wahrnehmungen: Reiseberichte, Studien und biographische Skizzen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Wiesbaden 2006 (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universität Dortmund 39).
Gooss, Roderich: Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526–1690), Wien 1911.
Gotthard, Axel: In der Ferne. Die Wahrnehmung des Raums in der Vormoderne, Frankfurt am Main 2007.
Ders.: Raum und Identität in der frühen Neuzeit – eine Problemskizze, in: Sefik Alp Bahadir (Hg.): Kultur und Region im Zeichen der Globalisierung, Neustadt 2000, S. 335–369.
Gündisch, Gustav: Der Name »Siebenbürgen«, in: Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 10 (1941), S. 271–273.
Haberland, Detlev/Katona, Tünde (Hg.): Buch- und Wissenstransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der frühen Neuzeit. Beiträge der Tagung an der Universität Szeged vom 25.–28. April 2006, Oldenburg 2007.
Hadrovics, László: Die »Hungaria« von Nikolaus von Oláh (1536) und die Landesbeschreibungen über Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert, in: Hans-Bernd Harder (Hg.): Landesbeschreibungen Mitteleuropas von 15.–17. Jahrhundert, Köln u.a. 1983, S. 165–181.
Höfert, Almut: Den Feind beschreiben. »Türkengefahr« und europäisches Wissen über das Osmanische Reich 1450–1600, Frankfurt 2003.
Holban, Maria (Hg.): Călători străini despre Ţările Române, Bd. I–III, Bucureşti 1969–1971.
Huber, Alfons: Die Verhandlungen Ferdinand I. mit Isabella von Siebenbürgen, in: Archiv für österreichische Geschichte 78 (1892), S. 1–39.
Kammel, Frank: Gefährliche Heiden und gezähmte Exoten: Bemerkungen zum europäischen Türkenbild im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in: Ronald Asch u.a. (Hg.): Frieden und Krieg in der Frühen Neuzeit. Die europäische Staatenordnung und die außereuropäische Welt, München 2001, S. 503–525.
Kinzl, Hans: Das kartographische und historische Werk des Wolfgang Lazius über die österreichischen Lande des 16. Jhdt., in: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft zu Wien 116 (1974), S. 94–201.
Kisbán, Eszter: »Europa und Hungaria« in Reiseberichten der frühen Neuzeit, in: Antoni Mączak/Hans Jürgen Teuteberg (Hg.): Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung, Wolfenbüttel 1982 (Wolfenbütteler Forschungen 21), S. 193–199.
Kleinlogel, Cornelia: Exotik – Erotik. Zur Geschichte des Türkenbildes in der deutschen Literatur der Frühen Neuzeit, Frankfurt 1989.
Köstlbauer, Josef: Europa und die Osmanen. Der identitätsstiftende »Andere«, in: Wolfgang Schmale u.a. (Hg.): Studien zu europäischen Identität im 17. Jahrhundert, Bochum 2004 (Herausforderungen. Historisch-politische Analysen 15), S. 45–73.
Kühlmann, Wilhelm/Schindling, Anton (Hg.): Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Stuttgart 2004 (Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62).
Marschal, Guy P. (Hg.): Grenzen und Raumvorstellungen (11.–20. Jh.) – Frontières et Conceptions de l´espace (11e–20e siècles), Luzern 1996 (Clio Lucernensis 3).
Medick, Hans: Grenzziehungen und Machbarkeit des Raums (1500–1900), in: Bericht über die 39. Versammlung deutscher Historiker in Hannover 23.–26.9.1992, Stuttgart 1994.
Ders.: Grenzziehungen und die Herstellung des politisch-sozialen Raums. Zur Begriffsgeschichte und politischen Sozialgeschichte der Grenzen in der Frühen Neuzeit, in: Richard Faber/Barbara Naumann (Hg.): Literatur der Grenzen – Theorie der Grenze, Würzburg 1995.
Meschendörfer, Hans (Hg.): Siebenbürgen im historischen Kartenbild, Gundelsheim 1986.
Ders./Mittelstrass, Otto (Hg.): Siebenbürgen auf alten Karten, Heidelberg 1996 (Historisch-Landeskundlicher Atlas von Siebenbürgen, Beiheft).
Mihály, Imre: Der ungarische Türkenkrieg als rhetorisches Thema in der Frühen Neuzeit, in: Wilhelm Kühlmann/Anton Schindling (Hg.): Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Stuttgart 2004 (Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62), S. 93–107.
Molnár, Andrea: Fürst Stefan Bocskay als Staatsmann und Persönlichkeit im Spiegel seiner Briefe, München 1982.
Müller, Georg: Die Türkenherrschaft in Siebenbürgen. Verfassungsrechtliches Verhältnis Siebenbürgens zur Pforte 1541–1688, Hermannstadt 1923.
Nägler, Thomas: Der Name Siebenbürgen, in: Forschungen zur Volks- und Landeskunde 12 (1969), S. 63–69.
Nemes, Klára (Hg.): Carthographia Hungarica, Bd. I, Budapest 1972.
Németh, Katalin: Eine wiederentdeckte Reisebeschreibung. Veit Marchthaler, Ungarische Sachen 1588, in: Wilhelm Kühlmann/Anton Schindling (Hg.), Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Stuttgart 2004 (Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62), S. 207–218.
Nordenskiöld, Adolf Erik (Hg.): Facsimile-Atlas of the Early History of Cartography with reproductions of the most important maps printed in the XV and XVI centuries, Reprint New York 1973.
Nouzille, Jean: Transylvania an area of contacts and conflicts, Bucharest 1996.
Oberhummer, Eugen: Wolfgang Lazius Karten der österreichischen Lande und des Königreichs Ungarn aus den Jahren 1545–1563, Innsbruck 1906.
Osterhammel, Jürgen: Kulturelle Grenzen in der Expansion Europas, in: Saeculum 46 (1995), S. 101–138.
Ders.: Die Wiederkehr des Raums: Geopolitik, Geohistorie und historische Geographie, in: Politische Literatur 43 (1998), S. 374–397.
Panaite, Viorel: Pace, război şi comerţ în Islam. Ţările Române şi dreptul Otoman al popoarelor (secolele XV–XVII), Bucureşti 1998.
Parvev, Ivan: Land in Sicht. Südosteuropa in den deutschen politischen Zeitschriften des 18.Jahrhunderts, Mainz 2008 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für Universalgeschichte 220).
Pascu, Ştefan: Voievodatul Transilvaniei, Bd. I–IV, Cluj 1972–1989.
Petritsch, Ernst: Der habsburgisch-osmanischer Friedensvertrag des Jahres 1547, in: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 38 (1985), S. 49–86.
Pop, Ioan Aurel: Istoria Translvaniei, Bd. I–II, Cluj 2003–2005.
Reichersdorff, Georg von: Beschreibung von Siebenbürgen (1595), in: Joachim Heinrich Jäck: Taschenbibliothek der wichtigsten und interessantesten Reisen durch Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Bessarabien, Bulgarien, Servien und Bosnien, Nürnberg 1828, Teil I, Bd. 1–3, S. 22–37.
Schlögel, Karl: Kartenlesen. Oder: die Wiederkehr des Raumes, Zürich 2003.
Schmale, Wolfgang/Stauber, Reinhard (Hg.): Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit, Berlin 1998.
Schmidt-Rösler, Andrea: Princeps Transilvaniae – Rex Hungariae? Gabriel Bethlens Außenpolitik zwischen Krieg und Frieden, in: Heinz Duchhardt/Martin Peters (Hg.): Kalkül – Transfer – Symbol. Europäische Friedensverträge der Vormoderne, Mainz 2006-11-02 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 1), Abschnitt 80–98, URL: http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/01-2006.html (10.12.2009).
Schwerhoff, Gerd: Die große Welt im kleinen Raum. zur Ver-Ortung überlokaler Kommunikationsräume in der Frühen Neuzeit, in: Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 9 (2005), H. 3/4, S. 367–375.
Stegena, Lajos (Hg.): Lazarus Secretarius. The first Hungarian mapmaker and his work, Budapest 1982.
Sugar, Peter/Hanák, Péter/Frank, Tibor (Hg.): A History of Hungary, Bloomington 1990.
Sundhaussen, Holm: Südosteuropa und Balkan: Begriffe, Grenzen, Merkmale, in: Uwe Hinrichs (Hg.): Handbuch der Südosteuropa-Linguistik, Wiesbaden 1999, S. 27–47.
Szücs, Jenö: Die drei historischen Regionen Europas, Frankfurt 1990.
Teuteberg, Hans Jürgen (Hg.): Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte. Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung, Wolfenbüttel 1982 (Wolfenbütteler Forschungen 21), S. 193–199.
Volkmer, Gerald: Das Fürstentum Siebenbürgen 1541–1691: Außenpolitik und völkerrechtliche Stellung, Heidelberg 2002 (Studium Transylvanicum).
Weigel, Siegrid: Zum »topographical turn«. Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften, in: KulturPoetik 2 (2002), S. 151–165.
83
[*] Andrea Schmidt-Rösler, Dr., Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
[1] Dies hat Axel Gotthard, In der Ferne 2007 allgemein für die Frühe Neuzeit angeregt.
[2] Sugar, History 1990, S. 121–122; Berindei, Problème transylvain 1990, S. 505.
[3] Grundlegend zur Geschichte der Bezeichnung »Siebenbürgen«: Nägler, Der Name Siebenbürgen 1969; Gündisch, Der Name »Siebenbürgen« 1941. Nicht unerwähnt darf der Bezug zur Siedlungsgeschichte der Siebenbürger Sachsen bleiben, sowie der (wahrscheinliche) Bezug auf deren sieben Stühle.
[4] Weitere Beispiele listet Nägler, Der Name Siebenbürgen 1969, auf.
[5] Ein Erklärungsversuch leitet Septem Castra von römischen Heereslagern ab; von der Donau brachten Siedler den Namen in den innerkarpatischen Raum und übersetzten ihn ins Deutsche. Er wurde zunächst nur für die drei südlichen sächsischen Stühle um Hermannstadt gebraucht. Über seine Bezeichnung des äußersten Südens wuchs er jedoch rasch hinaus. Vgl. Nägler, Der Name Siebenbürgen 1969.
[6] Fata, Ungarn in der deutschen Historiographie 2004, S. 16.
[7] Die überwiegende Anzahl der Original-Karten bewahrt u.a. die Bayerische Staatsbibliothek München auf. Reprints der hier erwähnten Karten bei: Nemes, Cartographia 1972. Nachdrucke finden sich auch in: Nordenskiöld, Facsimile-Atlas 1973. Meschendörfer/Mittelstrass, Siebenbürgen 1996, haben für die Karten Lazarus, Honterus und Lazius eine detailreiche Studie vorgelegt.
[8] Vgl. dazu den Tagungsbericht Beschreiben und Vermessen. Raumwissen in der östlichen Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen 29.–31.10.2009, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2904&count=15&recno=13&sort=datum&order=down&geschichte=162 (eingesehen am 04.01.2010).
[9] Geier, Südosteuropa-Wahrnehmungen 2006, S. 30.
[10] Um 1500 erschienen ca. 20 Einzelkarten von Ungarn, auf denen Siebenbürgen verzeichnet war.
[11] Lazarus Secretarius stammte wohl aus Ungarn und war Schüler Tanstetters in Wien. Vgl. ausführlich: Stegena, Lazarus Secretarius 1982.
[12] Georg Tanstetter (1482–1535), Mathematiker und Astronom, Leibarzt Kaiser Maximilians.
[13] Die Tanstetter-Karte enthält weitere politische Botschaften: Es finden sich mehrere Illustrationen, die im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich stehen. So weht auf der Festung Belgrads die Fahne mit dem Halbmond (1521). Ein Schlachtenbild erinnert an Mohács 1526 und an den Tod des ungarischen Königs. Am rechten unteren Rand der Karte zieht ein Segelschiff gen Osten – ein Aufruf zum Kreuzzug gegen das Osmanische Reich.
[14] Lazius (1514–1565), lebte als Medizinprofessor in Wien. Seine Karte erschien erstmals 1556 und erneut 1570 in Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum. Vgl. Oberhummer, Wolfgang Lazius Karten 1906.
[15] Johannes Honterus (1498 in Kronstadt–1549), Humanist und Reformator der in Siebenbürgen lebenden Deutschen.
[16] Sie stellt die deutschen Siedlungen in den Vordergrund und legte damit die Grundlage für eine verzerrte Wahrnehmung des Bildes von Siebenbürgen. In der siebenbürgisch-sächsischen Historiographie trägt sie deswegen auch den Namen Sachsenlandkarte; vgl. Engelmann, Honter als Geograph 1982.
[17] Zündt (1498–1572), war Kupferstecher und Kartograph in Nürnberg. Aus seiner Werkstatt stammen v.a. kleinformatige Karten, die wie Flugblätter verbreitet wurden.
[18] Der Humanist Sambucus, ung. János Zsámboky (1531–1584), wirkte als Geschichtsschreiber am Kaiserhof in Wien.
[19] Ausführlich dazu beispielsweise: Volkmer, Fürstentum Siebenbürgen 2002. Umfangreiche Zusammenstellung aller Staatsverträge bei Gooss, Staatsverträge Siebenbürgen 1911 sowie zahlreiche Originalurkunden in der Datenbank Europäische Friedensverträge der Vormoderne – online des Instituts für Europäische Geschichte, Mainz (http://www.ieg-friedensvertraege.de).
[20] Gooss, Staatsverträge Siebenbürgen 1911, S. 2.
[21] Zu diesem Aspekt besonders die ältere Darstellung Müller, Türkenherrschaft 1923 sowie Panaite, Pace 1998.
[22] Volkmer, Fürstentum Siebenbürgen 2002, S. 43–44.
[23] Gooss, Staatsverträge Siebenbürgen 1911, S. 12, 19.
[24] Friedensvertrag von Großwardein 1538 II 24, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009).
[25] Gooss, Staatsverträge Siebenbürgen 1911, S. 97 (29.12.1541).
[26] Waffenstillstand und Präliminarfrieden von Szatmár 1565 III 13, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009) sowie Gooss, Staatsverträge Siebenbürgen 1911, S. 179.
[27] Friedensvertrag von Speyer 1570 VIII 26, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009). Genau genommen befand sich Siebenbürgen nun in einem Zustand der doppelten Suzeränität, vom Osmanischen Reich einerseits und von Habsburg andererseits.
[28] Offensiv- und Defensivbündnis von Prag 1595 I 28, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009).
[29] Zu nennen sind hier die mehrfachen Abdankungen Sigismunds, Gebiets- und Herrschaftsüberschreibungen an Habsburg, die kurzzeitige Vereinigung mit der Moldau und der Walachei unter Mihai Viteazul und die »Schreckensherrschaft« des Habsburger Generals Basta sowie die Aufstände Bocskais.
[30] Text des Präliminarfriedens 1606 II 9 und des Friedens von Wien 1606 VI 23, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009). Allgemein dazu: Barta/Jatzlauk/Papp, Einigkeit 2007.
[31] Barta/Jatzlauk/Papp, Einigkeit 2007, S. 65–67.
[32] Ebd, S. 196.
[33] Gooss, Staatsverträge Siebenbürgen 1911, S. 419.
[34] Vgl. dazu Schmidt–Rösler, Princeps Transilvaniae 2006.
[35] Friedensvertrag von Nikolsburg 1621 XII 31, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009).
[36] Zweiter Frieden von Wien 1624 V 8, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009).
[37] Friedensvertrag von Preßburg 1626 XII 20, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009).
[38] Im Friedensvertrag von Kaschau (3. April 1631) Georg I Rákóczy den Titel erweitern: »Dei gratia princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae d.nus«, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009).
[39] Übereinkommen von Nagykároly 1619 III 26, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de und Verträge von Eperjes 1633, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 20.12.2009).
[40] »Transylvaniae et partibus Hungariae Tranylvaniae annexis intra veros suoas terminos d.nus princeps et status eo […] dito« (Art.3), in: Gooss, Staatsverträge Siebenbürgen 1911, S. 873.
[41] Vgl. dazu die Diskussion über verschiedene Grenzbegriffe bei Medick, Grenzziehungen 1995, und Marschal, Grenzen 1996.
[42] Dies zu untersuchen bleibt ein Desiderat; vgl. die Studie von Peter Sahlins, The making of France and Spain in the Pyrenees, Berklely 1991.
[43] Medick, Grenzziehungen 1995, S. 216.
[44] Theoretische Unterlegung: Faber/Naumann, Literatur der Grenzen 1995; Gotthard, Raum und Identität 2000; Medick, Grenzziehungen 1995; Osterhammel, Kulturelle Grenzen 1995; Ders., Wiederkehr des Raums 1998; Parvev, Land in Sicht 2008; Schlögel, Kartenlesen 2003; Schmale/Stauber, Menschen und Grenzen 1998; Schwerhoff, Die große Welt im kleinen Raum 2005; Weigl, Topographical turn 2002.
[45] Als Quellenbasis dienen die in VD 16 und VD 17 erfassten Drucke sowie zeitgenössische Reiseberichte. Ihr Kreis bleibt hier auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Dies hat im Rahmen einer knapp angelegten Studie natürlich forschungspraktische Gründe. Es stützt sich aber auch auf die Beobachtung, dass besonders mit dem deutschsprachigen Raum enge Beziehungen bestanden. Ab dem 16. Jahrhundert kamen protestantische Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an deutsche Universitäten, v.a. Heidelberg, Halle und Wittenberg. Ein kultureller Austausch entstand. Ein weiterer Grund für das große Interesse war sicher auch die bekannte deutschsprachige Bevölkerung Siebenbürgens. Vgl. Kühlmann/Schindling, Deutschland und Ungarn 2004, bes. S. 27–53 und 115–135.
[46] Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16): http://www.vd16.de sowie Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (VD17): http://www.vd17.de.
[47] Verglichen mit der Gesamtmenge an Druckschriften bleibt Ungarn bzw. Siebenbürgen in Europa dennoch marginal; vgl. Bálogh, Querverbindungen 2004.
[48] Vgl. Schmidt–Rösler, Princeps Translyvaniae 2006.
[49] Miklós Oláh stammte aus Hermannstadt und war Erzbischof von Gran; vgl. Hadrovics, Hungaria 1983.
[50] Vgl. Kühlmann/Schindling, Deutschland und Ungarn 2004, S. 98–99.
[51] Die Ausgaben befinden sich in der Staatsbibliothek München.
[52] Bálogh, Querverbindungen 2004, S. 123. Zur Entstehung und Prägung des Bildes vom Osmanischen Reich in Europa vgl. u.a. Kammel, Gefährliche Heiden und gezähmte Exoten 2001, S. 503–525.
[53] VD 16 Nr. 4431–4459.
[54] Jurischitz, Niklas J. (Jurischitsch), Freiherr zu Güns, (ca. 1490– ?), stand militärisch und diplomatisch in Diensten Ferdinands I. von Österreich. Im August 1532 verteidigte er die Festung Güns/Köszég gegen das Osmanische Reich und konnte dadurch den Vormarsch des Heeres gegen Wien verhindern. Kaiser Karl V. ernannte ihn zum Freiherrn; vgl. AdB 14 (1881), S. 743f.
[55] Bálogh, Querverbindungen 2004, S. 123.
[56] Dazu allg. Németh, Reisebeschreibung 2004.
[57] VD 16 D 1718: Samuel Dilbaum, Bericht und kurtze Erzehlung des Heroischen Gemüts, auch herrlicher Thaten, welche H. Sigismund Bator, Fürst in Siebenbürgen […] wider den Türken mannlich bewiesen. Augsburg 1596. Samuel Dilbaum (1530–1618), war Protestant und hatte in Wittenberg studiert. Er war in Augsburg publizistisch tätig und gab – neben zahlreichen Flugblättern und -schriften – u.a. die Rohrschacher Monatsschrift heraus.
[58] Eine ähnliche Schilderung mit leicht abweichender Konnotation findet sich auch bei Iacob Frey: Continuatio: Ungerischer vnd Siebenb[ue]rgischer Kriegsh[ae]ndel Außf[ue]hrliche Beschreibung / Was sich von dem Herbst deß vergangen 96. Jahrs / biß auff den Früling dieses lauffenden 97. Jahrs / zwischen dem Erbfeindt dem T[ue]rcken / vnnd den Christen / so wol in ober als vnder Vngarn / Siebenb[ue]rgen / Wallachey / verloffen vnd begeben, auß vielen glaubw[ue]rdigen schrifften / zusamen getragen / Durch IACOBVM FREY der Historien vnd Wahrheit Liebhabern, Frankfurt a.M. 1597: »Den 17. Februarii ist der Fürst auß Sibenbürgen […] mit 40 Kutschen / darob in 140 Personen / und also viel stattlicher als vor einem Jar bey Key. May. ankommen und herrlich einbegleittet worden / derselben Tractation unnd verrichten wurde dieser zeit noch gar still und in geheim gehalten: allem gienge der gemeine Ruff / daß sie Sie ansehnliche Fürschlag und gute vetröstung grosser verrichtung theten / … Gedachter Fürst inn Sibenbürgen hat den 22. Februarii der Key. May. etliche wolgerüste Türckische und andere Pferd / sampt andern mer Türckischen unnd Tartarischen Sachen underthenigst praesentiren unnd verehren lassen.«, S. 39 und 63 (VD 16 F 2688).
[59] VD16 L 2457; Lonicerius, auch: Johann Adam Teucer, Teucriusc, Teucrides Annaeus, (*1557; † oder verschollen 1599), Humanist, Schriftsteller.
[60] VD 16 F 3373: Fumée, Historia von der Empörung, so sich im Königreich Ungarn auch in Siebenbürgen, Moldaw, in der Bergische Walachey und andern örthern zugetragen haben, Cölln 1596.
[61] Verwendet wurde die deutsche Übersetzung des lateinischen Originaltitels: Transsylvaniae, ac Moldaviae aliquarum vicinarum regionum succinta descripti Georgii a Reichersdorff, Coloniae Agrippinae 1595. Reichersdorff stand in Diensten Kaiser Ferdinand I. und war u.a. als Gesandter am Hof der Moldau (Petru Rareş) tätig. Bereits 1550 hatte er mit Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata eine historische Darstellung der antiken Landschaft verfasst.
[62] Reichersdorff, Beschreibung 1828, S. 23, 26–27.
[63] So etwa: Deß Türckischen Kaysers Hülff Dem Fürsten inn Siebenbürgen / Bethlehem Gabor / nunmehr erwöhlten König in Ungarn / und desselben Ständen / auch den Confoederirten Landen versprochen, Preßburg 1621.
[64] So zum Beispiel im Vorfeld des Friedens: Flämitzer, Johann Nicolaus (1687–1690) Sieben-Bürgens Oesterreicherischer Messias / Oder: Das durch den Glorwürdigsten Oesterreicherischen Leopoldum / Aus dem Rachen der Barbarischen Dienstbarkeit erlöste Fürstenthum Siebenbürgen / Das ist: Gründliche Demonstration, mit was unwiedertreiblichem Recht / die Röm. Kayserl. Majest. das herrliche Fürstenthum Siebenbürgen / als ein avulsum von dem Königreich Ungarn / wiederum aus der schnöden Dienstbarkeit des Ottomannischen Barbars gerissen / und dem Königreich Ungarn einverleibet haben: Alles aus wol solidirten fundamentis, des Rechts aller Völckerschafften / […] abgefasset, Nürnberg 1689.
[65] Als Beipiel deutlich in: Krekwitz, Totius Principatus Transylvaniae Accurata Descriptio. Das ist: Ausführliche Beschreibung des gantzen Fürstenthumbs Siebenbürgen / : Seinen Ursprung / Aufnahm und Wachsthumb / Abtheilung / Flüsse […] und Kriegs-Handlungen biß auf diese Zeit betreffend, Nürnberg 1688. Siebenbürgen wird dargestellt als Teil Ungarns, das »bey langen Jahren hero dem Türckischen Tyrannen und Bluthund Tribut- und Zinsbar gewesen / da es doch vor uralten Zeiten zu der Kron Hungarn gehöret«.
[66] Eine parallele Konstruktion für Ungarn beschreibt: Mihály, Türkenkrieg 2004.
[67] Zeitung ausz Ungaern und Siebebuergen / was sich in kurtzer verlauffener zeit begeben unnd zugetragen hat / mit allerley sachen biß auff den 21. Julii 1595. Und von der erhaltenen victorij wider den Grausamen Erbfeindt den Tuercken / wie der Siebenbierger mit huelff deß Walachiches Füersten etliche tausendt Mann erleget / unnd etliche Staett abgenommen. Köln 1595. Oder: Zwo warhafftige newe Zeittung […]. Wie durch Gottes H[ue]lff / der grosse F[ue]rst auß Siebenb[ue]rgen ein gewaltige Schlacht mit den T[ue]rcken gethan Geschehen diß 96.Jahr. | Jm thon wie man die tagweis singt, Wien 1596; Zwo Warhafftige Zeitung / Die Erst / wie die Fürsten in Sibenbürgen dem Tyrannnischen Bluthund / widerum einen Abbruch gethan / vnd in die dreissig Tausent T[ue]rcken erschlagen Geschehen den xxvj. tag May / diß 1595. Jars. Die Ander Geschicht / Wie die T[ue]rcken mit den Gefangenen Christen handlen / die selbigen auff dem Marcke Feyl bieten, Regensburg 1595 [Hervorheb.d.d.Verf.].
[68] Reichersdorff, Beschreibung von Siebenbürgen 1828, S. 29 und 31.
[69] Vgl. die Zusammenstellung rumänischer Provenienz Holban, Călători străine 1969–1971. Diese Quellengattung ist für das Fürstentum Siebenbürgen nur am Rande relevant. Die Reiserouten der Diplomaten nach Konstantinopel führten über Wien und Belgrad und berührten Siebenbürgen nicht.
[70] Parvev, Land in Sicht 2008.
Andrea Schmidt-Rösler, Grenzraum und Staatlichkeit. Zur Wahrnehmung des Fürstentums Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit , in: Martin Peters (Hg.), Grenzen des Friedens. Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne, Mainz 2010-07-15 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 4), Abschnitt 67–83.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/04-2010.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008061836>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 68 oder 67–70.
Bengt Büttner *
„an beider reiche grentzen oder sonst einem gelegenen ort“ – die dänisch-schwedischen Grenztreffen im 16. und 17. Jahrhundert
Gliederung:
6. Prestige und Präzedenzprobleme
7. Militärische Begleitmaßnahmen
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
Text:
Sagen die Treffpunkte für Verhandlungen zwischen zwei Mächten etwas über deren Verhältnis zueinander aus? Wenn ja, dann müsste sich aus einer Untersuchung der Treffpunkte für eine ganze Verhandlungsserie über einen längeren Zeitraum ablesen lassen, wie sich das Verhältnis im Laufe dieser Zeit entwickelt hat.
Für die Herausbildung der deutsch-französischen Beziehungen im Mittelalter ist eine solche Untersuchung von Ingrid Voss vorgenommen worden. Sie hat 1987 die Entwicklung von den ostfränkisch-westfränkischen zu den deutsch-französischen Königstreffen nachgezeichnet, deren Orte, Zeitpunkte, Dauer und Ablauf analysiert, und ist dabei zu dem Ergebnis gelangt: »Ortswahl und Typus der Zusammenkünfte entsprechen der jeweiligen politischen Situation und Machtkonstellation zwischen den Beteiligten«[1]. So seien die Herrschertreffen noch bis zum Jahr 965 als Besuche außerhalb des Grenzgebiets möglich gewesen, danach jedoch nur noch unmittelbar an der Grenze selbst[2]. Folglich ordnet sie die Herrschertreffen und Beziehungen bis ins 10. Jahrhunderts noch einer »Spätphase der fränkischen Geschichte« zu; erst nach dem 10. Jahrhundert sei dieser »fränkische Zusammenhang« endgültig abgebrochen[3].
Ebenso wie die Auflösung des fränkischen Karolingerreichs vollzog sich auch der Zerfall des 1397 in Kalmar begründeten skandinavischen Unionsreichs über einen längeren Zeitraum. Seit der Krisenphase der Union (1448–1520) und um so stärker nach der Vertreibung des letzten Unionskönigs 1521/1523 entwickelten sich die dänisch-norwegische Doppelmonarchie und der im Entstehen begriffene schwedische Nationalstaat auseinander und traten in ein Verhältnis erbitterter Rivalität um die Vorherrschaft im Ostseeraum ein. Die engen partnerschaftlichen Beziehungen, die das ganze Mittelalter hindurch über alle Differenzen hinweg bestanden hatten, gingen mehr und mehr verloren und wurden durch die gleichen Beziehungsformen ersetzt, wie sie auch zwischen anderen frühmodernen Staatswesen herrschten. Spiegelt sich dieser Wandel auch in der Wahl der Verhandlungsplätze zwischen beiden Seiten wider?
84
Seit der Studie von Ingrid Voss ist die Untersuchung von Herrschertreffen auf eine neue theoretische Grundlage gestellt und weiterentwickelt worden, indem sich die historische Forschung wieder verstärkt der lange diskreditierten Dimension des Raums zugewandt hat. Anders als in der »Geopolitik« früherer Jahrzehnte werden historische Räume in der Geschichtswissenschaft heute nicht mehr als naturgegeben hingenommen, sondern sie entstehen erst in der Wahrnehmung der handelnden Personen und sind in deren soziales Handeln eingebunden[4].
Ausgehend von einem solchen konstruktivistischen Raumverständnis zielt die Erforschung historischer Räume heute ab auf die Beziehungen zwischen Raum, Macht und Status und geht der Frage nach, welche Rolle der Raum für die Kommunikation zwischen den Handelnden gespielt hat[5]. Zu den bevorzugten Untersuchungsobjekten der neuen Raumforschung gehören daher Grenzen, da sich an ihnen das Verhältnis zwischen Raum, Macht und sozialem Status besonders deutlich niederschlägt[6]. Selbst wenn Grenzen in der Regel mehr mit der Raumwahrnehmung und den Konzepten ihrer Schöpfer zu tun haben als mit naturgegebenen topographischen Verhältnissen, so stellen sie für die Herrschenden gleichwohl ein geeignetes Forum dar, ihre Macht und ihren Status sowohl gegenüber den eigenen Untertanen als auch gegenüber benachbarten Herrschern und deren Untertanen in Szene zu setzen. Das gilt besonders dann, wenn sich zwei Herrscher oder ihre Vertreter an der Grenze zu Verhandlungen gegenüberstanden, wie Thomas Rahn in seinem Aufsatz Grenz-Situationen des Zeremoniells in der Frühen Neuzeit aufgezeigt hat[7].
Rahn zufolge sind Herrschertreffen in der Frühen Neuzeit als zeremonielle Duelle zu verstehen, bei denen es auf dialektische Weise darum ging, den eigenen (Vor-)Rang gegenüber dem anderen zu demonstrieren und diesen Rangstreit gleichzeitig durch ein bestimmtes Zeremoniell zu überspielen. Vorrang oder Präzedenz finden ihren Ausdruck in bestimmten Sitzordnungen oder in der unterschiedlichen Bemessung von Bewegungsaufwand, während der Rangstreit durch zeremonielle Symmetrie und simultane Bewegungen am Verhandlungsplatz abgebaut wurde. Auf diese Weise wurde die Grenze selbst zu einem zeremoniellen Raum und erfüllte dieselbe Funktion wie dieser, nämlich die Machtbehauptung im Raum.[8].
Der folgende Beitrag unternimmt den Versuch, die vorgestellten Überlegungen zu Raum, Macht und Status auf die Treffen zwischen den skandinavischen Herrschern und vor allem zwischen ihren Räten während des 16. und 17. Jahrhunderts anzuwenden. Dabei wird er die Entwicklung der gewählten Treffpunkte nachzeichnen, besondere Abweichungen bei der Beteiligung der beiden Könige an den Treffen herausstellen, auf die Präzedenzkonflikte eingehen und auf die militärischen Maßnahmen verweisen, welche die Treffen zuletzt begleiteten. Aus allen diesen Faktoren sollen Aussagen über die allgemeine Entwicklung der dänisch-schwedischen Beziehungen gewonnen werden.
85
Nach dem Tode des Unionskönigs Christoffer von Bayern (reg. 1440–1448) hielten die dänisch-norwegischen Könige Christian I. (reg. 1448–1481), Hans (oder Johann, reg. 1481–1513) und Christian II. (reg. 1513–1523) an ihren Ansprüchen auf den schwedischen Thron fest. Sie konnten diese jedoch immer nur in kurzen Phasen gegen die vom schwedischen Reichsrat und von den schwedischen Ständen eingesetzten Gegenkönige und Reichsvorsteher durchsetzen. Ihre Bemühungen hatten eine scheinbar endlose Abfolge von Verhandlungen, Schiedsabreden, Feldzügen, Waffenstillständen und neuen Verhandlungen zur Folge, in denen die Reichsräte beider Seiten versuchten, einen Ausgleich zu finden[9]. Die Reichsräte bildeten in allen drei skandinavischen Reichen die wichtigste Instanz ständischer Mitregierung. Ihre Mitglieder rekrutierten sich aus dem Hochadel und – bis zur Reformation – aus dem hohen Klerus. Zwar wurden sie vom König ernannt, doch waren sie nach ihrer Ernennung nicht mehr absetzbar. Außerdem galten die Inhaber bestimmer Ämter sowie die Repräsentanten einger Familien – der Ratsaristokratie – mit der Zeit als sozusagen »gesetzte« Mitglieder der jeweiligen Gremien. In den Wahlmonarchien Dänemark und Schweden konnten sie die königliche Regierungsgewalt durch königliche Wahlkapitulationen beschränken[10]. Die Familien der Ratsaristokratie unterhielten auch über die Reichsgrenzen hinweg enge Beziehungen zueinander. Untereinander verschwägert oder in mehreren Reichen begütert, wirkten sie in Dänemark und Norwegen als Stützen der Unionsidee. In Schweden war der Reichsrat in der Unionsfrage zumindest gespalten[11]. Die Unionssympathien in Teilen der Ratsaristokratie überdauerten das Ende der Personalunion und lieferten auf beiden Seiten einen Impuls für das Fortleben der dänisch-schwedischen Sonderbeziehung, nun unter veränderten Vorzeichen[12].
Nachdem der hansefeindliche Unionskönig Christian II. 1521 durch einen Aufstand aus Schweden vertrieben worden war, erhob sich auch der dänische Adel mit hansestädtischer Unterstützung gegen den König, und der dänische Reichsrat wählte Christians Onkel Frederik zum Nachfolger (reg. 1523–1533). Die Schweden wählten den Anführer ihres Aufstands, den Hochadligen Gustav Vasa zu ihrem König (reg. 1521–1560)[13]. Fortan kreisten die dänisch-schwedischen Verhandlungen nicht länger um den Herrschaftsantritt des dänischen Königs in Schweden. Stattdessen rückten der neue dänische König Frederik I. und sein Sohn Christian III. (reg. 1534–1559) sowie Gustav I. in Schweden aus Furcht vor einer Rückkehr des vertriebenen Unionskönigs und vor den Ansprüchen seiner Erben näher zusammen, schlossen mehrere Zweckbündnisse ab und vereinbarten eine Schiedsgerichtsbarkeit für bilaterale Streitfragen, die durch die Reichsräte ausgeübt werden sollte (Lödöse 1528, Stockholm 1534, Brömsebro 1541)[14]. Einem echten, dauerhaften Ausgleich zwischen Dänemark und Schweden stand jedoch das tief verwurzelte Misstrauen Gustav Vasas gegenüber Dänemark entgegen und vereitelte die praktische Umsetzung der Schiedsabreden.
86
Der Regierungsantritt der Könige Frederik II. in Dänemark (reg. 1559–1588) und Erik XIV. in Schweden (reg. 1560–1568) führte rasch zu einer Verschärfung der dänisch-schwedischen Gegensätze. Die Streitigkeiten um Gebiete in Livland sowie um die Führung des Drei-Kronenwappens eskalierten im sogenannten »Nordischen Siebenjährigen Krieg« (1563–1570), der erst nach einem Umsturz in Schweden durch das Eingreifen ausländischer Vermittler auf dem Friedenskongress von Stettin beendet werden konnte[15].
Da Schweden im Baltikum in Kriege gegen Russland und Polen verwickelt blieb, konnten sich die dänisch-schwedischen Beziehungen in den zwei Jahrzehnten nach 1570 zunächst wieder entspannen[16]. Die Schiedsgerichtsbarkeit zwischen den beiden Reichen war im Frieden von Stettin sogar noch ausgebaut worden (Art. 24–25) und gab den Reichsräten ein beträchtliches Mitspracherecht zur Ausgestaltung der innerskandinavischen Beziehungen an die Hand[17]. Den beiden Monarchen waren die Schiedskompetenzen ihrer Räte jedoch immer mehr ein Dorn im Auge. In der Praxis scheuten sie deshalb davor zurück, das Schiedsgericht anzurufen. Stattdessen konnten sich die Reichsräte auf ihren Grenztreffen (1572, 1575, 1580, 1591) auf eine gütliche Beilegung oder Vertagung der Konfliktpunkte zwischen ihren Reichen (Drei-Kronenwappen, Burgen in Livland, bilaterale Zoll- und Handelsfragen, Grenzstreitigkeiten, Russlandhandel, Besteuerungsrechte in Lappland) einigen[18].
Erst um die Jahrhundertwende, nach dem Herrschaftsantritt des aggressiven Königs Christian IV. (reg. 1588–1648) in Dänemark und mit der Expansionspolitik des schwedischen Königs Karl IX. (reg. 1603–1611) zur norwegischen Eismeerküste verschlechterte sich das Verhältnis erneut[19]. Nachdem beide Seiten im Februar 1601 an der Grenze eine Anrufung des Schiedsgerichts verabredet hatten, und nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen zu seiner Einsetzung, ergingen im Frühjahr 1603 tatsächlich zwei Schiedsurteile in den strittigen Fragen. Eine Stimmenmehrheit der Schiedsrichter stand jedoch hinter keinem der beiden Urteile, so dass die endgültige Entscheidung einem fremden Fürsten als Obmann übertragen werden musste. Beide Seiten versuchten in den folgenden Jahren bestenfalls halbherzig, einen solchen Obmann zu bestimmen. Eine unter neutraler Vermittlung vorgesehene Tagung in Wismar scheiterte 1608 am Ausbleiben der schwedischen Delegation[20]. Die dänisch-schwedischen Spannungen bestanden fort und entluden sich 1611 im sogenannten »Kalmar-Krieg«, der 1613 mit Hilfe englischer Vermittler im Frieden von Knäred beendet wurde. Schweden musste fortan auf einen Zugang zum Eismeer verzichten und unter anderem die Festung Älvsborg an der Mündung des Göta Älv mit einer hohen Geldsumme von den dänischen Eroberern einlösen[21].
87
Seit 1618 wurde das dänisch-schwedische Verhältnis vom Dreißigjährigen Krieg in Deutschland überschattet. Obwohl die dänische Seite 1619 bei einem Grenztreffen alle schwedischen Bündnisangebote abgelehnt hatte, trafen die beiden Könige Christian IV. und Gustav Adolf (reg. 1611–1632) direkt nach den Verhandlungen in einem festlichen Rahmen zusammen[22]. Im Jahre 1621 tauschten die beiden Nachbarn erstmals ständige diplomatische Repräsentanten aus[23]. Für politische Verhandlungen bedienten sie sich jedoch vorerst weiterhin des Instruments der Grenztreffen: Beim Treffen von 1624 gelang es den Schweden, Dänemark unter impliziten Kriegsdrohungen große Zugeständnisse in allen zwischen beiden Mächten schwebenden Fragen (Zollerhebung in Schweden und im Öresund, innerskandinavische Handelsfreiheit, territoriale Absprachen zwischen Schweden und Russland) abzupressen[24]. Kurz danach entschloss sich Christian IV. zum Eingreifen in Deutschland – ein Engagement, das Dänemark mit einer Niederlage und mit der Besetzung Jütlands durch kaiserliche Truppen bezahlte[25]. Selbst wenn Dänemark im Frieden von Lübeck (1629) noch keine territorialen Einbußen erlitt, so ging die Vormachtstellung in Skandinavien und Norddeutschland nun auf Schweden über, dessen König Gustav Adolf durch seine deutschen Feldzüge den Grundstein für Schwedens europäische Großmachtstellung im 17. und frühen 18. Jahrhundert legte[26]. Christian IV. mochte die Ambitionen seines schwedischen Nachbarn und Rivalen nicht noch fördern: Zwar konnten die beiden 1628 zwei Bündnisse über die gegenseitige Unterstützung ihrer Kriegsflotten sowie über die gemeinsame Verteidigung der Stadt Stralsund gegen die kaiserlichen Belagerer abschließen[27]. Doch wies Christian auf einem zweiten Königstreffen im Jahre 1629 alle Versuche Gustav Adolfs ab, Dänemark für eine weitergehende militärische Kooperation unter schwedischer Führung zu gewinnen[28].
Stattdessen drängte sich Christian als Vermittler zwischen Schweden und dem Kaiser im Dreißigjährigen Krieg auf, wobei er vor allen Dingen die Absicht verfolgte, schwedische Gebietserwerbungen in Norddeutschland zu verhindern. Um den Störmanövern der dänischen Diplomatie einen Riegel vorzuschieben, eröffneten die Schweden den sogenannten »Torstensson-Krieg« (1643–1645)[29]. Im Frieden von Brömsebro musste die dänische Monarchie erstmals territoriale Verluste an Schweden hinnehmen, und zwar nicht nur im Baltikum und in Norwegen, sondern auch in Dänemark selbst, wo die Landschaft Halland östlich des Kattegats zunächst für 30 Jahre pfandweise an Schweden verloren ging[30]. Außerdem mussten die Dänen nun tatenlos zusehen, wie Schweden im Westfälischen Frieden (1648) strategisch wichtige Gebiete und Stützpunkte in Norddeutschland erwarb (Vorpommern, Wismar, Bremen-Verden), so dass sich Dänemark im Süden von Schweden umfasst fand[31]. Ein dänischer Revancheversuch missglückte und resultierte 1658 in dem für Dänemark traumatischen Friedensschluss von Roskilde, der das Reich um die Landschaften Schonen, Halland und Blekinge verkleinerte und die dänisch-schwedische Grenze bis an den Öresund verschob[32].
Die Treffpunkte, an denen sich die Reichsräte oder ihre Monarchen im Laufe der behandelten Periode zu Verhandlungen begegneten, um Rezesse aufzusetzen und Verträge zu schließen, waren keineswegs zufällig gewählt. Einige kehrten immer wieder, andere verschwanden als Treffpunkte und wurden durch neue ersetzt. Daher lohnt es sich, die Aufmerksamkeit auf diese räumliche Dimension der dänisch-schwedischen Beziehungen zu lenken, und zwar auf die Treffpunkte selbst, derer sich beide Seiten bedienten, und auf die Formen, die sie dabei beachteten.
88
In ihrem Beistandspakt von 1534 hatten Dänen und Schweden eine sogenannte »institutionelle« Schiedsgerichtsbarkeit zwischen ihren Reichen vereinbart. Bei Streitfragen sollten beide Seiten sechs oder zwölf Schiedsherren abordnen, die sich an einem für beide am besten zugänglichen Ort zu versammeln, über die Streitfragen zu befinden und eine Entscheidung zu verkünden hatten (Art. 18: »på en stad, hvar begge rikerne best och legeligeste är«). Die folgenden Bündnisse von 1540 (nicht ratifiziert) und 1541 wiederholten die Schiedsbestimmung in ähnlichem Wortlaut[33]. Wo aber lagen diese am besten zugänglichen Orte?
Zwar kam es bis zum Nordischen Siebenjährigen Krieg nur ein einziges Mal zu einem Schiedstreffen gemäß den Bestimmungen der Verträge, nämlich 1554 in der schwedischen Festung Älvsborg[34]. Ansonsten und außerhalb der Schiedsgerichtsbarkeit trafen dänische und schwedische Vertreter jedoch oft zu Gesprächen über gemeinsame Abschiede und Verträge zusammen. Die Orte, an denen diese Verhandlungen tatsächlich stattfanden oder auch nur vereinbart waren, lagen mehrheitlich in Grenz- und Küstennähe und konzentrierten sich auf drei Regionen.
An der Kattegatküste sowie daran anschließend im Mündungsgebiet des Göta Älv waren dies außer der Festung Älvsborg (1554) die Städte Halmstad (1537, nicht zustandegekommen 1538, 1553), Lödöse (1528), Nya Lödöse (1541, nicht zustandegekommen 1540) und Varberg (1530, nicht zustandegekommen 1538, 1547). Von diesen Orten war Halmstad einer der wichtigsten Treffpunkte der Unionszeit gewesen, an dem zentrale Unionsdokumente wie die Rezesse von 1450 und 1483 über die gemeinsame Königswahl beschlossen worden waren[35]. Folgerichtig hatte es in der Unionszeit immer wieder Bestrebungen gegeben, Halmstad als Ort für die gemeinsame Königswahl sowie für regelmäßige Unionsverhandlungen zu institutionalisieren[36]. Auch in der schwedischen Handelsstadt Lödöse am Göta Älv, in ihrer Nachfolgesiedlung Nya Lödöse ca. 40 km flussabwärts sowie in der dänischen Stadt Varberg waren während der Unionszeit dänische und schwedische Reichsräte zu Verhandlungen zusammengetroffen[37]. Ebenso wie Halmstad sollte Nya Lödöse in den 70er und 80er Jahren des 15. Jahrhunderts zum regelmäßigen Treffpunkt für Unionsverhandlungen erhoben werden[38]. Nur die schwedische Festung Älvsborg, die in den Auseinandersetzungen der Unionszeit lange von den dänischen Königen gehalten worden war, hatte vor dem Schiedstreffen von 1554 noch keine Tradition als Verhandlungsplatz ausbilden können[39].
89
Die nächste Gruppe von Treffpunkten reihte sich entlang der Ostseeküste von Kalmar (1540, nicht zustandegekommen 1541) über Brömsebro (1541) bis nach Ronneby (1541) und Åhus (1541). In der schwedischen Festung Kalmar, an der Meerenge zwischen dem småländischen Festland und der Insel Öland gelegen, war 1397 die Union der drei skandinavischen Reiche begründet worden. Seither hatte sich der Ort zu dem am häufigsten aufgesuchten Schauplatz für die Unionsverhandlungen entwickelt: Hier hatten Vertreter des dänischen und des schwedischen Reichsrats 1472 einen Friedensvertrag geschlossen. Er sah vor, künftig alle Streitfragen zwischen ihren Reichen friedlich durch ein Schiedsgericht zu regeln, das von 1473 bis 1476 insgesamt dreimal in Kalmar zusammentrat. Im Jahre 1483 hatte der schwedische Reichsrat in Kalmar die Königsannehmung von König Hans beschlossen. Zwar gelangte dieser vorerst weiterhin nicht an die Regierung in Schweden, doch bekräftigten die Räte auf zwei weiteren Treffen in Kalmar 1484 und 1495 erneut den Fortbestand der Union[40]. Auch die Städte Ronneby in Blekinge und Åhus im Nordosten der Landschaft Schonen hatten schon als Treffpunkte zwischen den Reichsräten und König Christian I. gedient[41]. Nur unmittelbar auf der Grenze zwischen Blekinge und der schwedischen Landschaft Småland, in Brömsebro, waren vor den Verhandlungen von 1541 niemals Vertreter beider Seiten zusammengetroffen.
Die letzten beiden Treffpunkte zum Abschluss von Abschieden und Verträgen lagen zu beiden Seiten des Öresunds in Kopenhagen (1536, 2 Treffen 1562) und Malmö (1524, nicht zustandegekommen 1538). Kopenhagen war als bevorzugte Residenz der dänischen Könige seit dem 15. Jahrhundert de facto die Hauptstadt des dänisches Reichs. Hier fanden sich in der ausgehenden Unionszeit immer wieder schwedische Ratsgesandte ein, um mit den Königen Hans und Christian II. und ihren Räten Waffenstillstände und Schiedsgerichte zu vereinbaren (1504, 1508, 1509, 1513, 1515)[42]. Ein weiterer dänisch-schwedischer Waffenstillstand war 1512 gegenüber von Kopenhagen in der Messestadt Malmö ausgehandelt worden[43].
Ausnahmen von den grenznahen Verhandlungsplätzen gab es nur selten und unter besonderen Umständen: Beim Königstreffen in Malmö 1524 wurde eine Übereinkunft ausgehandelt, nach der ein hansisches Schiedsgericht zu Pfingsten 1525 in Lübeck über den künftigen Besitz der norwegischen Landschaft Viken sowie der Insel Gotland befinden sollte. Das Schiedstreffen kam jedoch niemals zustande[44]. Einige Jahre später, nachdem sich Dänemark und Lübeck überworfen hatten, kamen drei dänische Gesandte nach Stockholm gereist und schlossen im Februar 1534 einen Beistandspakt gegen Lübeck ab. Da dessen Unterhändlerexemplar im Zuge der sogennanten »Grafenfehde« in lübische Hände gefallen war, musste sich der neue dänische König Christian III. im September 1535 zu einer weiteren Stockholm-Reise aufmachen, um das dringend benötigte Bündnis zu ratifizieren und weitere schwedische Kredite und Hilfslieferungen gegen Lübeck zu erlangen[45]. Solche situationsbedingten Vereinbarungen, abgeschlossen abseits der Grenzregionen, hatte es aber auch schon in der Unionszeit gegeben, in Lübeck (1469) ebenso wie zu verschiedenen friedlichen und kriegerischen Gelegenheiten in und vor der Stadt Stockholm (1457, 1468, 1471, 1497, 1518)[46].
90
Als Ergebnis dieser Übersicht lässt sich festhalten, dass die dänisch-schwedischen Verhandlungsplätze der Periode von 1520 bis 1563 ganz in der Tradition der Unionszeit standen. Die grenznahen Treffpunkte waren überwiegend Küstenstädte auf der dänischen Grenzseite. Auf der Reichsgrenze selbst, wie sie seit ca. 1050 mit wachsender Präzision zwischen den dänischen Landschaften Schonen, Halland und Blekinge sowie den schwedischen Landschaften Västergötland und Småland markiert war[47], hielt man zunächst keine Verhandlungen ab. Das lag sicher daran, dass diese Grenze im Binnenland bis in die frühe Neuzeit hinein durch arme, dünn besiedelte Waldgebiete verlief und nur entlang der Flüsse (Ätran, Nissan, Lagan, Helge Å, Ronneby Ån) von Verkehrswegen durchzogen wurde. Auf schwedischer Seite setzte sich die dünne Besiedlung bis weit ins Landesinnere von Västergötland und Småland fort[48]. Deshalb kamen auf der schwedischen Seite eigentlich nur die Küstenfestung Kalmar gegenüber der Insel Öland sowie im Mündungsgebiet des Göta Älv die Handelsplätze Lödöse und Nya Lödöse mit der Festung Älvsborg als geeignete Treffpunkte in Betracht.
An den Küsten der ostdänischen Landschaften Halland, Schonen und Blekinge hatte sich dagegen seit dem Mittelalter eine Reihe von kleineren Städten ausgebildet. Sie lagen insbesondere an den Flussmündungen und lehnten sich an ältere Burgen an, die seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zu modernen Festungen ausgebaut wurden, und von denen aus königliche Amtleute (oft mit Sitz im dänischen Reichsrat) die umliegenden Landschaften verwalteten[49]. In diesen Städten, die von der schwedischen Grenze in ein bis zwei Tagesreisen zu erreichen waren, wurde zum Einen der grenzüberschreitende Handel mit den Produkten der schwedischen Landbevölkerung (Holz, Teer, Vieh, Butter, Tierhäute) abgewickelt[50]. Zum Anderen standen diese Städte aber auch über das Meer mit der Hauptstadt Kopenhagen und den anderen dänischen Landesteilen in Verbindung. Da sie außerdem Möglichkeiten zur Unterbringung und Verpflegung der Gesandtschaften boten, waren sie als Treffpunkte für Verhandlungen gut geeignet.
Mit den Treffen auf der Grenze in Brömsebro während der Verhandlungsserie des Jahres 1541 wichen die Verhandler erstmals von der Regel ab, dass die Vertreter der einen Seite die Grenze überschritten, um mit den Vertretern der anderen Seite an einem grenznahen Treffpunkt zu verhandeln. Vermutlich steht diese Abweichung im Zusammenhang mit dem geplanten Königstreffen.
91
Schon vor 1541 hatten die persönlichen Begegnungen der beiden Könige besonderen Anlass zu Komplikationen geboten. Das erste Königstreffen nach der Vertreibung Christians II. war 1524 erst nach umfangreichen Vorverhandlungen zustandegekommen. Zunächst hatte König Gustav die Einladung Frederiks zum »Herrentag«, zum Gerichtsstand des dänischen Adels, in Kopenhagen abgelehnt, der zu Pfingsten (15. Mai) beginnen und im August seine Fortsetzung in der Krönung Frederiks finden sollte. Es bedurfte deshalb erst beträchtlicher Anstrengungen dänischer und hansischer Gesandter sowie der Stellung von sechs Adeligen und eines Stralsunder Bürgermeisters als Geiseln für Gustavs Sicherheit, bis sich dieser auf ein persönliches Treffen mit Frederik in Malmö einließ[51]. Auch das Treffen in Lödöse war 1528 zunächst als Königstreffen verabredet, doch ließ sich Frederik einen Monat vor dem Beginn der Verhandlungen von der Teilnahme entschuldigen[52]. Die informelle Stockholmreise des noch ungekrönten Königs Christians III. im Jahre 1535 ist wohl am besten aus der Notlage zu erklären, in der sich Dänemark nach Ausbruch der »Grafenfehde« befand[53].
Auch das Königstreffen in Brömsebro war erst nach längerem Vorlauf möglich geworden: Bereits unmittelbar nach der Unterzeichnung des Bündnisvertrags von Kalmar im November 1540 hatte Christian vorgeschlagen, das Bündnis im folgenden Februar auf einem Königstreffen in Varberg zu ratifizieren. Gustav lehnte jedoch ab und brachte stattdessen den Vorschlag eines Königstreffens in Kalmar für Ende Mai 1541 ins Spiel, der die Zustimmung Christians fand. Als sich im Mai 1541 die angekündigte Ankunft von König Gustav in Kalmar – aus unbekannten Gründen – immer weiter verzögerte, trafen zunächst nur die Räte beider Seiten auf der Grenze in Brömsebro zusammen. Sie sollten die noch offenen Bündnisfragen möglichst vor dem Königstreffen aus dem Weg räumen, da dieses aufgrund der schwierigen Verpflegungssituation für die repräsentativen Gefolge der beiden Könige nicht lange währen durfte. Bei diesen Vorverhandlungen traten jedoch neue Streitfragen auf, bis sie im Juli 1541 vorerst abgebrochen wurden[54].
Erst eine Gesandtschaft schwedischer Räte zu König Christian nach Åhus brachte die Verhandlungen im August wieder in Gang und führte zu neuerlichen Versuchen, ein Königstreffen zu vereinbaren[55]. Eine Einladung zu König Gustav nach Kalmar schlug Christian nun aus Termingründen aus, während ein Königstreffen auf der Grenze selbst mit großen Verpflegungsschwierigkeiten verbunden blieb. Deshalb gingen die dänisch-schwedischen Bündnisverhandlungen vor König Christian in Ronneby auf der dänischen Seite der Grenze weiter und waren auch beim endlich erfolgten Zusammentreffen der beiden Könige auf der Grenze in Brömsebro vermutlich am 23. September 1541 noch nicht abgeschlossen[56]. Reinschrift und Ausfertigung des Bündnisvertrags erfolgten deshalb wohl erst nach dem Königstreffen, auch wenn man die ursprüngliche Datierung des schwedischen Vertragsentwurfs beibehielt: »Geschehen und geben an beyder unser reich Schweden und Dennemarken grentzen zu Bremsebro an tage exaltationis crucis, der do ist der funfzehende tag des monats Septembris«[57]. Die Vorgeschichte des Vertrags von Brömsebro erweckt also den Anschein, Prestige-Erwägungen hätten es zuerst den Monarchen immer schwerer gemacht, sich zu Verhandlungen auf das Herrschaftsgebiet des anderen zu begeben, noch lange bevor die Problematik von Rang und Präzedenz die gewöhnlichen Rätetreffen erfasste.
92
Der Nordische Siebenjährige Krieg (1563–1570) ging von Anfang an mit intensiven Vermittlungsbemühungen auswärtiger Mächte einher, des Kaisers, des Königs von Frankreich und verschiedener deutscher Fürsten, die wiederholt Verhandlungen in Rostock anberaumten. Diese kamen jedoch nie zustande, entweder weil weder dänische noch schwedische Gesandte in Rostock erschienen (wie 1563) oder weil der schwedische König Erik mitteilen ließ, er verlange Verhandlungen auf schwedischem Boden (wie 1564)[58]. Es erregte daher große Aufmerksamkeit in Dänemark, als sich Erik 1567 zu Verhandlungen in der dänischen Küstenstadt Falkenberg (in Halland zwischen Varberg und Halmstad) bereit erklärte. Dort wollte er die Tradition der Vorkriegstreffen fortsetzen, d.h. mit den Dänen allein verhandeln, ohne deren Verbündete Polen und Lübeck, und erst nach einem umfassenden Austausch von Kriegsgefangenen. Da die dänische Seite darauf nicht eingehen wollte, zerschlug sich auch dieser Verhandlungsansatz[59].
Zu Friedensverhandlungen kam es erst nach dem Sturz Eriks durch seine Brüder Johan und Karl. Sie fanden im Oktober und November 1568 in der ehemaligen Bischofsstadt Roskilde (westlich von Kopenhagen) statt, in die sich der dänische König Frederik II. mit seinem Hof vor der in der Hauptstadt herrschenden Pest zurückgezogen hatte. Ein grenznäherer Ort kam wegen des andauernden Krieges nicht in Frage, da Frederik einen Waffenstillstand während der Verhandlungen verweigerte[60]. Eingeschüchtert ließen sich die schwedischen Verhandler im Frieden von Roskilde harte Bedingungen auferlegen. Die Bestimmungen zur Schiedsgerichtsbarkeit (Art. 18–20, 22) basierten auf den Verträgen von Stockholm (1534) und Brömsebro (1541), bauten diese jedoch noch aus durch die Hinzufügung eines Obmanns als einer zweiten Instanz, falls sich die Schiedsrichter nicht einig werden konnten[61]. Der Treffpunkt, an dem das Schiedsgericht zusammentreffen sollte, wurde genauer definiert als »ein bequemer Ort an der Grenze oder andernorts, wo es günstig erscheint« (Art. 18: »nogen beqvemlig platz ved grenzen eller andenstedts, hvor det kan verre beleiligt«)[62].
93
Es waren jedoch nicht die Schiedsbestimmungen, die den neuen schwedischen König Johan III. (reg. 1569–1592) dazu bewogen, die Ratifikation des Friedensvertrags zu verweigern und neue Verhandlungen zu fordern, die entweder auf der Grenze in Brömsebro oder in Deutschland stattfinden sollten. Nach anfänglichem Widerwillen schlug Frederik II. schließlich ein Grenztreffen vor, das Ende Juli 1569 zwischen dem dänischen Flecken Knäred und dem schwedischen Pfarrhof Ulvsbäck (Kirchspiel Markaryd) stattfinden sollte. Die Orte lagen beiderseits der Grenze zwischen Halland und Småland in der Niederung des Flusses Lagan, neben dem ein wichtiger Verkehrsweg von den dänischen Küstenstädten Helsingborg und Laholm an den schwedischen Vätternsee verlief[63]. Im Juli 1569 begannen die Verhandlungen in Trälshult, ca. 3 km vom Grenzverlauf entfernt auf dänischer Seite. Aus Prestigegründen hatten sich die Dänen geweigert, am Grenzverlauf selbst, in der Ortschaft Sjöaryd zu verhandeln, wie es die Schweden vorgeschlagen hatten. Die Gespräche selbst wurden offenbar in Zelten geführt. Selbst wenn die Verhandler für dieses Mal ohne ein Ergebnis auseinandergingen, gaben die Verhandlungen doch das Muster dafür vor, wo und unter welchen Umständen künftige Treffen an der Grenze ablaufen sollten[64].
Nachdem ein weiterer Versuch der Vermittler, die Kriegsparteien Dänemark und Schweden zu Verhandlungen in Rostock zusammenzubringen, am Ausbleiben ihrer Vertreter gescheitert war, schlug die schwedische Seite im Frühjahr 1570 die pommersche Residenzstadt Stettin als Austragungsort für neue Friedensverhandlungen vor. Dort trafen über den Sommer der Reihe nach die Vertreter der Kriegsparteien und der wichtigsten Vermittler ein, um auf dem ersten internationalen Friedenskongress der nordeuropäischen Geschichte unter dem formellen Vorsitz des Herzogs Johann Friedrich von Pommern-Stettin einen Friedensvertrag auszuhandeln[65]. Der Frieden von Stettin, am 13. Dezember 1570 auf dem Stettiner Rathaus verkündet, brachte inhaltlich nur wenige Änderungen gegenüber dem nicht ratifizierten Frieden von Roskilde mit sich. Die Bestimmungen zur Schiedsgerichtsbarkeit wurden genauer spezifiziert und aufgeteilt in Bestimmungen zur isolierten Schiedsgerichtsbarkeit in der Drei-Kronenfrage (Art. 4) und solche zur institutionellen Schiedsgerichtsbarkeit für alle übrigen Streitfragen zwischen den zwei Reichen (Art. 24–25). Während in der Drei-Kronenfrage Schiedsverhandlungen von 1572 bis 1575 vor auswärtigen Schiedsherren in Rostock vorgesehen waren, sollten sich in den übrigen Streitfällen die Reichsräte »an beider reiche grentzen oder sonst einem gelegenen ort« treffen und als Schiedsgericht konstituieren, ganz ähnlich wie es der Vertrag von Roskilde bestimmt hatte (siehe oben Abschnitt 93)[66].
94
In der nun folgenden Phase der dänisch-schwedischen Beziehungen bis 1645 lässt sich beobachten, wie die Verhandlungsplätze zwischen beiden Reichen von den grenznahen Städten und Festungen an den Verlauf der Grenze rückten. Die entsandten Reichsräte überquerten die Grenze nun in der Regel nicht mehr, sondern bezogen Quartiere auf dem Territorium ihrer eigenen Reiche, von denen sie sich zu den Gesprächen am verabredeten Treffpunkt an der Grenze aufmachten.
In der Grenzregion zwischen Nordhalland und Västergötland war dies der Grenzbach Flabäck an der Straße von Varberg nach Nya Lödöse (1591, 1601, 1603)[67]. Der traditionelle Treffpunkt Halmstad wurde nur noch einmal, im Jahre 1619, für ein Königstreffen aufgesucht. An der Stelle des Königstreffens von 1541, in der Siedlung Brömsebro an der Brücke über dem Grenzbach Brömsebäck zwischen Blekinge und Småland, fanden 1645 die Verhandlungen zur Beendigung des »Torstensson-Krieges« statt. In der unmittelbar südlich davon gelegenen dänischen Kleinstadt Avaskär hatte König Christian I. schon 1451 mit den Abgesandten des schwedischen Reichsrats verhandelt. Nun diente sie 1572 als Schauplatz für die Verhandlungen der beiden Räte in der Drei-Kronenfrage[68].
Die meisten Grenztreffen wurden nunmehr am Südwest-Zipfel der Landschaft Småland an der Grenze zu Halland zwischen Knäred und dem Pfarrhof Ulvsbäck abgehalten. Hier, unweit des Treffpunkts von 1569, am Grenzbach bei Sjöaryd, wurden zwischen 1570 und 1645 in Friedenszeiten nicht weniger als fünf Treffen veranstaltet (1575, 1580, 1602, 1619, 1624); außerdem wurde hier von Dezember 1612 bis Januar 1613 der Frieden von Knäred ausgehandelt. Ein weiteres Grenztreffen an dieser Stelle kam im September 1601 nicht zustande (siehe unten Abschnitt 99).
95
Einen Sonderfall stellt das geplante Treffen in Wismar vom September 1608 dar. Auf diesen Verhandlungsplatz hatten sich Dänen und Schweden für eine gemeinsame Tagfahrt mit braunschweigischen Räten geeinigt, nachdem der Schwager Christians IV., Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, die Aufgabe übernommen hatte, zwischen beiden Königen zu vermitteln. Die Dänen hatten ursprünglich eine Tagung in Rostock vorgeschlagen und den schwedischen Gegenvorschlag Brömsebro mit dem Argument abgewiesen, dieser Ort sei den braunschweigischen Vermittlern nicht zuzumuten. Schlechtes Wetter verhinderte jedoch die rechtzeitige Anreise der schwedischen Gesandten nach Wismar, so dass Dänen und Braunschweiger unverrichteter Dinge auseinandergingen. Nach dieser Erfahrung schrieb der schwedische Reichsrat noch im September 1608 nach Dänemark, er sei künftig nur noch bereit zu Grenztreffen anstatt zu Verhandlungen in Deutschland[69].
Gemeinsam war den nunmehr bevorzugten Treffpunkten in Flabäck, Brömsebro und Sjöaryd eine Lage an der Brücke über einen Grenzbach. Grenzgewässer, in ihrer Mitte befindliche Inseln, Boote oder auch über die Gewässer gelegte Brücken wurden seit dem Altertum als Austragungsorte für Herrschertreffen und diplomatische Verhandlungen bevorzugt. Das lag zum Einen sicher daran, dass Flüsse als sichtbare Grenzzeichen zwischen zwei Herrschaften wahrgenommen wurden. Zum Anderen ließ sich hier das mit dem Zusammentreffen zweier Herrscher verbundene Sicherheitsrisiko minimieren und der mit dem Übertritt in das Herrschaftsgebiet des anderen verknüpfte Prestigeverlust für einen der beiden Herrscher vermeiden[70]. Für die skandinavischen Treffpunkte ist der Sicherheitsaspekt zu vernachlässigen, denn alle drei Grenzbäche waren leicht zu überwinden. Demgegenüber haben Prestige- und Präzedenzüberlegungen bestimmt eine Rolle für die Ortswahl gespielt, indem sich beide Seiten an diesen Treffpunkten auch räumlich ihr äußerstes Entgegenkommen demonstrieren konnten[71].
96
Für die Verhandler war eine solche Demonstration erheblich unbequemer als Verhandlungen in einer grenznahen Stadt, wie sie vor 1570 geführt worden waren. Die Quartiere der Delegierten lagen nun kilometerweit entfernt von den Verhandlungsplätzen an der Grenze, bei den Treffen in Sjöaryd in Knäred (Dänemark) und Ulvsbäck (Schweden), bei Treffen in Flabäck in Vallda oder Kungsbacka (Dänemark) sowie in Våmmedal (Schweden) und bei Treffen in Brömsebro in Kristianopel (Dänemark) und Söderåkra (Schweden). Allzu komfortabel wird man sich die Quartiere in diesen zumeist kleinen Flecken und Weilern nicht vorstellen dürfen: Im Jahre 1602 befahl König Christian IV., in Knäred ein Blockhaus zur Unterbringung der dänischen Grenzkommissare bauen zu lassen[72]. Die Gespräche selbst fanden unter freiem Himmel oder in Zelten statt, die unweit der Grenzbrücken errichtet waren, und in die sich die einzelnen Delegationen für interne Beratungen zurückziehen konnten[73]. Wenn die Wetterverhältnisse auch dafür zu schlecht waren, wie bei den Flabäck-Treffen im Februar der Jahre 1601 und 1603, dann vereinbarten beide Seiten zunächst schriftliche Verhandlungen, bei denen nur Schriftsätze zwischen den beiden Quartieren ausgetauscht wurden[74]. Aufgrund der langen Wege zwischen den Quartieren war dieses Verfahren jedoch sehr umständlich.
Die Verlegung der Verhandlungen an einen bequemeren Ort erwies sich in der Regel als ausgeschlossen. War es 1572 noch gelungen, das für Brömsebro vereinbarte Treffen in die nahegelegene Stadt Avaskär zu verlegen, so bestanden die Schweden 1591 auf Verhandlungen in Flabäck, als sich die Dänen nach schwedischen Quartierwünschen in Kungsbacka erkundigten[75]. In Sjöaryd sprachen sich die Schweden 1602 gegen die von den dänischen Delegierten vorgeschlagene Fortsetzung des Treffens in Helsingborg aus. Ebenso vergeblich war der beim Grenztreffen in Flabäck 1603 vorgetragene dänische Wunsch nach einer Verlegung nach Kungsbacka. Im Jahre 1619 schließlich war die Begegnung der beiden Monarchen im Anschluss an das Grenztreffen in Sjöaryd schon verabredet. Trotzdem lehnte der schwedische Reichskanzler Axel Oxenstierna auf dem Grenztreffen alle dänischen Wünsche ab, die Verhandlungen unter Hinzuziehung der beiden Könige in Halmstad fortzusetzen[76].
97
Nach dem bisher Dargelegten erscheint es paradox, dass im Jahre 1619 gerade das erste skandinavische Königstreffen seit 1541 nicht auf der Grenze, sondern am alten Unionstreffpunkt Halmstad abgehalten wurde. Bei einer genaueren Betrachtung erweist sich jedoch, dass sich der Besuch Gustav Adolfs in Halmstad 1619 in seiner Funktion vom Königstreffen 1541 und von den üblichen Grenztreffen der Reichsräte unterschied.
Auf Wunsch Gustav Adolfs und unabhängig vom Rätetreffen in Sjöaryd, jedoch in dessen Anschluss verabredet, hatte die königliche Begegnung vor allem repräsentativen Charakter. Gustav Adolf und sein Gefolge wurden zunächst an der Grenze von zwei dänischen Reichsräten empfangen und auf dänisches Gebiet geleitet. Vor Halmstad schließlich wurden sie von Christian IV. in Begleitung zweier Reiterregimenter mit Fanfaren, Salutschüssen und Feuerwerk feierlich begrüßt und in die Stadt geführt, wo Christian seinen königlichen Gast mehrere Tage lang unter Musik und Tanz bewirtete. Ein solches Festprogramm wäre an der Grenze logistisch gar nicht umzusetzen gewesen. Im Zuge der Festlichkeiten umarmten sich die Monarchen wiederholt und demonstrativ, und die Mitglieder ihres Gefolges versicherten sich gegenseitig ihrer Freundschaft. Dieses Bild vom Frieden und von der Eintracht zwischen den Monarchen wurde unmittelbar nach dem Treffen von einer schwedischen Druckschrift aufgegriffen und verbreitet. Sie sollte die Stimmung innerhalb der schwedischen Bevölkerung verbessern, die nach wie vor in Furcht vor einem neuen Krieg lebte und von der hohen Steuerlast zur Einlösung Älvsborgs von den Dänen verbittert war[77]. Über die Freundschaftsdemonstrationen hinaus fanden in Halmstad jedoch allenfalls informelle Verhandlungen statt, die ebenso wenig zu einer weiteren dänisch-schwedischen Annäherung führten wie die Gespräche zwischen den Reichsräten auf dem Grenztreffen zuvor[78].
98
Von den ersten Grenztreffen nach dem Stettiner Frieden von 1570 hatten sich die Monarchen noch ferngehalten, auch wenn sie über Boten in ständiger Verbindung mit den Quartieren ihrer Grenzkommissare standen. Beim Grenztreffen von Sjöaryd 1575 ließen die dänischen Kommissare das Verhandlungsergebnis noch vor dem Abschiedsentwurf an König Frederik II. weiterleiten und von diesem gutheißen, so dass das Treffen nach wenigen Tagen zu einem erfolgreichen Abschluss gelangte[79].
Unter Christian IV. und Gustav Adolf häuften sich dann die königlichen Versuche, direkten Einfluss auf die Grenztreffen zu gewinnen. Christian erschien in den Jahren von 1601 bis 1603 dreimal im Quartier seiner Räte in Vallda (1601, 1603) und Knäred (1602), um neue Instruktionen zu erteilen. Gustav Adolf tat dasselbe 1612 und 1624 bei seinen Aufenthalten im schwedischen Lager Ulvsbäck[80].
Auf eine persönliche Teilnahme an den Verhandlungen oder gar auf deren Leitung zielte offenbar nur der demonstrative Auftritt Christians in Sjöaryd 1601 ab. Hier sollte Ende September ein Schiedsgericht aus je sechs dänischen und schwedischen Reichsräten zusammentreten, um gemäß den Bestimmungen des Friedensvertrags von Stettin über die Streitfragen zu befinden, über die sich die beiden Seiten beim letzten Flabäck-Treffen im Februar zuvor nicht einig geworden waren[81].Dem schwedischen Regenten Herzog Karl standen jedoch gar nicht genügend Reichsräte zur Besetzung eines Schiedsgerichts zur Verfügung, und da er sich im Sommer 1601 zu einem Feldzug in Livland aufhielt, wandte er sich an König Christian mit der Bitte, das Schiedstreffen zu verschieben. Dieser ließ sich davon jedoch nicht beirren und zog zwei Tage vor dem festgesetzten Termin am 30. September mit großem Gefolge am dänischen Quartierort Knäred vorbei bis direkt an die Grenzbrücke in Sjöaryd, wo er seine Zelte aufschlagen ließ und die schwedischen Delegierten erwartete. Nachdem er sich drei Tage lang am Verhandlungsplatz gezeigt hatte, ohne dass die Schweden eintrafen, kehrte er nach Laholm zurück. Seine Grenzkommissare blieben noch einige Tage länger in Knäred zurück und reisten erst ab, nachdem sie sich ein Zeugnis über ihre verabredungsgemäße Anwesenheit am Verhandlungsplatz und über das schwedische Ausbleiben ausgestellt hatten[82].
99
Christian nahm das schwedische Versäumnis zum Anlass, im Oktober 1601 ein gedrucktes Mandat an die schwedischen Stände verteilen zu lassen. Darin beklagte er, dass seine Räte vergeblich und ohne schwedische Nachricht an der Grenze gewartet hätten, verurteilte die schwedische Handlungsweise als Verstoß gegen den Stettiner Frieden und als Herabsetzung seiner eigenen Person und forderte ultimativ neue Verhandlungen an seinem Hof oder an der Grenze. Dass Christian die Episode tatsächlich als Prestigeverlust empfand, darauf deutet der Umstand, dass Christians Mandat seine persönliche Gegenwart an der Grenze mit keinem Wort erwähnt[83]!
Seit diesem geplatzten Treffen beschränkte sich die königliche Teilnahme an den Grenztreffen der Räte auf einige merkwürdige Inkognito-Auftritte. Christian nahm auf diese Weise jeweils für einen Tag 1602 am Grenztreffen sowie 1613 als Zuschauer an den Friedensverhandlungen in Sjöaryd teil, wurde jedoch bei letzterer Gelegenheit von den schwedischen Delegierten und den englischen Vermittlern erkannt[84]. Gustav Adolf wohnte unerkannt einen Tag lang den Grenzverhandlungen in Sjöaryd 1624 bei, nachdem er sich vorher über eventuelle dänische Truppenansammlungen in der Nähe erkundigt hatte (siehe unten Abschnitt 105) – offenbar fürchtete der König also um seine Sicherheit an der Grenze[85]! Als (von der Gegenseite) unerkannte Zuschauer übten die Könige zweifellos einen Einfluss auf das Verhandlungsverhalten ihrer Räte aus, vermieden jedoch gleichzeitig das Risiko, persönlich brüskiert zu werden und einen Prestigeverlust zu erleiden wie Christian im Jahre 1601. Außerdem ließen sie so die traditionelle Verhandlungskompetenz ihrer Räte auf den Grenztreffen unangetastet[86]. Eine offene Überwachung der Verhandlungen durch die Könige hätte Misstrauen zwischen den Reichsräten und ihren Monarchen demonstriert und wäre deshalb ebenfalls schädlich für die Reputation der Beteiligten gewesen.
100
Von vornherein als königliches Zusammentreffen geplant war dagegen das grenznahe Treffen in Ulvsbäck 1629. Diesmal hatte Christian um ein Königstreffen gebeten, das für den 20. Februar 1629 offenbar nur ungefähr für das Grenzgebiet zwischen Knäred und Ulvsbäck verabredet worden war. Nachdem Christian in Begleitung zweier Söhne, dreier Reichsräte und vierzehn weiterer Adliger in seinem Gefolge auf dem Hof Yxenhult (Kirchspiel Fagerhult) noch auf dänischem Gebiet eingetroffen war, erschienen dort zwei schwedische Reichsräte und sprachen eine förmliche Einladung an den schwedischen Quartierort Ulvsbäck aus, die Christian annahm[87]. Am nächsten Tag erfolgte der Grenzübertritt der dänischen Reisegesellschaft, die an der Grenze von den beiden schwedischen Räten empfangen und kurz dahinter von König Gustav Adolf selbst mit militärischen Ehren in Gestalt einer Reiterabteilung und 400 Soldaten aufgenommen wurde. Nach einer ersten Begrüßung der beiden Könige, bei der Gustav Adolf seinem Gast für die Annahme der schwedischen Gastfreundschaft dankte, setzten die beiden Könige und ihr Gefolge ihre Reise nach Ulvsbäck fort, wo nach einem abendlichen Gastmahl die politischen Gespräche begannen[88].
Als die Dänen drei Tage später wieder abreisten, war der Grenzübertritt das einzige dänische Zugeständnis geblieben. Obwohl Christian das Treffen selbst angeregt hatte, wies er alle Bündnisvorschläge Gustav Adolfs zurück und sprach diesem implizit die Berechtigung ab, in Deutschland in den Dreißigjährigen Krieg einzutreten! Auf direkte Nachfrage der Schweden nach dem Zweck, den die Dänen mit dem Königstreffen verfolgten, antworteten die dänischen Räte wahrheitsgemäß, dass es ihnen in erster Linie darum gehe, die Einigkeit und Freundschaft zwischen beiden Monarchen vor aller Welt zu demonstrieren[89]. Erst nach Abschluss des Treffens ging Gustav Adolf auf, was es damit auf sich hatte: Christian hatte das bloße Stattfinden der Zusammenkunft benutzt, um sich ein günstiges Klima für die seit Januar 1629 geführten Friedensverhandlungen mit den kaiserlichen Feldherren Tilly und Wallenstein in Lübeck zu verschaffen. Da die dänischen Diplomaten in den folgenden Wochen alles dafür taten, die Nachricht vom Königstreffen und von seinem vermeintlich harmonischen Verlauf in Lübeck und an den Höfen Europas zu verbreiten, blieb der Erfolg nicht aus[90]: Beunruhigt von der Aussicht einer schwedischen Unterstützung für Dänemark – sei es bei den Friedensverhandlungen oder für die Fortsetzung des Krieges – gewährte Wallenstein den Dänen in Lübeck den raschen Abschluss eines Friedensvertrags zu glimpflichen Bedingungen[91]. Das Königstreffen von Ulvsbäck hatte nur die Kulisse für diesen Friedensschluss abgegeben. Waren die dänisch-schwedischen Grenztreffen bis dahin in den bilateralen Beziehungen zwischen beiden Mächten motiviert gewesen, so lag das Motiv für das Königstreffen von 1629 außerhalb Skandinaviens.
101
6. Prestige und Präzedenzprobleme
Schon die räumliche Verlagerung der Verhandlungen auf die Grenzlinie hatte Anzeichen dafür abgegeben, dass Prestigedenken und Präzedenzstreben im dänisch-schwedischen Verhältnis eine immer größere Bedeutung gewannen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts mehren sich diese Indizien. Nun kam es auch bei den Verhandlungen selbst zu Konflikten um die zeremonielle Präzedenz.
Zum ersten Mal begegnen solche Auseinandersetzungen bei den Friedensverhandlungen zur Beendigung des Kalmar-Kriegs, die von November 1612 bis zum Friedensschluss im Januar 1613 in Sjöaryd stattfanden. Gleich beim ersten Zusammentreffen der Gesandten am 29. November gelang es dem schwedischen Reichskanzler, die Dänen zu düpieren, indem er noch vor dem Austausch der Vollmachten als Erster das Wort ergriff. Da die erste Rede als Vorrecht der Vertreter des vornehmeren Staates galt, erschien dem dänischen Verhandler Eske Brock das Vorpreschen Oxenstiernas als eine Anmaßung, die nicht hätte passieren dürfen, wie er seinem Tagebuch anvertraute[92].
Nach rund drei Wochen griffen die beiden englischen Vermittler in die Verhandlungen ein. Da sie sich nicht als neutrale Dritte, sondern als Fürsprecher jeweils einer der beiden Seiten verstanden, ließen sie sich nur allzu leicht für die fortwährenden Präzedenzkonflikte der Parteien vereinnahmen: Als sich die Delegierten am 19. Dezember erstmals im Beisein der Vermittler an der Grenze trafen, forderte der für die Dänen zuständige Vermittler Robert Anstruther seinen mit der Wahrnehmung der schwedischen Interessen betrauten Kollegen Jacob Spens zum Übertritt auf die dänische Seite des Grenzbaches auf. Das hatte König Christian IV. von ihm verlangt, um den Vorrang zu demonstrieren, den Dänemark vor Schweden bei fremden Potentaten genoss. Die Schweden ließen sich jedoch nicht darauf ein und argumentierten, der schwedische König gestehe dem dänischen niemals Priorität zu, so dass die Vermittler schließlich auf der Grenzbrücke zusammenkamen. Wie sehr die Vermittler den Präzedenzstreit ihrer Mandanten verinnerlichten, zeigte sich auf dem separaten Grenztreffen der beiden Vermittler zwei Tage später, bei dem Jacob Spens das Zelt Anstruthers erst betreten wollte, nachdem dieser schriftlich erklärt hatte, die Reihenfolge ihrer Zeltbegehungen geschehe unbeschadet der Priorität der beiden von ihnen vertretenen Könige[93]!
102
Die dänischen Reichsräte behielten Oxenstiernas Usurpation der ersten Rede zu Beginn der Verhandlungen genau in Erinnerung: Zur Eröffnung des nächsten Grenztreffens in Sjöaryd 1619 warteten die Dänen schon vor der Ankunft ihrer schwedischen Gesprächspartner an der Grenzbrücke. Als die Schweden gerade von ihren Pferden stiegen, nahmen die Dänen bereits ihren Platz auf der Brücke ein und der dänische Kanzler Christian Friis begann seinen Vortrag, ohne die schwedischen Gesandten begrüßt zu haben. Auf diese Weise kam er den Schweden zuvor, denen von ihrem König eigens aufgegeben worden war, die Verhandlungen als Erste und Vornehmste zu eröffnen. Fünf Jahre später wiederholte Christian Friis sein Vorgehen an derselben Stelle, nachdem sich die Gesandten schon um den Vorrang bei der Übergabe der Vollmachten gestritten hatten. (Sie wurden schließlich simultan übergeben)[94].
Über inhaltliche Fragen hinaus tauschten die Grenzkommissare während des Treffens von 1624 erstmals Noten über die Titulaturen aus, die sie in ihrer Korrespondenz untereinander beanspruchten. Die Schweden warfen den Dänen vor, ihnen die korrekte Anrede zu verweigern, seit die schwedischen Reichsräte einige Jahre zuvor von ihrem König zu Grafen und Freiherren erhoben worden waren. Man einigte sich am Ende darauf, dass die dänischen Reichsräte ihre schwedischen Kollegen mit denjenigen Titeln belegen sollten, wie sie 1613 im Frieden von Knäred und zuletzt in ihren Korrespondenzen 1622 gebräuchlich gewesen waren. Die Schweden sollten den Dänen dieselben Titel gewähren[95].
103
7. Militärische Begleitmaßnahmen
Noch vor dem Einsetzen der Präzedenzstreitigkeiten begann die militärische Aufladung der dänisch-schwedischen Grenztreffen. Zu dem für Februar 1601 angesetzten Treffen hatte König Christian IV. seinen Kanzler und zwei seiner Reichsräte einschließlich ihres Reiteraufgebots nach Flabäck beordert, so dass die dänische Delegation mit einer Schutztruppe von ca. 60 Reitern an der Grenze erschien. Die schwedischen Grenzkommissare wurden ebenfalls von einer Eskorte geschützt, selbst wenn sich diese nicht in Zahlen fassen lässt[96].
Auch zu den beiden Sjöaryd-Treffen im September 1601 und im April 1602 ließ Christian seine Reichsräte mit ihren aufgebotspflichtigen Reitern an die Grenze reisen. Zum Geleitschutz für die schwedische Delegation waren im April 1602 200 Reiter und 300 weitere Soldaten aufgeboten, doch wurde diese Zahl in der Praxis wohl nicht erreicht. Dass die Begleitung der Grenzkommissare durch Reiter und Soldaten eher repräsentativen Zwecken diente als der militärischen Drohung, das belegt die Anweisung Herzog Karls an den schwedischen Grenzadel, sich ebenfalls zum Treffen an die Grenze zu begeben, und zwar möglichst reich ausstaffiert mit Pferden, prächtiger Kleidung und Goldschmuck[97]!
Der repräsentative Charakter der militärischen Begleitmaßmahmen änderte sich mit dem Grenztreffen von Flabäck 1603, für das Christian IV. erstmals begrenzte Kriegsrüstungen in den östlichen Landesteilen seines Reiches befahl. Unter Berufung auf das geplante Treffen ließ er Adel und Bauern zur Musterung bestellen sowie Proviantlieferungen und Truppenverstärkungen in die Festungen Halmstad und Varberg bringen. Zwar gab es weder einen dänischen Überfallsplan, noch musste Christian während des Treffens mit dem Bruch des Friedens durch die Schweden rechnen. Auf schwedischer Seite beschränkten sich die Vorbereitungen auf die Zusammenziehung und repräsentative Ausstattung einer Reitereskorte von höchstens 200 Mann[98]. Für die Eröffnung eines Krieges hätten auch die dänischen Rüstungsmaßnahmen nicht ausgereicht – trotzdem gingen sie über das bei früheren Grenztreffen übliche Maß hinaus. Dass Christian damit Druck auf die schwedischen Verhandler ausüben wollte, ist kaum anzunehmen. Stattdessen glaubt der schwedische Historiker Sven Ulric Palme, Christian hätte mit den Maßnahmen die Absicht verfolgt, seine eigenen Räte unter Druck zu setzen, damit sie im bevorstehenden Schiedsverfahren hart blieben und ein Urteil im Sinne Christians fällten[99].
104
Das wochenlange Treffen in Sjöaryd 1624 schließlich wurde auf beiden Seiten von offenen Kriegsvorbereitungen begleitet, nachdem Dänen und Schweden einander schon bei der Verabredung im April jederzeit einen Bruch des Friedens zugetraut hatten. Bis zur Eröffnung des Treffens veränderten sich die Rahmenbedingungen entscheidend zu dänischen Ungunsten: Während die dänischen Rüstungsmaßnahmen und Anwerbungen im Vertrauen auf das fortgesetzte schwedische Engagement im Krieg gegen Polen eingestellt wurden, erlangten die Schweden kurz vor Beginn des Grenztreffens einen Waffenstillstand mit Polen, der ihnen militärisch freie Hand gegen Dänemark gab[100]. Von Anfang an konnten die schwedischen Verhandler daher auf dem Grenztreffen eine kompromisslose Verhandlungslinie verfolgen. König Gustav Adolf gab im Verlauf des Treffens zweimal neue, schärfere Instruktionen, in denen er seinen Grenzkommissaren auferlegte, sich in den strittigen Zoll- und Handelsfragen entweder gegen die Dänen durchzusetzen oder ihnen den Frieden aufzusagen[101].
Als die harte schwedische Linie den dänischen Räten bewusst wurde, empfahlen sie ihrem König hastig neue Rüstungsmaßnahmen in den grenznahen Festungen und zur Mobilisierung der Kriegsflotte. Der Zustand der dänischen Festungen und Flottenarsenale war jedoch desolat. Aus Einsicht in ihre augenblickliche militärische Unterlegenheit zogen die dänischen Räte die Verhandlungen über Wochen in die Länge, um ihrem König mehr Zeit für die Aufrüstung zu geben[102]. Die Schweden durchschauten jedoch die Hinhaltetaktik: Während ihre Grenzkommissare den Druck auf die Dänen aufrechterhielten, um zu einem raschen Abschluss zu gelangen, ließ Gustav Adolf den Aufmarsch seiner Truppen in den Grenzregionen beginnen. Dabei fielen auch die letzten Rücksichten auf die Institution der Grenztreffen ebenso wie auf die eigene Reputation: Zwar hatten die schwedischen Räte ihrem König zunächst noch dazu geraten, die Truppen hinter der Grenze zurückzuhalten, um den Anschein zu vermeiden, den Dänen sollten ihre Zugeständnisse abgepresst werden. Gustav Adolf verlor jedoch die Geduld und kündigte seinen Räten schließlich einen raschen Truppenanmarsch bis an die Grenze an, um den Dänen einen Schrecken einzujagen[103]! Unter dem Druck eines schwedischen Ultimatums sahen sich die dänischen Räte zum Nachgeben gezwungen und gaben schließlich eine Verhandlungsposition nach der anderen auf[104].
Für ihre kurzfristigen Zweckbündnisse während des Dreißigjährigen Krieges griffen die beiden Mächte schon nicht mehr auf das Instrument der Grenztreffen zurück: Sie wurden 1628 in den Hauptstädten Stockholm und Kopenhagen ausgehandelt und nehmen bereits den künftigen Verhandlungsstil im 18. Jahrhundert vorweg, als Bündnisse von Gesandtschaften des einen Königs am Hofe des andern ausgehandelt wurden[105].
105
Ein letztes Mal standen sich dänische und schwedische Vertreter zur Beendigung des Torstensson-Krieges (1643–1645) an der Grenze gegenüber. Die Friedensgespräche wurden von Februar bis August 1645 in Brömsebro abgehalten. Ebenso wie bei ihren vorangegangenen Kriegen, beim Nordischen Siebenjährigen Krieg (1563–1570) und beim Kalmar-Krieg (1611–1613), waren die Parteien wiederum nur durch fremde Vermittler zu Verhandlungen zu bewegen. Für dieses Mal waren es vier niederländische und ein französischer Vermittler, die sich zu beiden Seiten der Grenze auf die Quartiere der dänischen und schwedischen Delegierten in Kristianopel (Dänemark) und Söderåkra (Schweden) verteilten[106].
Vom Februar bis in den Juli 1645 verkehrten die beiden Kriegsparteien ausschließlich über die Vermittler miteinander, die, nachdem sie zunächst nur Schriftsätze von einer Partei zur anderen getragen hatten, bald dazu übergingen, die Verhandlungspositionen der einen Seite mündlich an die andere zu referieren, was den Vermittlern mehr Spielraum verschaffte. Der im April vollzogene Übergang der Generalstaaten vom neutralen Vermittler zum Kontrahenten der Dänen in eigener Sache fand seinen räumlichen Ausdruck am Verhandlungsplatz durch den Umzug der bis dahin in Kristianopel einquartierten drei niederländischen Gesandten ins schwedische Quartier nach Söderåkra. Zwei von ihnen kehrten in den folgenden Wochen allerdings immer wieder für mehrere Tage nach Kristianopel zurück, um mit den Dänen über eine Herabsetzung des Öresund-Zolls zu verhandeln, unter dem der niederländische Ostseehandel litt[107].
Erst in der letzten Verhandlungsphase ab Juli 1645 trafen Dänen und Schweden auf Betreiben des verbliebenen französischen Vermittlers Gaspard de la Thuillerie persönlich zusammen und brachten den Friedensvertrag mit zehn Tagungen an der Grenze bis zur Unterschriftsreife. Am 13. August 1645 wurden in Brömsebro zwei Vertragswerke unterzeichnet, besiegelt und vom Vermittler de la Thuillerie unter den Delegationen ausgetauscht: Zum Einen die dänisch-schwedischen Friedensverträge, zum Anderen der dänisch-niederländische Handels- und Zollvertrag. Selbst wenn letzterer auf Kristianopel datiert ist, wo er tatsächlich ausgehandelt worden war, bestanden die niederländischen Delegierten doch auf seiner Unterzeichnung an der Grenze in Brömsebro[108].
106
Nach dem Frieden von Brömsebro 1645 war die Ära der Grenztreffen endgültig vorüber. Die dänisch-schwedischen Kriege der Jahre 1657 bis 1660 schufen für Dänemark eine ganz neue Art der »Grenzerfahrung«, als der schwedische König Karl X. Gustav mit seinen Truppen erstmals vor der dänischen Hauptstadt Kopenhagen erschien und diese fast im Sturm erobert hätte, wären die Verteidiger nicht zuvor durch eine niederländische Flotte verstärkt worden[109]. In zwei Friedensverträgen, abgeschlossen in Roskilde (1658) und direkt vor den Wällen Kopenhagens (1660), verlor Dänemark die Landschaften östlich des Öresunds, in denen sich die Grenztreffen traditionell abgespielt hatten, und besaß fortan keine Landgrenze zu Schweden mehr[110]. Die verlorenen Kriege setzten in Dänemark eine Entwicklung in Gang, die noch 1660 zur staatsstreichartigen Entmachtung des hochadligen Reichsrats und zu dessen Ersatz durch einen königstreuen Geheimen Rat führte. Der schwedische Reichsrat wurde 1680 unter dem Druck einer staatlichen Finanzkrise zum königlichen Rat umgebildet[111]. Damit entfielen auf beiden Seiten sowohl die topographischen als auch die konstitutionellen Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Grenztreffen nach dem Muster der Verträge von Stockholm (1534), Brömsebro (1541) und Stettin (1570). Auch die beiden Könige trafen künftig nicht mehr persönlich zu Verhandlungen zusammen.
Die Funktion der Grenztreffen ging nach und nach auf die ständigen diplomatischen Repräsentanten über, die Dänemark und Schweden seit 1621 untereinander ebenso wie mit anderen europäischen Mächten austauschten. Zunächst handelte es sich um einfache Residenten, die sich vor allem um Handelsangelegenheiten kümmerten, Nachrichten sammelten und noch keine politischen Verhandlungen zu führen hatten. Erst seit 1648 unterhielten beide Seiten ständige Vertreter im Gesandtenrang am Hof der jeweils anderen[112].
107
Die vorliegende Untersuchung hat aufgezeigt, wie sich die Institution der skandinavischen Grenztreffen seit dem Ende der Unionszeit allmählich verändert hat und dabei immer stärker von der Rivalität zwischen Dänemark und Schweden geprägt worden ist. Die dabei aufkommenden Präzedenzkonflikte betrafen zuerst die räumliche Dimension der Verhandlungsplätze. Konnten die Reichsräte in den ersten Jahrzehnten nach 1520 zunächst noch an denselben grenznahen Treffpunkten miteinander verhandeln wie zuvor, so waren ihre Monarchen 1524 nur unter großen Schwierigkeiten zu ihrem Treffen in Malmö zu bewegen und vermochten 1541 nicht mehr an den üblichen Treffpunkten Varberg oder Kalmar, sondern nur noch auf der Grenze in Brömsebro zusammenzukommen. Nach dem Nordischen Siebenjährigen Krieg wurden die Bestimmungen des Friedenvertrags von Stettin über die Grenztreffen der Reichsräte fast ausschließlich so ausgelegt, dass die Treffpunkte nunmehr auf der Grenzlinie selbst zu liegen hatten. Seit etwa 1600 verschärfte sich das Verhandlungsklima auf den Grenztreffen selbst: Ab 1601 wurden die Delegationen von Soldaten begleitet, und die Könige erschienen in den Quartieren der Delegierten oder auch am Verhandlungsplatz selbst, um offen oder verdeckt Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen. Das Grenztreffen von 1624 schließlich fand unter mehr oder weniger expliziten Kriegsdrohungen statt.
Die Zuspitzung und das Ende der Grenztreffen zeugen vom allgemeinen Umbruch, der das dänisch-schwedische Verhältnis im 16. und 17. Jahrhundert erfasste. Ebenso wie Ingrid Voss die ostfränkisch-westfränkischen Herrschertreffen des 10. Jahrhunderts noch als Ausdruck einer »Spätphase der fränkischen Geschichte« werten wollte[113], lassen sich die dänisch-schwedischen Grenztreffen von 1520 bis etwa 1600 einer »Spätphase der Unionsbeziehung« zurechnen, in der sich partnerschaftliche und rivalisierende Züge zwischen den skandinavischen Nachbarreichen noch die Waage hielten. Ab etwa 1600 ging diese traditionelle Beziehung verloren und wich einem neuen Verhältnis, in dem sich die frühmodernen Staaten Dänemark und Schweden ab 1650 nur noch als Rivalen gegenüberstanden.
108
Verhandlungen an und nahe der Grenze zwischen Dänemark und Schweden von 1520 bis 1645: Angeführt werden die Treffpunkte einschließlich der ermittelten Daten für Beginn und Abschluss der Verhandlungen, die gegebenenfalls errichteteten Abschiede und abgeschlossenen Verträge sowie die wichtigste Literatur dazu. * steht für verabredete, aber nicht zustandegekommene Verhandlungen.
Malmö 1524 VIII 24 – IX 4: Rezess von Malmö 1524 IX 1, in Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 3 A–D, S. 16–25, Hanserecesse III:8, Nr. 811, S. 754–764, Nr. 812, S. 809–825, vgl. Laursen, ebd., S. 14f., Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 195–197, Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 8–10.
Lödöse 1528 VIII 14 – 21: Rezess von Lödöse 1528 VIII 21, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 16, S. 76–78, vgl. Laursen, ebd., S. 75f., Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 11f.
Varberg 1530 VII 29 – VIII 8: Rezess von Varberg 1530 VIII 8, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 20, S. 89–92, vgl. Laursen, ebd., S. 88f., Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 198, Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 13.
Kopenhagen 1536 XI – XII 3: DNT I, Nr. 45–46, S. 247–250, vgl. Laursen, ebd., S. 173f., Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 21.
Halmstad 1537 IX 10: DNT I, Nr. 50, S. 274–276, vgl. Laursen, ebd., S. 274.
*Malmö/Landskrona/Varberg 1538 Pfingsten: (verabredet Halmstad 1537 IX 10), vgl. Laursen in DNT I, S. 274.
*Nya Lödöse 1540 III: vgl. Laursen in DNT I, S. 309.
Kalmar 1540 X 7 – XI 1: DNT I, Nr. 55 B–D, S. 312–327, vgl. Laursen, ebd., S. 310f., Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 23.
Nya Lödöse 1541 III 6: vgl. Laursen in DNT I, S. 311, 342.
*Kalmar 1541 V 29: vgl. Laursen in DNT I, S. 342f.
Brömsebro (südlich von Kalmar) 1541 V 30, VI 23, VII 20: vgl. Laursen in DNT I, S. 343–344, Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 23f.
Åhus 1541 VIII 15: vgl. Laursen in DNT I, S. 344.
Ronneby 1541 IX ca. 15–21: DNT I, Nr. 57 B, S. 385–400, vgl. Laursen, ebd., S. 345–347.
Brömsebro (südlich von Kalmar) 1541 IX ca. 23: Bündnis von Brömsebro 1541 IX 14 oder 15, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 57 A, C, S. 348–384, 401–404, vgl. Laursen, ebd., S. 347, Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 24.
*Varberg 1547 VI 24: vgl. Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 173–176.
*Halmstad 1553 VII 29: vgl. Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 205.
Älvsborg (heute im Stadtgebiet von Göteborg) 1554 V: ST IV, Nr. 45, S. 304f., vgl. Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 220–224.
Kopenhagen 1562 I – II: vgl. Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 299f.
Kopenhagen 1562 VIII – XI: vgl. Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 304–306.
*Falkenberg 1567 I 25: vgl. Laursen in DNT II, S. 168.
Roskilde 1568 X 23 – XI 18: Friedensvertrag von Roskilde 1568 XI 18, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT II, Nr. 10, S. 176–185, vgl. Laursen, ebd., S. 170f., Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 207f., Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 256–266.
Trälshult (östlich von Laholm, zwischen Knäred, Markaryd) 1569 VII 29 – VIII Ende: vgl. Laursen in DNT II, S. 175f.
Avaskär (südlich von Kalmar, Vorgängersiedlung von Kristianopel) 1572 V 15 – 27: DNT II, Nr. 17, S. 298–300, vgl. Laursen, ebd., S. 298, Westling, Sveriges förhållande till Danmark 1919, S. 68f.
Sjöaryd (östlich von Laholm, zwischen Knäred, Markaryd) 1575 V 24 – VI 1: Abschied von Ulfsbäck 1575 VI 1, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT II, Nr. 22 A–B, S. 354–359, vgl. Laursen, ebd., S. 352–354, Westling, Sveriges förhållande till Danmark 1919, S. 98f.
Sjöaryd (östlich von Laholm, zwischen Knäred, Markaryd) 1580 X 1 – 12: Abschied von Ulfsbäck 1580 X 12, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT II, Nr. 28 A–B, S. 505–512, vgl. Laursen, ebd., S. 502–505, Westling, Sveriges förhållande till Danmark 1919, S. 144–146.
Flabäck (zwischen Kungsbacka, Göteborg) 1591 VIII 12–17: Abschied von Flabäck 1591 VIII 17, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT III, Nr. 4 A–B, S. 60–67, vgl. Laursen, ebd., S. 57–59, Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 86f.
Flabäck (zwischen Kungsbacka, Göteborg) 1601 II 9–18: DNT III, Nr. 8 A–B, S. 107–122, vgl. Laursen, ebd., S. 104–107, Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 222–249.
*Sjöaryd (östlich von Laholm, zwischen Knäred, Markaryd) 1601 IX 30: (verabredet Flabäck 1601 II 18) vgl. Laursen in DNT III, S. 176f., Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 266f.
Sjöaryd (östlich von Laholm, zwischen Knäred, Markaryd) 1602 IV 2–7: vgl. Laursen in DNT III, S. 177f., Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 322–331.
Flabäck (zwischen Kungsbacka, Göteborg) 1603 II 10 – IV 6: DNT III, Nr. 12 A–B, S. 188–197, vgl. Laursen, ebd., S. 181–186, Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 405–463.
Sjöaryd (östlich von Laholm, zwischen Knäred, Markaryd) 1612 XI 29 – 1613 I 21: Friedensvertrag von Knäred 1613 I 20, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT III, Nr. 17 A, S. 303–311, vgl. Laursen, ebd., S. 293–302, Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 228–231, Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 197–218.
Sjöaryd (östlich von Laholm, zwischen Knäred, Markaryd) 1619 II 7 – 12: DNT III, Nr. 20, S. 349f., vgl. Laursen, S. 346–348, Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I S. 322–336.
Halmstad 1619 II 25 – III 2: vgl. Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I S. 339f.
Sjöaryd (östlich von Laholm, zwischen Knäred, Markaryd) 1624 V 21 – VI 29: DNT III, Nr. 34, S. 576–585, vgl. Laursen, ebd., S. 568–576, Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. II S. 286–339.
Ulfsbäck (nördlich von Markaryd) 1629 II 23–26: vgl. Jespersen, Rivalry 1994, S. 151–156, Jespersen, Kongemødet 1982, passim, Schäfer, Zusammenkunft 1901, passim.
Brömsebro (südlich von Kalmar) 1645 II 8 – VIII 13: Friedensvertrag von Brömsebro 1645 VIII 13, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT IV, Nr. 24 C–D, S. 437–475, vgl. Laursen, ebd., S. 423–432, Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 245–248.
109
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
Aktstykker og Oplysninger siehe Erslev.
Albrectsen, Esben: 700–1523, in: Ders./Karl-Erik Frandsen/Gunner Lind (Hg.): Konger og krige 700–1648, København 2001 (Dansk udenrigspolitiks historie 1), S. 10–215.
Andersson, Lars: Sjuttiosex medeltidsstäder – aspekter på stadsarkeologi och medeltida urbaniseringsprocess i Sverige och Finland, Stockholm 1990 (Rapport Medeltidsstaden 73).
Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, 2. Auflage, Reinbek 2007 (Rowohlts Enzyklopädie 55675).
Bjerg, Hans Christian/Frantzen, Ole L.: Danmark i krig, København 2005.
Brandt, Peter: Von der Adelsmonarchie zur königlichen »Eingewalt«. Der Umbau der Ständegesellschaft in der Vorbereitungs- und Frühphase des dänischen Absolutismus, in: HZ 250 (1990), S. 33–72.
Bregnsbo, Michael: Denmark and the Westphalian Peace, in: Heinz Duchhardt (Hg.): Der Westfälische Friede. Diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, München 1998 (HZ Beihefte, NF 26), S. 361–367.
Broberg, Birgitta: Varberg, Stockholm 1982 (Rapport Medeltidsstaden 31).
Busch, Michael: Krieg – Krise – Absolutismus. Die Entstehung königlicher Alleinherrschaft in Dänemark und Schweden. Ein Vergleich, in: Bernd Wegner (Hg.): Wie Kriege enden. Wege zum Frieden von der Antike bis zur Gegenwart, Paderborn 2002, S. 93–120.
Büttner, Bengt: Schiedsspruch oder Krieg. Die Entwicklung der dänisch-schwedischen Schiedsgerichtsbarkeit von ihren Anfängen bis ins 17. Jahrhundert, in: Institut für Europäische Geschichte (Hg.): Publikationsportal Europäische Friedensverträge, Mainz 2009, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009).
DNT siehe Laursen.
Duchhardt, Heinz/Peters, Martin (Hg.): Europäische Friedensverträge der Vormoderne – online, Mainz (ohne Jahr), http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009).
Ekre, Rune: Lödöse. Eine westschwedische Handelsstadt und ihre Handelsverbindungen, in: Jörgen Bracker (Hg.): Die Hanse – Lebenswirklichkeit und Mythos. Ausstellungskatalog, Bd. 1, Hamburg 1989, S. 543–548.
Ericson Wolke, Lars: 1658 – Tåget över Bält, Lund 2008.
Erslev, Kristian (Hg.): Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV.’s Tid, Bd. I–III, København 1883–1890.
Frandsen, Karl-Erik: 1523–1588, in: Esben Albrectsen/Ders./Gunner Lind (Hg.): Konger og krige 700–1648, København 2001 (Dansk udenrigspolitiks historie 1), S. 216–339.
Füssel, Marian/Rüther, Stefanie: Einleitung, in: Christoph Dartmann/Dies. (Hg.): Raum und Konflikt. Zur symbolischen Konstituierung gesellschaftlicher Ordnung in Mittelalter und Früher Neuzeit, Münster 2004 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 5), Münster 2004, S. 9–18.
Hanserecesse siehe von der Ropp, Schäfer/Techen.
Jahnke, Carsten: Das Silber des Meeres. Fang und Vertrieb von Ostseehering zwischen Norwegen und Italien (12.–16. Jahrhundert), Köln 2000 (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, NF 49).
Jensen, Frede P.: Danmarks konflikt med Sverige 1563–1570, København 1982 (Skrifter udgivet af det Historiske Institut ved Københavns Universitet 12).
Jespersen, Knud J.V.: Kongemødet i Ulfsbäck præstegård februar 1629 – en dansk diplomatisk triumf på tragisk baggrund, in: Historie XIV:3 (1982), S. 420–439.
Ders.: Rivalry Without Victory. Denmark, Sweden and the Struggle for the Baltic, 1500–1720, in: Göran Rystad/Klaus-Richard Böhme/Wilhelm M. Carlgren (Hg.): In Quest of Trade and Security. The Baltic in Power Politics 1500–1990, Bd. I, Lund 1994, S. 137–176.
Johannesson, Gösta: Skåne, Halland og Blekinge, København 1981 (Politikens Danmarks Historie).
Jørgensen, Harald/Klose, Olaf: Art. »Kopenhagen«, in: Olaf Klose (Hg.): Handbuch der historischen Stätten. Dänemark, Stuttgart 1982 (Kröners Taschenausgabe 327), S. 102–124.
Landberg, Georg: De nordiska rikena under Brömsebroförbundet, Uppsala 1925.
Ders.: Johan Gyllenstiernas nordiska förbundspolitik i belysning av den skandinaviska diplomatiens traditioner, Uppsala 1935 (Uppsala universitets årsskrift 1935, 10).
Larsson, Lars-Olof: Det medeltida Värend. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt, Lund 1964 (Bibliotheca historica Lundensis 12).
Laursen, Laurs R. (Hg.): Danmark-Norges Traktater 1523–1750 med dertil hørende Aktstyker, Bd. I–V (1523–1664), København 1907–1920.
Lind, Gunner: 1588–1648, in: Esben Albrectsen/Karl-Erik Frandsen/Ders. (Hg.): Konger og krige 700–1648, København 2001 (Dansk udenrigspolitiks historie 1), S. 340–469.
Lundahl, Ivar: Det medeltida Västergötland, Lund 1961 (Nomina Germanica 12).
Lundkvist, Sven: Die schwedischen Kriegs- und Friedensziele 1632–1648, in: Konrad Repgen (Hg.): Krieg und Politik 1618–1648. Europäische Probleme und Perspektiven, München 1988 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 8), S. 219–240.
Magnusson, Eva (Red.): När sundet blev gräns. Till minne av Roskildefreden 1658, Stockholm 2008 (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2008).
Marchal, Guy: Grenzerfahrung und Raumvorstellungen, in: Ders. (Hg.): Grenzen und Raumvorstellungen (11.–20. Jahrhundert), Zürich 1996 (Clio Lucernensis 3), S. 11–25.
Nielsen, Herluf, u.a.: Art. »Rigsråd«, in: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 14 (1969), Sp. 220–234.
Ders./Liedgren, Jan: Art. »Rigsgrænse: Danmark, Sverige«, in: Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 14 (1969), Sp. 198–207.
North, Michael: Europa expandiert 1250–1500, Stuttgart 2007 (Handbuch der Geschichte Europas 4).
Olesen, Jens E.: Unionskrige og Stændersamfund. Bidrag til Nordens historie i Kristian I.’s regeringstid 1450–1481, Aarhus 1983 (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie 40).
Olsson, Gunnar: Sverige och landet vid Göta älvs mynning unter medeltiden, Göteborg 1953 (Göteborgs Högskolas årskrift 59:3).
Palme, Sven Ulric: Sverige och Danmark 1596–1611, Uppsala 1942.
Rahn, Thomas: Grenz-Situationen des Zeremoniells in der Frühen Neuzeit, in: Markus Bauer/Ders. (Hg.): Die Grenze. Begriff und Inszenierung, Berlin 1997, S. 177–206.
Riis, Thomas: Skandinavien im Spätmittelalter. Zwei Königreiche und eine halbe Republik, in: Rainer C. Schwinges/Christian Hesse/Peter Moraw (Hg.): Europa im späten Mittelalter. Politik – Gesellschaft – Kultur, München 2006 (HZ Beihefte 40), S. 125–143.
Ropp, Goswin Frhr. von der (Bearb.): Hanserecesse. II. Abtheilung: Hanserecesse von 1431–1476, Bd. 6 (1467–1473), Leipzig 1890.
Rydberg, O.S. (Hg.): Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar, Bd. III–VI:1:1 (1409–1648), Stockholm 1888–1915.
Schäfer, Dietrich: Die Zusammenkunft Gustav Adolph’s mit Christian IV. von Dänemark zu Ulfsbäck 1629, in: Preußische Jahrbücher 105 (1901), S. 39–62.
Ders./Techen, Friedrich (Bearb.): Hanserecesse. III. Abtheilung: Hanserecesse von 1477–1530, Bd. 8 (1522–1524), Leipzig 1910.
Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003.
Schneider, Reinhard: Mittelalterliche Verträge auf Brücken und Flüssen (und zur Problematik von Grenzgewässern), in: Archiv für Diplomatik 23 (1977), S. 1–24.
ST siehe Rydberg.
Sundberg, Ulf: Svenska freder och stillestånd 1249–1814, Hargshamn 1997.
Tandrup, Leo: Mod triumf eller tragedie. En politisk-diplomatisk studie over forløbet af den dansk-svenske magtkamp fra Kalmarkrigen til Kejserkrigen, Bd. I–II, Aarhus 1979 (Skrifter udgivet af Jysk Selskab for Historie 35).
Tham, Wilhelm: Den svenska utrikespolitikens historia I:2, 1560–1648, Stockholm 1960.
Voges, Ursula: Der Kampf um das Dominium Maris Baltici 1629 bis 1645. Schweden und Dänemark vom Frieden von Lübeck bis zum Frieden von Brömsebro, Zeulenroda 1938.
Voss, Ingrid: Herrschertreffen im frühen und hohen Mittelalter. Untersuchungen zu den Begegnungen der ostfränkischen und westfränkischen Herrscher im 9. und 10. Jahrhundert sowie der deutschen und französischen Könige vom 11. bis 13. Jahrhundert, Köln 1987 (Archiv für Kulturgeschichte, Beihefte 26).
Westling, Fredrik: Sveriges förhållande till Danmark från freden i Stettin till Fredrik II:s död (1571–1588), in: (Svensk) Historisk Tidskrift 39 (1919), S. 55–102, 123–154.
Zernack, Klaus: Handelsbeziehungen und Gesandtschaftsverkehr im Ostseeraum. Voraussetzungen und Grundzüge der Anfänge des ständigen Gesandtschaftswesens in Nord- und Osteuropa, in: Ders.: Nordosteuropa. Skizzen und Beiträge zu einer Geschichte der Ostseeländer, Lüneburg 1993, S. 81–104. Wiederabdruck aus: Aus Natur und Geschichte Mittel- und Osteuropas, Gießen 1957 (Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens 3), S. 116–138.
110
[*] Bengt Büttner, Dr., Institut für Europäische Geschichte, Mainz.
[1] Voss, Herrschertreffen 1987, S. 200.
[2] Vgl. ebd., S. 36f., 64, 84, 201f.
[3] Ebd., S. 201.
[4] Vgl. Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit 2003; Bachmann-Medick, Cultural Turns 2007; Füssel/Rüther, Einleitung, in: Dartmann, Raum und Konflikt 2004; Marchal, Grenzerfahrung und Raumvorstellungen 1996.
[5] Vgl. Füssel/Rüther, Einleitung, in: Dartmann, Raum und Konflikt 2004, S. 12; Bachmann-Medick, Cultural Turns 2007, S. 288–291.
[6] Vgl. Bachmann-Medick, Cultural Turns 2007, S. 297, 313; Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit 2003, S. 145.
[7] Vgl. Rahn, Grenz-Situationen 1997, bes. S. 179f.; Marchal, Grenzerfahrung und Raumvorstellungen 1996, S. 11–14; Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit 2003, S. 138, 144.
[8] Vgl. Rahn, Grenz-Situationen 1997, S. 178–180, 185f., 200.
[9] Vgl. North, Europa expandiert 2007, S. 277–280; Albrectsen, Konger og krige 2001, S. 173–181, 196–205.
[10] Vgl. North, Europa expandiert 2007, S. 280–282; Riis, Skandinavien 2006, S. 132f.; Nielsen, Rigsråd 1969, in: Brandt, Von der Adelsmonarchie zur königlichen Eingewalt 1990, S. 43f.
[11] Vgl. Albrectsen, Konger og krige 2001, S. 180, 197, 205–208.
[12] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 50–60.
[13] Vgl. Albrectsen, Konger og krige 2001, S. 203–205.
[14] Rezess von Lödöse 1528 VIII 21, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 16, S. 76–78. – Bündnis von Stockholm 1534 II 2, gedruckt in: DNT I, Nr. 34 A, S. 175–185. – Bündnis von Brömsebro 1541 IX 14 oder 15, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 57 A, S. 348–384, vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 243–250, 260, 267–273, 278–281; Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 1; Büttner, Schiedsspruch oder Krieg 2009, Abs. 15–20.
[15] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Dänemark, Schweden), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT II, Nr. 13 A, S. 233–260, vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 316f.; Tham, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 49–51; Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 209–211; Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 326–331.
[16] Vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 325–327, 370f. sowie Westling, Sveriges förhållande till Danmark 1919, passim.
[17] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13 (Dänemark, Schweden), in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Art. 24–25, gedruckt in: DNT II, Nr. 13 A, S. 255–257, vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 22–29; Jespersen, Rivalry 1994, S. 144–146; Büttner, Schiedsspruch oder Krieg 2009, Abs. 24–25.
[18] Vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 325–327; Lind, Konger og krige 2001, S. 370f.; Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 78–87; Westling, Sveriges förhållande till Danmark 1919, S. 68f., 98–101, 142–148; Büttner, Schiedsspruch oder Krieg 2009, Abs. 26–27.
[19] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 379–383 sowie Palme, Sverige och Danmark 1942, passim.
[20] DNT III, Nr. 8 A–B (1601), S. 107–122, Nr. 12 B (1603), S. 188–196, vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 222–251, 406–463, 519–533.
[21] Friedensvertrag von Knäred 1613 I 20, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT III, Nr. 17 A, S. 303–311, vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 384f.; Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 197–223.
[22] DNT III, Nr. 20 (1619), S. 349f., vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 396f., 402; Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 322–343.
[23] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 361, 393; Tham, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 154; Zernack, Handelsbeziehungen und Gesandtschaftsverkehr 1993, S. 98f.
[24] DNT III, Nr. 34 (1624), S. 576–585, vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 397f.; Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. II, S. 286–360.
[25] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 416–425; Jespersen, Rivalry 1994, S. 150f.
[26] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 429–432; Landberg, Gyllenstiernas nordiska förbundspolitik 1935, S. 21f.
[27] Beistandsvertrag von Stockholm 1628 I 4 (IV 28), in: DNT IV, Nr. 3, S. 24–30. – Übereinkunft zur Verteidigung der Stadt Stralsund 1628 IX 17, ebd., Nr. 4, S. 39–41, vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 419.
[28] Vgl. Tham, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 183; Jespersen, Rivalry 1994, S. 151–161; Voges, Kampf 1938, passim.
[29] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 449–452, 457–461; Tham, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 277–298.
[30] Friedensvertrag von Brömsebro 1645 VIII 13, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT IV, Nr. 24 C, S. 437–463. Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 461–463; Tham, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 329–333.
[31] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 464, 467; Bregnsbo, Denmark and the Westphalian Peace 1998; Lundkvist, Kriegs- und Friedensziele 1988.
[32] Friedensvertrag von Roskilde 1658 II 26, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT V, Nr. 13 A, S. 228–240. Zu seinen Auswirkungen vgl. die Aufsätze in Magnusson, När sundet blev gräns 2008.
[33] Bündnis von Stockholm 1534 II 2: Art. 18, gedruckt in: DNT I, Nr. 34 A, S. 181. – Bündnis von Kalmar 1540 XI 1: Art. 23, gedruckt in: DNT I, S. 368. – Bündnis von Brömsebro 1541 IX 14 oder 15, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Art. 19, gedruckt in: DNT I, Nr. 57 A, S. 368; vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 14–16; Büttner, Schiedsspruch oder Krieg 2009, Abs. 17, 20.
[34] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 16–18; Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 218–225.
[35] ST III, Nr. 491 (Halmstad 1450), S. 243–247, Bihang XV (Halmstad 1483), S. 678–686. Zur Stadtentwicklung von Halmstad vgl. Andersson, Sjuttiosex medeltidsstäder 1990, S. 38.
[36] Zur Königswahl in Halmstad ST III, ohne Nr. (1436–1438), S. 175, Nr. 491 (1450), S. 243–245. Unionstreffen in Halmstad schlägt ein schwedischer Unionsvorschlag von 1476 vor, vgl. Olesen, Unionskrige og Stændersamfund 1983, S. 381.
[37] ST III, Nr. 544 (Nya Lödöse 1494), S. 426–429, 444f. Anm. (zu Lödöse 1496), Nr. 572 (Varberg 1508), S. 538–541. Zur Stadtentwicklung von (Gamla) Lödöse und Nya Lödöse vgl. Andersson, Sjuttiosex medeltidsstäder 1990, S. 42, 44f.; Ekre, Lödöse 1989; Lundahl, Västergötland 1961, S. 42–46, 192f.; zu Varberg vgl. Andersson, Sjuttiosex medeltidsstäder 1990, S. 39f.; Broberg, Varberg 1982, bes. S. 8.
[38] Zu den Unionstreffen in Nya Lödöse siehe ST III, Bihang XV (1483), S. 685, Nr. 529 (1483), S. 383, sowie den schwedischen Unionsvorschlag 1476, vgl. Olesen, Unionskrige og Stændersamfund 1983, S. 381.
[39] Zu den Machtverhältnissen am Göta-Älv im ausgehenden Mittelalter vgl. Olsson, Göta älvs mynning 1953, S. 49f.
[40] ST II, Nr. 423 (Kalmar 1397), S. 560–567, ST III, Nr. 516 (Kalmar 1472), S. 318–324, Nr. 518 (Kalmar 1473), S. 327–329, Nr. 519 (Kalmar 1474), S. 331–334, Nr. 522a (Kalmar 1476), S. 340–342, Nr. 531 (Kalmar 1484), S. 389–394, Nr. 546 (Kalmar 1495), S. 442f. Zur Stadtentwicklung von Kalmar vgl. Andersson, Sjuttiosex medeltidsstäder 1990, S. 44.
[41] Zu den Verhandlungen in Ronneby 1451, 1453, 1454, 1476 vgl. Olesen, Unionskrige og Stændersamfund 1983, S. 23, 45, 53, 384, zu den Verhandlungen in Åhus 1476 vgl. ebd., S. 376–378. Zur Stadtentwicklung von Ronneby und Åhus vgl. Andersson, Sjuttiosex medeltidsstäder 1990, S. 32f., 37.
[42] ST III, Nr. 567 (Kopenhagen 1504), S. 494–498, Nr. 571 (Kopenhagen 1508), S. 535f., Nr. 574 (Kopenhagen 1509), S. 548–551, Nr. 582 (Kopenhagen 1513), S. 581–584, Nr. 583 (Kopenhagen 1515), S. 585–587. Zur Entwicklung von Kopenhagen vgl. Jørgensen/Klose, Kopenhagen 1982, bes. S. 104f.
[43] ST III, Nr. 580 (Malmö 1512), S. 570–573. Zur Entwicklung von Malmö vgl. Jahnke, Silber des Meeres 2000, S. 146–157.
[44] Rezess von Malmö 1524 IX 4, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT I, Nr. 3 A, S. 16–22. Zu den Verhandlungen siehe Hanserecesse III:8, Nr. 811–812, S. 754–764, 809–825. Vgl. Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 8f.
[45] Bündnis von Stockholm 1534 II 2, gedruckt in: DNT I, Nr. 34 A, S. 175–185. – Vorläufige Ratifikation Christians III. in Stockholm 1535 IX 15, gedruckt in: DNT I, Nr. 34 E, S. 194f., vgl. Albrectsen, Konger og krige 2001, S. 268f.; Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 16–19; Laursen in DNT I, S. 171–173.
[46] Hanserecesse II:6, Nr. 276 (Lübeck 1469), S. 244– 253. – ST III, Nr. 496 (Stockholm 1457), S. 263f., Nr. 513 (Stockholm 1468), S. 296–300, Nr. 515 (in/vor Stockholm 1471), S. 311–314, Nr. 522 (Stockholm 1497), S. 459, Nr. 586 (in/vor Stockholm 1518), S. 590–594.
[47] Vgl. Nielsen/Liedgren, Rigsgrænse 1969, Sp. 199–201; Olsson, Göta älvs mynning 1953, S. 6–9.
[48] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 37f.
[49] Zum ostdänischen Städtewesen allgemein vgl. Johannesson, Skåne, Halland og Blekinge 1981, S. 86–91, 188–193, zum Festungsbau ebd., S. 197–200, 204–206.
[50] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 38f.; Larsson, Värend 1964, S. 229–237.
[51] Vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 247; Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 7f.; Laursen in DNT I, S. 15.
[52] Vgl. Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 11; Laursen in DNT I, S. 75.
[53] Vgl. Landberg, Brömsebroförbundet 1925, S. 19; Laursen in DNT I, S. 173.
[54] Vgl. Laursen in DNT I, S. 342–344.
[55] Vgl. ebd., S. 344f.
[56] Darauf deutet zumindest eine von Christian III. unterzeichnete kurze Vertragsversion, datiert auf den 23. September 1541 in Brömsebro, die später keine Ratifikation erlangte: DNT I, Nr. 57 C, S. 401–404.
[57] Bündnisvertrag von Brömsebro 1541 IX 14 oder 15, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Datierung gedruckt in DNT I, Nr. 57 A, S. 384. Die Datierung ist nicht nur fiktiv, sondern außerdem fehlerhaft, denn Exaltatio crucis fällt auf den 14. Sept. und nicht auf den 15.! Vgl. Laursen in DNT I, S. 341 Anm. 1.
[58] Vgl. Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 102, 109–116; Laursen in DNT II, S. 166f.
[59] Vgl. Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 212–214; Laursen in DNT II, S. 168. Zu Falkenberg vgl. Andersson, Sjuttiosex medeltidsstäder 1990, S. 40.
[60] Vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 312f.; Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 256–262; Laursen in DNT II, S. 169–171.
[61] Friedensvertrag von Roskilde 1568 XI 18, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT II, Nr. 10, S. 176–185, vgl. Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 262–266.
[62] Friedensvertrag von Roskilde 1568 XI 18, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Art. 18, gedruckt in: DNT II, Nr. 10, S. 182. Vgl. Büttner, Schiedsspruch oder Krieg 2009, Abs. 23.
[63] Vgl. Johannesson, Skåne, Halland og Blekinge 1981, S. 198.
[64] Vgl. Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 269, 274–279.
[65] Vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 315f.; Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 313–320, 326–331; Laursen in DNT II, S. 219–231.
[66] Friedensvertrag von Stettin 1570 XII 13, in Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT II, Nr. 13 A, S. 233–260, Art. 24–25 S. 255–257, vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 316f.; Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 209–211; Büttner, Schiedsspruch oder Krieg 2009, Abs. 1, 24.
[67] Vgl. Lundahl, Västergötland 1961, S. 15.
[68] Vgl. Olesen, Unionskrige og Stændersamfund 1983, S. 23; Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 132. Zu Avaskär vgl. Andersson, Sjuttiosex medeltidsstäder 1990, S. 38.
[69] Vgl. Aktstykker og Oplysninger, Bd. I, S. 163f., 165; Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 525, 527.
[70] Vgl. Schneider, Verträge auf Brücken und Flüssen 1977, bes. S. 5, 13, 21; Voss, Herrschertreffen 1987, S. 85; Rahn, Grenz-Situationen 1997, S. 187–190.
[71] Vgl. Rahn, Grenz-Situationen 1997, S. 199.
[72] Vgl. Aktstykker og Oplysninger, Bd. I, S. 144 Anm.
[73] Hinweise auf Zelte in Trälshult 1569 (Jensen, Danmarks konflikt 1982, S. 275 Anm.), Flabäck 1601 (Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 223 Anm.), Sjöaryd 1619 (Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 332) und Sjöaryd 1624 (Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. II, S. 286).
[74] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 222, 411.
[75] Vgl. Laursen in DNT II, S. 298; Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 86f. Ursprünglich hatten die Dänen sogar in der nächstgrößeren Stadt Varberg verhandeln wollen vgl. Laursen in DNT III, S. 54f.
[76] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 326, 407; Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 329f., 331f.
[77] Vgl. Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 340f.
[78] Vgl. ebd., S. 338–340, 342f.; Laursen in DNT III, S. 344, 349.
[79] Vgl. Frandsen, Konger og krige 2001, S. 325f.; Laursen in DNT II, S. 352f.
[80] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 236f., 322f., 447–449; Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 202–204, Bd. II, S. 290; Laursen in DNT III, S. 569, 570f.
[81] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 247f.; Büttner, Schiedsspruch oder Krieg 2009, Abs. 28f. Die Vermutung, Christian habe die Schiedsverhandlungen persönlich leiten wollen, bei Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 266.
[82] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 255–257, 261–267. Es bleibt unklar, ob Christian für die drei Tage auch am Verhandlungsplatz gewohnt hat, vgl. ebd., S. 266 Anm.
[83] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 267–270.
[84] Vgl. ebd., S. 324; Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 218; Laursen in DNT III, S. 301.
[85] Vgl. Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. II, S. 286f., 290.
[86] Zu den Kompetenzen der Reichsräte auf den Grenztreffen vgl. Jespersen, Rivalry 1994, S. 144–146; Büttner, Schiedsspruch oder Krieg 2009, Abs. 25.
[87] Vgl. Schäfer, Zusammenkunft 1901, S. 42–44.; Tham, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 182f.; Jespersen, Kongemødet 1982, S. 422f.
[88] Die Chronologie des Treffens wird unterschiedlich berechnet: Während Schäfer den Aufenthalt Christians in Ulvsbäck auf den 22. bis zum 25. Februar datiert, geht Jespersen von einer Dauer vom 23. bis zum 26. Februar aus, vgl. Schäfer, Zusammenkunft 1901, S. 44, 54; Jespersen, Kongemødet 1982, S. 422f. Anm.
[89] Schäfer, Zusammenkunft 1901, S. 51, 53; Jespersen, Kongemødet 1982, S. 425f., 428f., 434.
[90] Vgl. Jespersen, Rivalry 1994, S. 159f.; Jespersen, Kongemødet 1982, S. 435f.; Tham, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 183f.
[91] Friedensvertrag von Lübeck 1629 V 12_22, in: DNT IV, Nr. 5 B, S. 77–83; vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 423–425.
[92] Vgl. Laursen in DNT III, S. 293. Zum Prestige der ersten Rede vgl. Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 325, Bd. II, S. 325.
[93] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 385; Laursen in DNT III, S. 297.
[94] Vgl. Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. I, S. 325, Bd. II, S. 286.
[95] Vgl. Aktstykker og Oplysninger, Bd. I, S. 435–438, Abschied von Sjöaryd 1624 VI 29, in: DNT III, Nr. 34, Art. I, S. 582f.
[96] Vgl. Aktstykker og Oplysninger, Bd. I, S. 109f.; Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 216, 222.
[97] Vgl. Aktstykker og Oplysninger, Bd. I, S. 110, 113f.; Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 320f.
[98] Vgl. Palme, Sverige och Danmark 1942, S. 395–397.
[99] Vgl. ebd., S. 399–401.
[100] Vgl. Tandrup, Mod triumf eller tragedie 1979, Bd. II, S. 267f., 276f., 284f.
[101] Vgl. ebd., Bd. II, S. 301f., 313.
[102] Vgl. ebd., Bd. II, S. 294, 300, 306f., 307f., 317, 324.
[103] Vgl. ebd., Bd. II, S. 304, 312, 314–317, 328f.
[104] Vgl. ebd., Bd. II, S. 314, 318, 333.
[105] Beistandsvertrag von Stockholm 1628 I 4 (IV 28), in: DNT IV, Nr. 3, S. 24–30. – Übereinkunft zur Verteidigung der Stadt Stralsund 1628 IX 17, ebd., Nr. 4, S. 39–41, vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 419; Laursen in DNT IV, S. 16–24, 32–39.
[106] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 461; Laursen in DNT IV, S. 423f.
[107] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 462; Laursen in DNT IV, S. 424, 428, 484f.
[108] Friedensvertrag von Brömsebro 1645 VIII 13, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT IV, Nr. 24 C, S. 437–463. – Handels- und Zollvertrag von Kristianopel 1645 VIII 13, in: DNT IV, Nr. 25 A, S. 487–493, zur Unterzeichnung vgl. Laursen, ebd., S. 431f., 486; Sundberg, Sv. freder och stillestånd 1997, S. 348. Der Ort der Vertragsunterzeichnung wird bis heute in Erinnerung gehalten und abgebildet bei Johannesson, Halland og Blekinge 1981, S. 215.
[109] Bjerg/Frantzen, Danmark i krig 2005, S. 109–131; Ericson Wolke, Tåget 2008, passim.
[110] Friedensvertrag von Roskilde 1658 II 26, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT V, Nr. 13 A, S. 228–240. – Friedensvertrag von Kopenhagen 1660 V 27, in: Duchhardt/Peters, http://www.ieg-friedensvertraege.de (eingesehen am 21.12.2009). Gedruckt in: DNT V, Nr. 21 A, S. 359–376.
[111] Vgl. Busch, Krieg – Krise – Absolutismus 2002, passim.
[112] Vgl. Lind, Konger og krige 2001, S. 361, 393; Tham, Sv. utrikespolitikens historia 1960, S. 154; Zernack, Handelsbeziehungen und Gesandtschaftsverkehr 1993, S. 98f.
[113] Voss, Herrschertreffen 1987, S. 201.
Bengt Büttner, »an beider reiche grentzen oder sonst einem gelegenen ort« – die dänisch-schwedischen Grenztreffen im 16. und 17. Jahrhundert, in: Martin Peters (Hg.), Grenzen des Friedens. Europäische Friedensräume und -orte der Vormoderne, Mainz 2010-07-15 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 4), Abschnitt 84–110.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/04-2010.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008061836>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 85 oder 84–87.