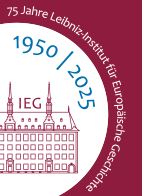Supplements online
| Bernd Klesmann *
|
|
Inhaltsverzeichnis |
Gliederung: 1. ZUM PROBLEM DER VERBINDLICHKEIT ZWISCHENSTAATLICHER ABKOMMEN
2. DER FRIEDENSVERTRAG ALS ELEMENT STAATLICHER KRIEGSBEGRÜNDUNG
3. FRIEDENSVERTRAG UND KRIEGSERKLÄRUNG IM EUROPÄISCHEN STAATENSYSTEM
Anmerkungen
Zitierempfehlung
Text:
Der Friedensvertrag galt und gilt als formale Bürgschaft und inhaltlicher Kern eines wechselseitigen zwischenstaatlichen Einvernehmens, das meist in Kriegs– und Krisenzeiten den widerstrebenden Interessen und Ansprüchen der Konfliktparteien abgerungen werden musste. In historischer Perspektive zeigen sich Wandelbarkeit und Vielschichtigkeit wie auch Traditionsverankerung der komplexen Regelwerke in unterschiedlicher Deutlichkeit.[1] Die Erforschung des beschwerlichen Weges zu den Friedensabkommen von Münster und Osnabrück hat nicht nur gezeigt, wie mühsam und langwierig sich die Verhandlungen gestalteten, sondern auch in welchem Maß der schließlich beschworene Friede von den beteiligten Verantwortlichen als Grundlage eines dauerhaften Ausgleichs und als zukunftsträchtiges Verfassungsdokument wahrgenommen worden ist. Als Kehrseite dieser gesamteuropäischen Wertschätzung des Vertragswerks ließe sich seine langfristige Verwendung als rechtliche Stütze späterer Kriegsbegründungen bezeichnen.[2] In verschiedener Form wurden Entstehung und Bestandteile älterer Friedensverträge immer wieder für eine nunmehr gewünschte Eskalation des zwischenstaatlichen Konflikts argumentativ verwertet. Im Mittelpunkt der jeweiligen Inanspruchnahme geltenden Vertragsrechts stand die Darstellung des Vorgehens der gegnerischen Partei, das als eindeutige Verletzung vereinbarter Bestimmungen gekennzeichnet werden sollte. Die folgenden Überlegungen gehen in drei Schritten vor: zunächst sollen theoretische Einschätzungen des 16. und 17. Jahrhunderts die Bandbreite der zeitgenössischen Annäherung an das Phänomen des Friedensvertrages umreißen. Es folgen ausgewählte Beispiele unterschiedlicher Äußerungen zur Thematik des Friedensvertrages in staatlich autorisierten Texten der Kriegslegitimation. Ein dritter Teil soll abschließend in allgemeinerer Form einige Aspekte des Verhältnisses von Friedensvertrag und Kriegserklärung erörtern.
109
1. ZUM PROBLEM DER VERBINDLICHKEIT ZWISCHENSTAATLICHER ABKOMMEN
Die Betrachtung des Friedensvertrages und seiner Bedeutung innerhalb der europäischen Geschichte führt auf die grundsätzliche, insbesondere im Zusammenhang mit der Erforschung des Konzepts der »Staatsräson« aufgeworfene Frage nach den Bedingungen einer politischen Verpflichtbarkeit des neuzeitlichen Staates.[3] Bereits Machiavelli hat das Gebot der Vertragstreue mit der Begründung aufgeweicht, dass vom Gesichtspunkt des Staates aus eine Beeinträchtigung der Handlungsfreiheit nicht zu wünschen sein könne. Unter Verwendung des bekannten und in der Folgezeit zum Topos avancierten Bildes vom Herrscher als Fuchs und Löwe führt seine Schrift über den Fürsten im 18. Kapitel folgende Unterscheidungen aus:
»Da nun ein Fürst genötigt ist, die Rolle eines wilden Tieres gut zu spielen, muß er sich den Fuchs und den Löwen zum Vorbild nehmen; der Löwe nämlich entgeht den Netzen nicht, der Fuchs entwischt dem Wolfe nicht. Er muß daher ein Fuchs sein, um die Schlingen zu wittern und ihnen zu entgehen, und ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken. Die, welche bloß Löwen sein wollen, verstehen ihre Sache schlecht. Ein kluger Fürst darf daher sein Versprechen nie halten, wenn es ihm schädlich ist oder die Umstände, unter denen er es gegeben hat, sich geändert haben. Diese Grundregel würde nicht gut sein, wenn alle Menschen gut wären. Weil aber alle böse und schlecht sind und in dem gegebenen Falle dem Fürsten ihr Versprechen auch nicht halten würden, so berechtigt ihn dieses, auch wortbrüchig zu werden. Es wird ihm auch nie ein Vorwand fehlen, den Bruch desselben zu beschönigen. Tausend neuere Beispiele könnte ich anführen, um zu zeigen, welche Menge von Friedensschlüssen, von Zusicherungen und Verträgen durch wortbrüchige Fürsten null und nichtig geworden sind – wobei aber immer jene, welche am geschicktesten die Rolle des Fuchses zu spielen verstanden, am besten weggekommen sind.«[4]
110
Machiavellis durchaus kritischer Kommentator Hermann Conring verwahrte sich zwar in seiner Abhandlung aus dem Jahr 1661 gegen eine allgemeine Erlaubnis des Vertragsbruches, die göttliches wie menschliches Recht verletzen würde. Er gestand jedoch zu, dass unter bestimmten Bedingungen, etwa im Falle rechtswidrigen Verhaltens des Vertragspartners oder der Existenz unvorhergesehener schwerwiegender Nachteile einer strikten Beachtung des Abkommens für den betroffenen Staat, dem Vertrag keine bindende Kraft mehr zukomme.[5] Prominente Theoretiker des entstehenden Völkerrechts haben die Geltungsgrenzen des Friedensvertrages in normativer Hinsicht ausführlich erörtert. Ayala untermauerte die weitgehend unstrittige Minimalthese, dass ein einseitig gebrochener Friedensvertrag zunächst grundsätzlich hinfällig sei, unter Berufung auf die konstitutive Wechselseitigkeit des Vertragsschlusses und die scholastische Verknüpfung von erlittenem Unrecht und gerechtem Kriegsgrund.[6] Gentili betonte das Gebot der Verhältnismäßigkeit, bestritt die Hinfälligkeit des Vertrages im Falle geringfügiger Abweichungen eines Vertragspartners und sah als entscheidendes Kriterium der Vertragsverletzung die Existenz einer »offensio« an, die verbal, real oder personal erfolgen könne und die Absicht der schwerwiegenden Schädigung enthalten müsse. Im Vordergrund steht jedoch die Mahnung zur Besonnenheit und unter Berufung auf Aristoteles die Warnung vor leichtfertiger Kriegsneigung aus ungenügenden Ursachen.[7] Grotius widmete der Frage, welche Maßstäbe an die Auslegung zwischenstaatlicher Abkommen anzulegen seien, ein eigenes Kapitel seines Hauptwerks. Unter der Überschrift »De Interpretatione« werden hier die verschiedenen Möglichkeiten erläutert, die zu missverständlichen Auslegungen von Vertragstexten führen könnten, wenn etwa die Bedeutung entscheidender Begriffe wie Bündnispartner (socius), Mitgift (donatio) u.ä. umstritten sei.[8] Ist als Verbündeter nur diejenige politische Einheit zu begreifen, mit der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein Bündnis bestand, oder auch die später in das Bündnis aufgenommene? Die vertragliche Vereinbarung der Zahlung einer Mitgift sei selbstverständlich als hinfällig zu betrachten, wenn keine Ehe geschlossen werde etc. Die hier von Grotius entwickelte Typologie der Vieldeutigkeiten berücksichtigt neben exegetischen Problemen auch die politische Interessenlage der Interpretierenden und zeigt den Friedensvertrag beinahe als ein Mosaik aus Missverständlichkeiten, lässt jedoch Raum für die Beteuerung grundsätzlicher Wertschätzung zwischenstaatlicher Vereinbarungen.[9] Der Kern der diskutierten Vorbehalte bestand im Problem der fraglichen Wirksamkeit eines Vertrages unter signifikant veränderten Umständen. Zwar betonten auch die Theoretiker der Spätscholastik bereits ein Recht auf Wiedergutmachungsforderungen und weitere Maßnahmen im Fall von Rechtsverletzung und Vertragsbruch, die Definition des Vertragsbruches geriet jedoch in der notwendigen Allgemeinheit oft unpräzise.
111
Wiederum bei Grotius, der hier aufgrund der allgemeinen Rezeption seiner Texte im Mittelpunkt stehen soll[10], stoßen wir im Zusammenhang mit der Frage, unter welchen Umständen ein Friedensvertrag als gebrochen und somit hinfällig gelten könne, auf die Erörterung eines dreiteiligen Modells[11]: der Vertrag werde gebrochen durch Aktivitäten, die entweder erstens dem zuwiderlaufen, was Bestandteil jedes Friedens ist (»faciendo contra id quod omni paci inest«), beispielsweise bei Anwendung von Waffengewalt, oder zweitens dem entgegenstehen, was im Friedensvertrag ausdrücklich festgelegt ist (»faciendo contra id quod in pace dictum est aperte«), also durch die Missachtung einzelner Vertragsbestimmungen. Drittens aber liege auch dann Friedensbruch vor, wenn gewissermaßen gegen den Geist des Friedens gehandelt werde (»faciendo contra id quod ex pacis cuiusque natura debet intelligi«), wobei möglicherweise nach Überschneidungen mit dem ersten Kriterium zu fragen bliebe. Als Beispiele für diesen dritten Fall nennt Grotius Formen allgemein feindseligen Verhaltens, jedoch gewissermaßen »short of war« unter Umgehung unmittelbarer Gewaltmaßnahmen, beispielsweise durch überzogene Rüstungen, die offensichtlich der Vorbereitung eines Angriffs dienten. Die Tatsache, dass Grotius sich an anderer Stelle seines Werkes ausdrücklich gegen die Legitimität des Präventivkrieges verwahrt hat, weil die Befürchtung, möglicherweise Gewalt erleiden zu müssen, nicht ihrerseits Gewalt rechtfertigen könne[12], kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass im vorliegenden Passus die Grenze zum staatlichen Handlungszwang im Sinne rechtmäßiger Selbstverteidigung nicht eindeutig und scharf gezogen wird, wie es die normative Textgattung nahe legt, die vom konkreten Einzelfall abstrahieren muss.
Der Hinweis auf den Vertragsbruch des Gegners war insbesondere deshalb zur Konstruktion eines »gerechten Kriegsgrundes« geeignet, weil er in formal eindeutiger Weise von der komplizierten Begründung des Präventivkriegs dispensierte. Die Frage, ob nicht erst die tatsächlich erfolgte, sondern bereits die drohende und nahezu sicher zu erwartende Gewaltanwendung eines äußeren Feindes zur militärischen Gegenwehr berechtige, gehörte stets zu den umstrittensten Problemen des Völkerrechts und hat bis heute nichts von ihrer Brisanz verloren. Das Spektrum möglicher Antworten bildete sich in Anlehnung an die Staatsauffassungen der Antike sowie an deren theologische Modifizierungen seit Augustinus.[13] Vor dem Hintergrund einer weitgehenden Unentschiedenheit auch im Rahmen der zeitgenössischen Systematisierungen[14] bot die Konstatierung eines Vertragsbruches die Möglichkeit der Anknüpfung an verschiedene Argumentationsstränge: der Vertragsbruch ließ sich einerseits als Indiz für zu befürchtende Gewaltakte der Gegenseite auffassen und stellte andererseits bereits an sich ein Unrecht im Sinne des scholastischen Verständnisses eines »bellum iustum« dar, das unter Umständen gewaltsame Gegenwehr rechtfertigen konnte. Die Übertretung einzelner Vertragsbestimmungen markierte auf diese Weise als leicht zu belegender Rechtsbruch die entscheidende Schwelle zum Krieg im Interesse eines wiederherzustellenden Rechtsfriedens. Obwohl der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit staatlicher Zwangs– und Gewaltmaßnahmen in Reaktion auf äußere Gefährdungen benannt und diskutiert wurde, erlaubte es die mangelnde Herausbildung eines verbindlichen zwischenstaatlichen Abstimmungs– und Sanktionsverfahrens nicht, konkrete Kriterien einer praktikablen Beschränkung zu etablieren.[15]
112
2. DER FRIEDENSVERTRAG ALS ELEMENT STAATLICHER KRIEGSBEGRÜNDUNG
Die Subtilitäten der Rechtswissenschaft haben in den veröffentlichten Kriegsmanifesten begrifflich kaum Spuren hinterlassen. Vielmehr wird im Rahmen der staatlichen Verlautbarungen durchweg die unbedingte Respektierung des Friedensvertrages als offenkundige Realität behauptet. Selbst unter widrigsten Umständen und unter Inkaufnahme schwerwiegender Nachteile sei man zu keinem Zeitpunkt vom Wortlaut der jeweiligen Vereinbarung abgewichen. Wie Konrad Repgen in einem breit angelegten Entwurf konstatiert hat[16], folgen die Manifeste stets dem dichotomischen Muster einer Darstellung des politischen Gegensatzes in »Schwarz und Weiß«, legen die Verantwortung für den erfolgten Bruch vollständig der Gegenseite zur Last und nehmen zu diesem Zweck auch den Friedensvertrag in verschiedener Hinsicht in Anspruch, wie im folgenden gezeigt werden soll. Das Kriegsmanifest bildet auch in dieser Hinsicht das inhaltliche Gegenstück des Friedensvertrages, dem die politische Schuldzuweisung fremd war und im Interesse seiner Realisierbarkeit fremd sein musste.[17]
Der Westfälische Frieden, dessen allgemeine Bedeutung als Verfassungsdokument hier nicht erörtert werden soll, wurde schon bald nach seinem Inkrafttreten zum Instrument partikularer Argumentationen der Beteiligten.[18] Bereits die Versuche Kardinal Mazarins, verschiedene Reichsstände zu einer gegen den Kaiser und die drohend ausgemalten Pläne der »Maison d’Autriche« gerichteten Haltung zu ermuntern, zeigten eine Denkfigur, die in den Kriegen Ludwigs XIV. zum selbstverständlichen Bestandteil der französischen Legitimationsschriften werden sollte: die kaiserliche Unterstützung der Spanier, die in den Niederlanden bekanntlich bis zum Abschluss des Pyrenäenfriedens den seit 1635 offen geführten Krieg mit Frankreich fortsetzten, sei als eklatanter Bruch des Friedens von Münster zu bewerten. In Schreiben an den Herzog von Sachsen–Weimar und den Fürstbischof von Osnabrück stellte die noch von Mazarin geprägte französische Diplomatie das habsburgische Vorgehen insofern als besonders perfide dar, als die Waffenhilfe an Spanien unter dem Anschein einer Abdankung der Truppen, also im Zeichen der Friedenssicherung, de facto jedoch als verdeckte Transferierung der Verbände in die Niederlande und nach Oberitalien vor sich gehe.[19] Der Bezug zum Rechtszusammenhang des Westfälischen Friedens, dessen Verletzung es zu verhindern gelte, zog sich neben anderen Begründungsfiguren wie ein roter Faden durch die Verlautbarungen der französischen Krone im langfristigen Konflikt mit Madrid und Wien. Noch im Kontext des Siebenjährigen Krieges beriefen sich die schwedischen und französischen Gesandten in Regensburg in einer gemeinsamen Erklärung auf die Grundlagen der Westfälischen Friedensverträge, insbesondere die berühmte »liberté germanique«, die in der gewandelten Situation nach der Umkehr der Allianzen nunmehr für das Kaiserhaus in die Waagschale geworfen und mit dem Eintreten für ein Gleichgewicht der Konfessionen im Reich verknüpft wurde. Ludwig XV. ließ im März 1757 erklären, dass er gemeinsam mit Adolf Friedrich von Schweden alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen werde, um die Sicherheit des Reiches als Garant der Verträge von 1648 zu gewährleisten.[20]
113
Über die bis hierher vorgestellten Formen einer Beschuldigung des Vertragspartners hinaus wandte sich die Kriegsbegründung in einigen Fällen auch gegen das Instrument des Friedensvertrages an sich, sofern es nach Auffassung einer der Konfliktparteien nicht zur Gewährleistung eines dauerhaften Friedenszustands geeignet schien. Ein bekanntes Beispiel für diese offene Missbilligung des Vertragsabschlusses Dritter liegt mit der Bewertung des Prager Friedens durch Richelieu vor. Der zwischen Kaiser und Reichsständen geschlossene Vertrag wurde in der französischen Kriegserklärung von 1635 als »unerschöpfliche Saat der Zwietracht« bezeichnet, als die Asche, unter der das schwelende Feuer nur um so gefährlicher lauere, und auf diese Weise geradezu zum Kriegsgrund erhoben.[21] Hintergrund der natürlich auch strategisch motivierten Kritik war die Beschränkung auf das Reich und damit nach französischer Auffassung die unzulässige Verkürzung des habsburgisch–bourbonischen Gegensatzes, der in Wirklichkeit einen Konflikt von europäischen Dimensionen darstelle und daher auch einer europäischen, also »universalen« Friedensregelung bedürfe und durch einseitige Verständigungsversuche nur verzerrt werden könne. Die Bedenken der protestantischen Seite, die insbesondere die zeitliche Beschränkung der Geltung und das Fehlen einer Amnestieregelung betrafen, machte sich die französische Krone zwar nicht ausdrücklich zu eigen, versuchte jedoch im Manifest gegen Spanien in gleichsam dialektischer Weise den protestantischen Standpunkt zumindest zur Geltung zu bringen. So wurde hervorgehoben, dass das Erstarken der Reformierten letztlich auf die Machenschaften der Spanier zurückzuführen sei, die durch die Maßlosigkeit ihrer Interessenpolitik insbesondere gegenüber Frankreich ein gemeinsames Eintreten für den rechten Glauben verhindert hätten. Ein zukunftsfähiger Friedensschluss müsse jedenfalls alle katholischen Mächte einbeziehen, hieß es weiter, wobei auch die Vermittlungsbemühungen Papst Urbans VIII. ausführlich Erwähnung fanden, um Bedenken gegen die aus konfessioneller Perspektive fragwürdige Konfrontation mit der Führungsmacht des Katholizismus zu zerstreuen.
114
Vergleichbare Anschuldigungen einer angeblichen Doppelbödigkeit aktueller Friedensabkommen enthielten die Manifeste gegen Kaiser Leopold I. im Hinblick auf die Verträge mit der Pforte. So präsentierte das französische, in Form eines Ultimatums gehaltene Manifest von 1688 unter anderem den Vorwurf, am Kaiserhof betreibe man eine Beendigung des Türkenkrieges in der vorrangigen Absicht, die gewonnene Handlungsfreiheit gegen Frankreich zu wenden[22]; ein Argument, das Leibniz in seiner Entgegnung auf das französische Manifest als Chimäre und »Roman politique« zu entlarven versuchte.[23] Die Zulässigkeit des Vertragsabschlusses mit nichtchristlichen Gemeinwesen war seit den Kreuzzügen und verstärkt seit den großen Entdeckungen und dem Beginn der Eroberung Amerikas zum Gegenstand juristischer Diskussionen geworden, hatte jedoch längst Eingang in die Staatenpraxis gefunden und konnte nur im Horizont politischer Polemik in Frage gestellt werden.[24] Der Verdacht eines Bündnisses mit dem Osmanischen Reich gegen christliche Staaten behielt jedoch lange seine skandalöse Konnotation und eignete sich vortrefflich zur publizistischen Diffamierung.
Auch auf türkischer Seite fand das Phänomen des Friedensvertrags Eingang in die Kriegsbegründung, hier allerdings wiederum in der üblichen Form einer Anmahnung des gegnerischen Friedensbruches. So hieß es im Frühjahr 1683 im Sendschreiben des Großwesirs Kara Mustafa aus dem Feldlager bei Esseg an der Drau (heute Osijek/Kroatien), die unverhältnismäßigen Rüstungen und die rechtswidrige Besteuerung türkischer Vasallen durch die kaiserliche Seite stellten einen eindeutigen Verstoß gegen das Abkommen von Eisenburg aus dem Jahr 1664 dar, in dem Leopold I. trotz des spektakulären Sieges bei St. Gotthard an der Raab u.a. die türkische Herrschaft über Siebenbürgen anerkennen musste. Die religiöse Kriegslegitimation im Sinne einer gewaltsamen Missionierung der Ungläubigen trat gegenüber dieser Anmahnung konkreter Vertragsverletzungen völlig zurück.[25]
Die vielfachen Bezüge zu den zeitgenössischen Friedensverträgen bewirkten eine eigentümliche Durchdringung der Kriegslegitimation mit Elementen einer religiös eingefärbten Friedensrhetorik, die, entsprechend dem erwähnten Verfahren einer holzschnittartigen Darstellung, ihre Konturen überwiegend aus der Abgrenzung zur Gegenseite bezog. Die eigene Vertragstreue wurde mit religiöser Hingabe verglichen und so in ihrer Geisteshaltung über die Grenzen politischer Opportunität hinausgehoben.[26]
115
Der angebliche Friedenscharakter des zu legitimierenden Kriegsbeginns wurde mitunter besonders akzentuiert durch die Hervorhebung eines gewandelten politischen Zusammenhangs. So betonten die Generalstaaten in ihrer Kriegserklärung an das revolutionäre England, das Einvernehmen mit Karl I. stets fortgesetzt zu haben, das bis zur gemeinsamen Unterstützung der französischen Krone im Kampf gegen die Hugenotten reichte. Erst die eindeutig feindseligen Akte der neuen Regierung, gemeint war die Verabschiedung der Navigationsakte durch das englische Parlament, hätten jede Verständigung unmöglich gemacht.[27] Der alte Gegensatz der beiden Kolonialmächte eskalierte in der Mitte des 17. Jahrhunderts in der bekannten Serie dreier Kriege, deren beinahe globale Dimension sich nicht auf die Schauplätze der Kämpfe beschränkte, sondern in gewisser Hinsicht auch die Komplexität und Unübersichtlichkeit der strittigen Rechtsfragen erhöhte. Als Beispiel für die Benutzung des Friedensabkommens in Übersee zur Legitimation eines ursprünglich europäischen Krieges sei der Konflikt um Surinam genannt: Als Teil der englischen Besitzungen in Guyana wurde das Gebiet des heutigen Surinam im Frieden von Breda 1667 an die Niederlande abgetreten. Der französische Gesandte in London, Colbert de Croissy, Bruder des bekannten Ministers, berichtete 1670, die vereinbarte Übergabe werde von den englischen Unterhändlern verzögert und absichtlich behindert, um die entstehenden Verwicklungen als Vorwand zum Krieg nutzen zu können.[28] In der Kriegserklärung Karls II., die zwei Jahre später die von englischer Seite im Ärmelkanal begonnenen Feindseligkeiten rechtfertigen sollten, fand der Streit um den Abzug der Kolonisten tatsächlich an prominenter Stelle als eine der ersten Beschwerden über die gewalttätige Gesinnung der Niederländer Erwähnung: Wie vereinbart hätten die englischen Siedler Surinam räumen wollen, obwohl die verantwortlichen Kommissare der Generalstaaten sich nicht an der abgesprochenen Planung des Transfers beteiligt hätten. Vielmehr habe man von niederländischer Seite alles getan, um durch Verhaftungen und weitere Zwangsmaßnahmen einen friedlichen Abzug der Engländer zu verhindern, so dass lediglich die Armen und Notleidenden unter ihnen das Land verlassen konnten, während man die Wohlhabenderen trotz wiederholter Beschwerden festhalte.[29] Auch andere Bestimmungen des Friedens von Breda ließen sich ohne größeren juristischen Aufwand in der Folgezeit zuungunsten des Vertragspartners auslegen: Artikel 19 legte fest, dass niederländische Schiffe bei Vorüberfahrt eines englischen Kriegsschiffes bestimmte Salutgesten zu vollziehen hätten, insbesondere das Dippen der Flagge und das Einholen des Toppsegels. Artikel 20 erlegte beiden Vertragspartnern gegenseitige Hilfe im Kampf gegen die Piraterie auf.[30] Beide Bestimmungen wurden – negativ gewendet – in der Kriegserklärung Karls II. wieder aufgegriffen, die entsprechenden Versäumnisse der Generalstaaten wortreich beklagt. Ausdrücklich wurde bereits im Friedensabkommen von 1667 die Möglichkeit eines erneuten Waffenganges, den Gott gnädig verhüten möge, wie es hieß, erörtert, und für diesen Fall die übliche Sechsmonatsfrist für die Transferierung feindlichen Vermögens festgeschrieben, die aus anderen Zusammenhängen bekannt ist.[31]
Zwei letzte Beispiele für Formen der Instrumentalisierung des Friedensvertrages mögen die Reihe ergänzen. Das bekannte Manifest Gustav Adolfs, das nach seiner Landung auf Usedom im Juli 1630 auch in deutscher Übersetzung verbreitet worden ist, enthielt allenfalls indirekte Hinweise auf den zu befreienden Protestantismus im Reich und argumentierte vielmehr überwiegend staatsrechtlich mit dem Entwurf einer durch die kaiserliche Expansion bedrohten politischen Welt des Ostseeraums. So geriet in diesem Fall die Verhinderung eines Friedensvertrages zum zentralen Vorwurf und Kriegsgrund, nämlich die angebliche Hintertreibung einer Verständigung Schwedens mit dem Königreich Polen durch die spanische und kaiserliche Diplomatie.
116
»Nachmals, ob wol zum öfftern nicht gar zweiffelhafftige Hoffnung erschienen, die langwirigen Streitigkeiten zwischen Schweden und Polen, durch guter Freunde Vnterhandlung hinzulegen. in dem die Commissarien beyder Reiche von Jahren zu Jahren zusammenkommen: Jedoch haben die Hasser des gemeinen Friedens, durch vielfältige Botten vnd Brieffe, welche sie in Polen gesändet, es dahin gerichtet, dass kein Friede solte getroffen werden, biß sie ihre Anschläge in dem Römischen Reich in das Werck gesetzet: Vnd die Vertröstung hinzu gethan, dass, wenn die Stände in Teutschland gedemütiget oder gezwungen, solten die Polen, das Königreich Schweden einzunehmen vnnd unter das Joch zubringen, an ihnen keine faule Beyhelffer haben.«[32]
Vor diesem Hintergrund konnte das schwedische Eingreifen im Reich als Defensivkrieg dargestellt werden, insbesondere als Verteidigung gegen die kaiserliche Waffenhilfe an den König von Polen, die schon 1627, und zwar unter kaiserlichen Fahnen, in Preußen, das sich damals noch unter polnischer Lehenshoheit befunden hatte, erfolgt sei. Die Bezeichnung »Friedenshasser«, »Hasser des gemeinen Friedens«, zog sich durch den gesamten Text und leistete die entscheidende, natürlich polemisch verzerrte Verknüpfung des zu bekämpfenden Gegners mit dem zu erstrebenden Frieden im Sinne einer »intentio recta«.[33]
Eine wiederum positiv gewendete Inanspruchnahme des Friedensabkommens findet sich in ungewöhnlich langfristiger Rückschau im Kontext des Ersten Villmergerkrieges in der Eidgenossenschaft 1656. Den Auslöser dieser auch konfessionell motivierten Auseinandersetzung zwischen den reformierten Orten Bern und Zürich sowie dem katholischen Luzern bildete die Verfolgung einer protestantischen Gruppierung in der Innerschweiz, zu deren Anwalt sich der Rat der Stadt Zürich aufschwang. Der Konflikt eskalierte kurzfristig auch militärisch und führte zu einer mangelhalft abgestimmten Operation der protestantischen Orte, die in einer Niederlage endete und für die nächsten Jahrzehnte deren Übergewicht in der Eidgenossenschaft verhinderte.[34] Beide Kriegsparteien beriefen sich in ihren Manifesten ausdrücklich auf den Kappeler Landfrieden von 1531, der den konfessionellen Status quo festgeschrieben und die Ausbreitung der Reformation auf die gesamte Eidgenossenschaft verhindert hatte.[35] Mag diese Instrumentalisierung besonders von Seiten der reformierten Orte, denen es eigentlich um eine Revision dieses Friedensschlusses zu ihren Gunsten zu tun war, auch zunächst befremden, lassen sich doch die Hinweise des Manifests insbesondere auf die vertraglich vereinbarte Freizügigkeit innerhalb der Eidgenossenschaft, die durch Gefangensetzung und Beraubung der Protestanten in Schwyz verletzt worden sei, in die Strategie des Kriegsbeginns einfügen. Das Gegenmanifest der katholischen Seite greift zurück bis ins Jahr 1351 und leitet aus dem Wortlaut des damaligen Bundesschlusses der vier Waldstätten mit Zürich die Unanfechtbarkeit der eigenen Gerichtshoheit ab, die durch das Manifest der Protestanten und ihre Intervention zugunsten der Reformierten in Zweifel gezogen worden sei.
Die Beispiele ließen sich vermehren und zeigen drei hauptsächliche Typen der Instrumentalisierung des Friedensvertrags im Kontext der Kriegserklärung: erstens die Feststellung des Vertragsbruches, zweitens den Vorwurf der Vertragsvereitelung und drittens die Anfechtung der Vertragsvoraussetzungen.
117
3. FRIEDENSVERTRAG UND KRIEGSERKLÄRUNG IM EUROPÄISCHEN STAATENSYSTEM
Es mag trotz dieser Befunde zu weit gehen, in den Friedensverträgen der Frühen Neuzeit ausschließlich befristet kalkulierte Waffenstillstandsregelungen zu sehen. Die Kritik politischer Beobachter der Zeit wies zwar auf die angebliche Beliebigkeit der Entscheidung zwischen Krieg und Frieden nach Maßgabe der Staatsräson hin, bildete jedoch ihrerseits ein Beispiel für die Intensität der öffentlichen Debatten über die iustitia belli. Es dürfte andererseits kaum zu bestreiten sein, dass die Ausschließung künftiger Konfliktursachen einen schwerlich einzulösenden Anspruch darstellte.[36] Vielmehr lag die eigentliche Leistung des Friedensvertrages in der politischen Vermittlung einer doppelten »Fiktionalität«, die durch die Amnestieregelungen den eben erst beendeten Krieg dem Vergessen anheim geben und zugleich einen als ewig und unveränderlich gedachten Friedenszustand auf neuer und veränderter Grundlage ausgestalten sollte.[37] Es ist bezeichnend für die Kriegsmanifeste der Frühen Neuzeit, dass in ihnen diese Fiktionalität nicht nur nicht in Frage gestellt, sondern in den neu entstehenden Konflikt hinein fortgeschrieben wird: als Kriegsgründe erwähnt werden nicht die Ereignisse des jüngsten Krieges, sondern diejenigen seit Abschluss des jüngsten Vertrages. Der Friedenszustand wird nicht als schwankende Kompromisslösung in wechselnden Kontexten dargestellt, sondern als Idealzustand, an dem man nur zu gerne festgehalten hätte. Entscheidende Kriegsmotivation in der Lesart des staatlichen Manifests ist vor allem die Gefährdung des Friedenszustandes. Die Unterstellung kriegerischer Absichten der Gegenseite, der Hinweis auf angeblich bedrohliche Rüstungen scheinen immer dann besonderes Gewicht innerhalb der Texte zu erhalten, wenn konkret belegbare Rechtsverletzungen nicht ausreichen, um die Unabwendbarkeit des Krieges zu behaupten. So nimmt das bereits erwähnte französische Manifest von 1688, das sich zweifellos auch als ein Dokument staatlichen Expansionsdranges lesen lässt, zu der Konstruktion eines kaiserlichen Kriegsplans am Oberrhein Zuflucht. Die antifranzösische Koalition versäumt nicht, auf die Unbeweisbarkeit der französischen Anschuldigungen hinzuweisen und bringt in ihren Verlautbarungen wiederum die Vertragsverletzungen Ludwigs XIV. zur Sprache. Im spanischen Manifest vom Mai 1689 heißt es bereits einleitend, nach allen Friedensschlüssen, Verträgen und Stillständen, die Karl II. mit religiösem Respekt geachtet habe, die von Frankreich aber so leichtfertig verletzt, so willkürlich gebrochen und so unüberlegt zunichte gemacht worden seien, erübrige sich jede Bemühung um eine friedliche Beilegung des Konflikts.[38] Die Unterstellung feindseliger Absichten der Gegenseite wird in zahlreichen Texten der Kriegslegitimation durch eine Gegenüberstellung mit den eigenen, geduldigen und vorbildlichen Ausgleichsbemühungen verstärkt. Im Sinne der scholastischen Doktrin eines bellum iustum, dessen Ziel immer die Wiederherstellung eines dauerhaften Friedenszustandes sein müsse, wird die Permanenz dieses Friedenswillens betont, etwa indem gesagt wird, dass erst wohlwollende Ratgeber die Gefahren einer weiteren Untätigkeit und weiteren Abwartens so überzeugend dargestellt hätten, dass man in den verantwortlichen Gremien schließlich den Einsatz militärischer Gewalt habe beschließen müssen.[39]
118
Die bis hierhin nicht erwähnte Ergänzung des Friedensschlusses durch Vermählung Angehöriger der Vertrag schließenden Dynastien wäre ebenfalls mitunter als ein Faktor künftiger Kriegslegitimationen zu begreifen, der durch die bekannte Erbfolgeproblematik langfristige Gegensätze schaffen konnte, wie der Fall des Pyrenäenfriedens zeigt. Die vereinbarte Vermählung des Königs von Frankreich mit der Tochter Philipps IV. wurde bereits in den folgenden Jahren wegen der divergierenden Auffassungen über die zu zahlende Mitgift zum Gegenstand diplomatischer Kontroversen und bildete ein halbes Jahrhundert lang den formalen Angelpunkt des habsburgisch–französischen Gegensatzes. Die Reunionspolitik Ludwigs XIV. brachte die Rechtsargumentationen des französischen Hofes in der Folgezeit in Misskredit und erschwerte die Verständigungsbemühungen. Der Regensburger Stillstand von 1684, wenn er auch durch seine Befristung auf zwanzig Jahre den Kriterien des Friedensvertrages nicht völlig genügt, wurde zu Beginn des vier Jahre später erneut aufflammenden Krieges in den Kriegserklärungen beider Kontrahenten zur rückblickenden Untermauerung ihrer jeweiligen Friedensabsichten angeführt. Das französische Manifest bündelte geradezu die erwähnten Elemente der Unterstellung feindseliger Absichten bei gleichzeitiger Beteuerung der eigenen Geduld und Langmut. So sei es offensichtlich gewesen, als der Stillstand noch kaum unterzeichnet war, dass der König von Frankreich weitere Beweise seiner Mäßigung zu geben bereit war, obwohl er erfahren hatte, dass die kaiserlichen Minister sich bemühten, die Fürsten und Stände des Reiches zu Bündnissen gegen Frankreich zu bewegen. In der Entgegnung aus Wien hieß es, es sei wohl nunmehr für Jedermann offensichtlich, dass der von Frankreich angeblich erstrebte Friede, der im Manifest des Königs ultimativ angeboten worden war, keinen Wert habe und welcher Art die zu erhoffende Ewigkeit des Friedens sei, wenn derart nichtige Gründe wie im aktuellen Fall zum Vertragsbruch ausreichten und das zwanzigjährige Armistitium kaum vier Jahre Bestand gehabt habe.[40]
Johannes Burkhardt hat den ständig wiederkehrenden Verweis auf »memoriale« Stützfaktoren der Staatsbildung wie auch des Staatenkonflikts mit dem Vorherrschen eines statischen Geschichtsbildes in Verbindung gebracht, das aus einem überwiegenden Exempeldenken eine Unwandelbarkeit der vorherrschenden Gegensätze abzuleiten geneigt war.[41] Wenn diese Einschätzung sicherlich für einige unerwartete Wendungen des europäischen Bündnis– und Feindschaftssystems in weniger offensichtlicher Weise zutreffen mag, etwa im Fall des französischen Angriffs auf die Niederlande 1672, die man von Seiten der Bourbonen vielmehr stets als Bundesgenossen im Kampf gegen Spanien zu schätzen wusste, so wirkte doch »Geschichte als Argument« auch im Sinne der Kriegslegitimation. Der jüngste wie auch der weit zurückliegende Friedensschluss mit dem erneut zu bekämpfenden Gegner wurde gleichsam zur Variable, die von beiden Seiten in die aktuell opportunen Argumentationen eingepasst werden konnte, sofern die Behauptung des gegnerischen Vertragsbruches nicht allzu offensichtlich als Konstruktion erkennbar wurde.
119
Machiavellis Relativierung der Vertragsverbindlichkeit, die bei aller Berücksichtigung der Textgattung des Fürstenspiegels einer Aufhebung der Verbindlichkeit gleichkam, wurde in der Flugblattpublizistik der jeweiligen Gegenseite unterstellt, sein Name zur Chiffre für politische Amoralität, wie sich in besonderer Deutlichkeit in den antifranzösischen Schriften der 1670er und 80er Jahre beobachten lässt.[42] Die öffentlich immer wieder angemahnte Respektierung der Verträge geriet in ihrer negativen Wendung zum Topos auch der nicht– offiziellen Flugblattproduktion, die als eine Hauptquelle der Feindbild– und Stereotypenforschung den Diffamierungsdiskurs von der Unberechenbarkeit und Treulosigkeit des Gegners in vielfältiger Form erkennen lässt.
Der Befund einer häufigen, wenn nicht permanenten und in allen Fällen zumindest mittelbar belegbaren Bezeichnung des Gegners als Friedens– und Vertragsbrecher weit über 1648 hinaus könnten insbesondere neuere Überlegungen ergänzen, die im Hinblick auf den zeitgenössischen Kriegsbegriff eine Verlagerung von der juridischen auf die politische Ebene sehen.[43] Was für den Friedensvertrag zutreffend beobachtet worden ist, dass sich nämlich durch die Amnestieklauseln bereits seit dem späten Mittelalter ein nicht–diskriminierendes Verfahren der Rechtskonstitution durchgesetzt hat, scheint für die Begründung des Kriegsbeginns gerade nicht zu gelten, auch wenn die völkerrechtliche Entwicklung sich in Richtung eines freien Kriegführungsrechts der souveränen Staaten bewegte. Zwar scheint es in der Forschung unstrittig zu sein, dass sich auf der Ebene der Rechtstheorie von Vitoria über Ayala bis Grotius eine inhaltliche Aufweichung des gerechten Kriegsgrundes vollzogen hat, die auch als Formalisierung des gerechten Krieges bezeichnet worden ist und in ihren Auswirkungen am negativsten von Otto Kimminich als erste Stufe einer sich politisch zunehmend verwirklichenden »Souveränitätsanarchie« gesehen worden ist.[44] Auf der diskursiven Ebene der öffentlichen Kriegsbegründung von Seiten der beteiligten Staaten lässt sich diese Tendenz jedoch nicht greifen. Hier bleibt das verbale Festhalten an rechtlichen Kategorien und Verbindlichkeiten, und nicht der Hinweis auf das Staatsinteresse, der entscheidende Punkt der überlieferten Kriegsmanifeste. Wenn sich auch de facto eine gewisse Beliebigkeit der Deutung und wechselnde Möglichkeiten der Beugung von Friedensverträgen aus den politischen Machtverhältnissen ergaben, stellte doch die Betonung der Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns unter unausweichlichem Zwang den Kern der Kriegslegitimation dar, die stets mit der Beschwörung des zu erkämpfenden Friedenszustandes verknüpft blieb. Die politische Opportunität wurde in anderen Texten zum Thema.[45]
120
Ein zukunftsweisender Bestandteil der frühneuzeitlichen Friedensabkommen, den Fritz Dickmann schon für die Zeit ab dem Frieden von Blois 1505 hervorgehoben hat, nämlich das Verfahren einer Vertragsgarantie durch Dritte oder, wie 1648, durch die Gesamtheit der Unterzeichnenden, wurde von verschiedenen Seiten in die Beteuerung einer Notwendigkeit der Verteidigung des Status quo eingefügt, und konnte durch das Zurücktreten der päpstlichen Schiedsautorität und das Fehlen eines allgemein anerkannten Arbiters der Christenheit aus verschiedenen Perspektiven vereinnahmt werden.[46] Ein »System kollektiver Sicherheit«, wie es insbesondere als Projekt Richelieus im Kampf gegen die angeblich drohende Universalmonarchie des Hauses Österreich beschrieben worden ist, ließe sich auch ex negativo als ein System der Divergenzen auf formal identischer Rechtsgrundlage beschreiben, da die Bestimmung des Bündnisfalls keiner unumstrittenen Feststellung unterliegen konnte. Die Kriegsmanifeste sind dabei aufgrund der Unschärfe des zeitgenössischen Kriegsbegriffes nur bedingt als Rechtsdokumente zu begreifen, zumal sie ihren Zwecken entsprechend selbstverständlich keine Anerkennung durch die Gegenseite fanden und zudem meist erst nach Beginn der Feindseligkeiten im Druck erschienen. Einen positiven Rechtscharakter nahmen sie abgesehen von den erwähnten Formen der Feststellung des Friedensbruches durch den Gegner nur dann für sich in Anspruch, wenn sie ausdrücklich in Erfüllung älterer Vertragsverpflichtungen ergangen sind und so keine fundamentale Störung der Rechtsordnung behaupteten, wie etwa im Fall der französischen Verlautbarung von 1666, die den Eintritt in den Krieg gegen Karl II. von England mit Bündnisverpflichtungen gegenüber den Generalstaaten begründete, und deren Zurückhaltung auch politisch motiviert war, weil man in Paris ein Bündnis mit England für die nähere Zukunft nicht ausschließen wollte.[47] Es gehörte davon abgesehen zum standardisierten Verfahren der Manifeste, den Verlautbarungen der Gegenseite aus inhaltlichen wie formalen Gründen jede Berechtigung abzusprechen, wie auch die Veröffentlichung gegnerischer Rechtfertigungsschriften im eigenen Herrschaftsbereich nach Möglichkeit verhindert worden ist.
Die kontrastive Gegenüberstellung der heutigen, durch die Charta der Vereinten Nationen festgelegten normativen Ächtung des Staatenkrieges und der Realitäten der frühneuzeitlichen Kriegshäufigkeit kann nicht über eine gewisse Kontinuität im argumentativen Umgang mit Krieg und Recht hinwegtäuschen. In seiner Biographie des Sonnenkönigs hat François Bluche im Hinblick auf die französische Außenpolitik die Auffassung vertreten, die neuere Forschung habe in der Rückschau die moderne Sensibilität für das Phänomen des Kriegsbeginns in anachronistischer Weise auf das 17. Jahrhundert übertragen, das jedoch von anderen Auffassungen geprägt gewesen sei. Die Feierlichkeit der großen Friedensverträge des Ancien Régime rege dazu an, so Bluche, den Friedens– vom Kriegszustand zu streng zu unterscheiden. Das 17. Jahrhundert sei jedoch weniger legalistisch gewesen, so dass für realistische Staatsmänner der Zeit die Abgabe einer Kriegserklärung im Vorfeld eines Angriffes keine ernstzunehmende Option dargestellt habe.[48] Es bleibt jedoch vor dem Hintergrund des Gesagten möglicherweise auch in dieser Hinsicht zu bedenken, dass der Rekurs auf das Recht durchgängig bestehen blieb. Zwar begannen in der Tat zahlreiche Konflikte ohne vorherige Kriegserklärung oder –ankündigung, in den weit überwiegenden Fällen wurden die entsprechenden Schriften jedoch nach wenigen Tagen nachgeliefert. Es scheint vielmehr für das sehr wohl legalistische Staats– und Kriegsverständnis der Zeitgenossen kennzeichnend, dass auch in den Konflikten, denen schriftliche Legitimationen vorausgegangen waren, das Fehlen ebendieser Erklärungen als Indiz für die Unrechtmäßigkeit des Vorgehens angemahnt worden ist, so in den bekannten Flugschriften Lisolas, der selbst die Rechte studiert hatte und seine Ausführungen auf vielfache wörtliche und als solche kenntlich gemachte Anleihen bei Grotius gestützt hat.[49] Der von Bluche erwähnten Solennität der Friedensabkommen steht somit eine auch völkerrechtlich verankerte Solennität der Kriegserklärung gegenüber, die zumindest in sprachlicher Gestalt von allen beteiligten Verantwortlichen angestrebt wurde. Wie Barbara Stollberg–Rilinger mehrfach betont hat, ist im frühneuzeitlichen Kontext die Feierlichkeit des Rechtsaktes weniger als schmückendes Beiwerk der eigentlich entscheidenden Vorgänge zu bewerten, sondern ihrerseits geradezu konstitutiv.[50] Die ostentative Kriegserklärung durch eigens abgesandte Herolde nach spätmittelalterlicher Tradition trat zwar im Verlauf des 17. Jahrhunderts immer stärker zurück, die formale Bestätigung der Kriegslegitimation in Textform bildet jedoch teilweise bis heute eine Begleiterscheinung des Kriegsbeginns. So bleibt andererseits die These vom vormodernen Recht als einem immer auch symbolischen, dezidiert nicht positivistischen, in Frage zu stellen. Gerade das als legitim hervorgehobene Beharren auf älteren Vertragstexten und die Vereinnahmung des Wortlautes geschlossener Verträge im Vorfeld großer Konflikte sprechen bei aller Unterschiedlichkeit der Interpretation im Gegenteil für eine allgemein als glaubwürdig vorausgesetzte Wertschätzung des geschriebenen Rechts.[51]
121
ANMERKUNGEN
[*] Bernd Klesmann, Dr. des., Institut für Geschichtswissenschaften, HU-Berlin.
[1] Vgl. die grundlegende Darstellung von Jörg FISCH, Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses. Stuttgart 1979; aktuelle Perspektiven enthält der Sammelband von Randall LESAFFER (Hg.), Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One. Cambridge 2004.
[2] Zur öffentlichen Kriegsbegründung in Europa seit dem 13. Jahrhundert vgl. Konrad REPGEN, Kriegslegitimationen in Alteuropa. Entwurf einer historischen Typologie, in: HZ 241 (1985), S. 27–49; Heinz DUCHHARDT, Krieg und Frieden im Zeitalter Ludwigs XIV. Düsseldorf 1987, insbesondere S. 15–24 sowie das Quellenmaterial S. 35–46.
[3] Vgl. Michael BEHNEN, »Arcana – haec sunt ratio status.« Ragion di Stato und Staatsräson. Probleme und Perspektiven 1589–1651, in: ZHF 14 (1987), S. 129–195, besonders S. 146–147 die Diskussion der »deroga« und des »potere derogatorio« als »bewußter Verstoß gegen die geltende Rechts– und Gesetzesordnung« im Interesse des öffentlichen Wohls nach dem Verständnis des in Florenz wirkenden Juristen und Historikers Scipione Ammirato. Zu aktuelleren Fragen der Derogationsproblematik als Priorisierung einer von zwei konkurrierenden Rechtsvorschriften im mittlerweile stark verdichteten Gefüge internationaler Abkommen vgl. Wolfram KARL, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht. Zum Einfluß der Praxis auf Inhalt und Bestand völkerrechtlicher Verträge. Berlin u.a. 1983, S. 58–110.
[4] Übersetzung nach Niccolò MACHIAVELLI, Politische Schriften, hg. v. Herfried MÜNKLER, Frankfurt/Main 1990, S. 97. Zur Relevanz dieser Passage für Machiavellis »politische Anthropologie« und ihre Distanz zur vorherrschenden Tugendauffassung des Humanismus vgl. Wolfgang KERSTING, Niccolò Machiavelli. München 1988, S. 30–32.
[5] Hermann CONRING, Animadversiones Politicae in Nicolai Machiavelli Librum De Principe. Helmstedt 1661, S. 167: »Ad hoc, non Romani tantum civilis, sed etiam naturalis juris est, in contractibus bonae fidei si dolus malus commissus, aus si quis laesus fuerit ultra dimidium, aut si quod praeter omnem expectationem ex stricta contractus observatione grande incommodum acciderit, aut denique si altera contrahentium pars contractum violaverit: licere tunc summae cuique potestati, ac proinde etiam Principibus, & rescindere contractus, & in integrum sese ac res suas restituere.« Zur insgesamt unvoreingenommenen Haltung Conrings gegenüber den Konzepten des »Principe« vgl. KERSTING, Machiavelli, S. 159. Ambivalenzen in Conrings Beurteilung der Vertragsrelativierung nach Machiavelli, insbesondere religiös begründete Vorbehalte betont Michael STOLLEIS, Machiavellismus und Staatsräson. Ein Beitrag zu Conrings politischem Denken, in: ders. (Hg.), Hermann Conring (1606–1681). Beiträge zu Leben und Werk. Berlin 1983, S. 173–199, hier S. 178.
[6] Balthazar AYALA, De iure et officiis bellicis et disciplina militari. Antwerpen 1597, S. 122: »Generalis enim lex est omnium conventionum, ut nemo illis stare teneatur, nisi ex adverso, quae convenerunt, praestentur. […] neque dicendus est quis ex hac causa fidem violare; sed potius ex nova eademque iustissima causa, nempe ruptae fidei, iure belli agere cum hostibus, divini humanique iuris contemptoribus«.
[7] Albericus GENTILIS, De iure belli […], Köln 1598, S. 702–715. Die Ausführungen zu dieser Thematik bilden das Schlusskapitel des Werkes und münden in ein Friedensgebet. Wie Gentilis theologische Schriften stieß auch »De iure belli« aus verschiedenen Gründen auf ein geteiltes Echo und erschien, wie alle seine Werke, ab 1603 auf dem Index Librorum Prohibitorum, vgl. Gesina H. J. van der MOLEN, Alberico Gentili and the Development of International Law. His Life, Work and Times. Leiden 1968, S. 60.
[8] Hugo GROTIUS, De iure belli ac pacis libri tres: in quibus ius naturae & gentium, item iuris publici praecipua explicantur: cum annotionis auctoris, eiusdemque dissertatione de mari liberoue addidit. B. De Kanter–van Hettinga TROMP (Hg.). Leiden 1939, hier Buch II, Kap. 16, S. 407–426.
[9] Vgl. ebd., S. 414, die Charakterisierung jeder Begründung eines Vertragsbruches als »odiosa materia«. In welchem Ausmaß dieser und ähnliche Vorbehalte der insgesamt für Grotius kennzeichnenden Tendenz zur Formalisierung des Kriegsbegriffs zuwiderlaufen, kann hier nicht dargestellt werden, vgl. Wilhelm JANSSEN, Art. »Krieg«, in: Otto BRUNNER / Werner CONZE / Reinhart KOSELLECK (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch–sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3. Stuttgart 1982, S. 567–587, hier S. 583; Peter HAGGENMACHER, Grotius et la doctrine de la guerre juste. Paris 1983, S. 579; Michael BEHNEN, Der gerechte und der notwendige Krieg. »Necessitas« und »Utilitas reipublicae« in der Kriegstheorie des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Johannes KUNISCH (Hg.), Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit. Berlin 1986, S. 43–106, hier S. 96.
[10] Zur Kontroverse um Grotius’ Originalität und seine Bedeutung für die Entwicklung des Völkerrechts vgl. die Zusammenfassung der neueren Literatur bei Randall LESAFFER, Peace Treaties from Lodi to Westphalia, in: ders. (Hg.), Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One. Cambridge 2004, S. 9–44, hier S. 10–11.
[11] GROTIUS, Buch III, Kap. 20 (27–41), S. 835–840.
[12] Ebd., Buch II, Kap. 1 (17), S. 183: »Illud vero minime ferendum est quod quidam tradiderunt, iure gentium arma recte sumi ad imminuendam potentiam crescentem, quae nimium aucta nocere posset. […] ut vim pati posse ad vim inferendam ius tribuat, ab omni aequitatis ratione abhorret.«
[13] Vgl. die vergleichsweise schematische Gegenüberstellung einer philosophischen und einer rhetorischen Tradition und ihre Identifizierung mit scholastischen und humanistischen Auffassungen bei Richard TUCK, The Rights of War and Peace. Political Thought and the International Order from Grotius to Kant. Oxford/New York 1999, S. 18–31.
[14] Zur grotianischen Wendung des Problems vgl. Pärtel PIIRIMÄE, Just War in Theory and Practice. The Legitimation of Swedish Intervention in the Thirty Years War, in: The Historical Journal 45 (2002), S. 499–523, hier S. 510–511. Es dürfte ungeachtet der Vielschichtigkeit der Ausführungen des »De iure belli ac pacis« nicht von der Hand zu weisen sein, dass sich Grotius in dieser Frage eine äußerst skeptische Auffassung zu eigen gemacht hat, vgl. oben, Anm. 12.
[15] Etwa im Sinne der modernen, ihrerseits keineswegs unumstrittenen Postulate eines Erforderlichkeits– und eines Abwägungsgebots, vgl. Michael KRUGMANN, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Völkerrecht. Berlin 2004, S. 123.
[16] REPGEN, Kriegslegitimationen, S. 45.
[17] Vgl. Heinz DUCHHARDT, Peace Treaties from Westphalia to the Revolutionary Era, in: LESAFFER, (Hg.), Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One. Cambridge 2004, S. 45–58, hier S. 49. Den hohen Stellenwert des Amnestiekonzepts gerade im Europa des 16. bis 18. Jahrhunderts erläutert FISCH, Friedensvertrag, S. 92–112.
[18] Einen im Hinblick auf die Herstellung des zwischenstaatlichen Friedens transitorischen Charakter der Verträge von 1648 betont Heinz DUCHHARDT, Zwischenstaatliche Friedens– und Ordnungskonzepte im Ancien Régime. Idee und Realität, in: Ronald G. ASCH / Wulf Eckart VOß / Martin WREDE (Hg.), Frieden und Krieg in der Frühen Neuzeit. Die europäische Staatenordnung und die außereuropäische Welt. München 2001, S. 37–45, hier S. 40.
[19] HHStA, Frankreich Varia, K 6, Fasz. 9, Aktenstücke den Frieden von Münster und Osnabrück betreffend, fol. 1–14, Ludwig XIV. an den Herzog von Sachsen–Weimar und den Bischof von Osnabrück, 24. März 1656, hier fol. 8r.: »Vous n’auez pas oublié, que la principale condition qui me regarde, est compris dans l’article troisiesme, qui porte en termes expres, que L’Empereur, ni aucun Prince de L’Empire, ne pourra se mesler de la guerre que Je suis presentement obligé de soustenir contre le Roy d’Espagne [...]. On a pris quelque soing de sauuer les apparences, en faisant semblant de licentier les trouppes, qui estoient au seruice de L’Empereur, lors qu’on les a uoulu faire passer à celuy d’Espagne.«
[20] Zwey merkwuerdige Declarationen der Könige von Frankreich und Schweden, welche Höchst–Dieselben als Garante des Westphälischen Friedens den 30. Martii 1757 Der Reichs–Versammlung zu Regenspurg durch Ihre Minister [...] übergeben lassen [...], Regensburg 1757.
[21] Vgl. Lettres des manifestes du Roy de France, contenant les justes causes que sa Majesté a eues de déclarer la guerre au Roy d’Espagne, Paris 1635, S. 7: » [...] autrement ce seroit fomenter vne semence perpetuelle de discorde, & au lieu d’éteindre le feu, ce seroit le cacher sous les cendres pour le r’alumer de nouueau, auec d’autant plus de danger qu’il surprendroit à l’impourueu«.
[22] Memoire des raisons qui ont obligé le Roy de France à reprendre les armes, in: Jean DUMONT (Hg.), Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un Recueil des Traitez d’Alliance, de Paix, de trève, de neutralité, de commerce, etc., qui ont été faits en Europe, depuis le règne de l'empereur Charlemagne jusques à présent, 8 Bände. Amsterdam 1726–173, VII/2, S. 170–173.
[23] Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, Reflexions sur la Declaration de Guerre, in: ders., Politische Schriften, hg. v. Zentralinstitut für Philosophie an der Akademie der Wissenschaften der DDR, Bd. 3, 1677–1689. Berlin (Ost) 1986, S. 72–190, hier S. 79 u. 91.
[24] Dies gilt insbesondere für den Orient, wo umfassende Herrschaftsansprüche europäischer Mächte weniger bedeutsam waren als etwa in Amerika, vgl. Jörg FISCH, Die europäische Expansion und das Völkerrecht. Die Auseinandersetzungen um den Status der überseeischen Gebiete vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Stuttgart 1984, S. 481–482.
[25] Franz BABINGER, Qara Mustafa Paschas Esseger Sendschreiben an den Markgrafen Herman von Baden. Mit zwei Abbildungen, in: Archiv Orientální 4 (1932), S. 23–33.
[26] Manifeste du Roy de Pologne, Pour servir de Response au Manifeste publié par le Roy de Suede, Touchant la guerre qu’il fait à la Pologne, s. l. 1656, S. 28; Declaration de Guerre Et Edicts de leurs Hautes Puissances les Etats Généraux des Provinces Unies [1689], S. 1.
[27] Manifeste ou Déclaration des Etats Généraux des Provinces–Unies des Pays–bas [...], Den Haag, 2. August 1652, DUMONT, Corps, VI/2, S. 31–35.
[28] Kenneth Harold D. HALEY, William of Orange and the English Opposition 1672–4. Oxford 1953, hier S. 31.
[29] DUMONT, Corps, VII/1, S. 163.
[30] George CHALMERS (Hg.), A Collection of Treaties between Great Britain and other Powers, Bd. 1. London 1790, S. 141–142; DUMONT, Corps, VII/1, S. 44–53, hier S. 46.
[31] CHALMERS, Collection of Treaties, S. 146–147. Art. 32 des Vertrages von Breda bedeutete jedoch keine grundsätzliche Infragestellung der Ewigkeit des geschlossenen Abkommens, die sich gerade seit der Mitte des 17. Jahrhunderts als Element des Friedensschlusses allgemein durchsetzte, vgl. FISCH, Friedensvertrag, S. 361–366.
[32] Vrsachen / Dahero Der Durchleuchtigste vnnd Großmächtigste Fürst vnnd Herr / Herr Gustavus Adolphus […] gezwungen worden / mit dem Kriegsvolck in Deutschland überzusetzen [1630], zit. nach Sigmund GOETZE, Die Politik des schwedischen Reichskanzlers Axel Oxenstierna gegenüber Kaiser und Reich. Kiel 1971, S. 349–365, hier S. 351.
[33] Zum Konzept des legitimen Krieges und seinen Schlüsselbegriffen der »auctoritas principis«, »iusta causa« und »intentio recta«, die seit Thomas von Aquin die Diskussion bestimmten vgl. JANSSEN, Krieg, S. 572.
[34] Zum politischen Kontext vgl. Max SPÖRRI, Der 1. Villmerger– oder Rapperswilerkrieg im Spiegel des Zürcher Ratsmanuals von 1656, in: Zürcher Taschenbuch 78 (1958), S. 68–80.
[35] Manifest vor dem uszug 1655 (1656), in: Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede, Bd. V/1, 1649–1680, hg. v. Johann Adam PUPIKOFER. Frauenfeld 1867, S. 303–304; Manifest der katholischen Orte, ebd., S. 304–309.
[36] Vgl. DUCHHARDT, Friedens– und Ordnungskonzepte, S. 40–41.
[37] FISCH, Friedensvertrag, S. 521.
[38] DUMONT, Corps, VII/2, S. 226.
[39] So beispielsweise in den Lettres des manifestes (wie Anm. 21), S. 4: »Sa Majesté [Ludwig XIII.] a souffert tous ces outrages auec tant de patience, que ceux qui la consideroient, l’ont souuent excitee au ressentimens, qu’elle auoit suject d’en témoigner, & luy ont plusieurs fois remonstré le dommage qu’elle receuoit, & beaucoup d’autres auec elle, de voir consommer ses forces inutilement […].«
[40] DUMONT, Corps, VII/2, S. 170–173, 175–179.
[41] Johannes BURKHARDT, Die Friedlosigkeit der Frühen Neuzeit. Grundlegung einer Theorie der Bellizität Europas, in: ZHF 24 (1997), S. 509–574, hier S. 561–570; ders., Geschichte als Argument in der habsburgisch–französischen Diplomatie. Der Wandel des frühneuzeitlichen Geschichtsbewusstseins in seiner Bedeutung für die diplomatische Revolution von 1756, in: Rainer BABEL (Hg.), Frankreich im europäischen Staatensystem der Frühen Neuzeit. Sigmaringen 1995, S. 191–217.
[42] Zur Wirkungsgeschichte der Schriften Machiavellis und ihre zunehmende Reduktion auf den »Principe« vgl. KERSTING, Machiavelli, S. 155–167.
[43] Vgl. Randall LESAFFER, War, Peace, Interstate Friendship and the Emergence of the »ius publicum Europaeum«, in: ASCH / Voß / WREDE, S. 87–113, hier S. 95 und S. 112–113.
[44] Vgl. Otto KIMMINICH, Einführung in das Völkerrecht. München u.a. 1990, S. 73–74.
[45] Es liegt nahe, den Kriegserklärungen eine überwiegend propagandistische Funktion im Sinne LESAFFERS zuzuschreiben, die vom Vordringen des nicht–diskriminierenden Kriegsbegriffs unberührt blieb, vgl. ders., War, Peace, S. 112.
[46] Fritz DICKMANN, Der Westfälische Frieden. Münster 1972, S. 160; zur vielfältigen Instrumentalisierung des Arbiter–Konzepts durch den neuzeitlichen Staat vgl. Christoph KAMPMANN, Arbiter und Friedensstiftung. Die Auseinandersetzung um den politischen Schiedsrichter im Europa der Frühen Neuzeit. Paderborn u. a. 2001.
[47] Déclaration de Guerre de Louis XIV., Roi de France, contre l’Angleterre, en faveur des Hollandois [...], in: DUMONT, Corps, VI/3, S. 82.
[48] François BLUCHE, Louis XIV. Paris 1987, S. 347.
[49] Vgl. etwa Franz Paul von LISOLA, Le Bouclier d’Estat et de Justice, contre le dessein manifestement découvert de la Monarchie Universelle, sous le vain prétexte des prétentions de la Reyne de France, s. l. 1667, S. 40 und S. 66.
[50] Barbara STOLLBERG–RILINGER, Einleitung, in: dies. (Hg.), Vormoderne politische Verfahren. Berlin 2001, S. 9–24; dies., Die zeremonielle Inszenierung des Reiches, oder: Was leistet der kulturalistische Ansatz für die Reichsverfassungsgeschichte?, in: Matthias SCHNETTGER (Hg.), Imperium Romanum – Irregulare Corpus – Teutscher Reichs–Staat. Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der Historiographie. Mainz 2002, S. 233–246, hier S. 236–237.
[51] Vgl. die Würdigung einer langfristigen Ordnungs– und Stabilisierungsfunktion des entstehenden Völkerrechts vor dem Hintergrund enormer Umwälzungen der politischen Realität bei Heinhard STEIGER, Ius bändigt Mars. Das klassische Völkerrecht und seine Wissenschaft als frühneuzeitliche Kulturerscheinung, in: ASCH / VOß / WREDE, S. 59–85.
ZITIEREMPFEHLUNG
Bernd Klesmann, Der Friedensvertrag als Kriegsgrund. Politische Instrumentalisierung zwischenstaatlicher Abkommen in europäischen Kriegsmanifesten der Frühen Neuzeit, in: Heinz Duchhardt / Martin Peters (Hg.), Kalkül – Transfer – Symbol. Europäische Friedensverträge der Vormoderne, Mainz 2006-11-02 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft online 1), Abschnitt 109–121.
URL: <http://www.ieg-mainz.de/vieg-online-beihefte/01-2006.html>.
URN: <urn:nbn:de:0159-2008031300>.
Bitte setzen Sie beim Zitieren dieses Aufsatzes hinter der URL-Angabe in runden Klammern das Datum Ihres letzten Besuchs dieser Online-Adresse ein.
Beim Zitieren einer bestimmten Passage aus dem Aufsatz bitte zusätzlich die Nummer des Textabschnitts angeben, z.B. 110 oder 109–112.